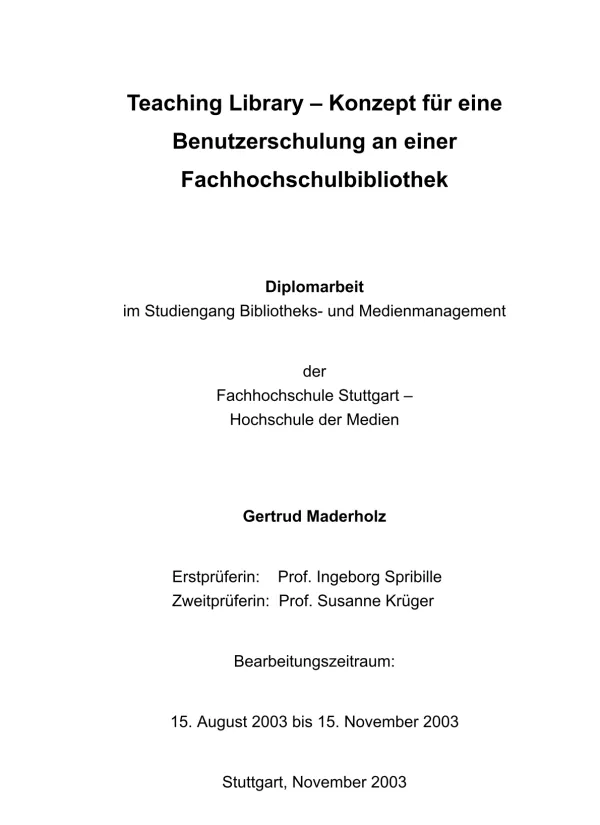
Teaching Library: Benutzerschulungskonzept
Dokumentinformationen
| Autor | Gertrud Maderholz |
| instructor | Prof. Ingeborg Spribille |
| Schule | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Medienmanagement |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 738.77 KB |
Zusammenfassung
I.Entwicklung eines Schulungskonzeptes für die Fachhochschulbibliothek Esslingen
Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Schulungskonzeptes für die Fachhochschulbibliothek Esslingen, fokussiert auf die Verbesserung der Informationskompetenz der Studierenden. Angesichts der wachsenden Informationsflut und der komplexen Datenbankrecherche, besteht ein hoher Bedarf an praxisorientierten Benutzerschulungen. Das Konzept konzentriert sich auf themenorientierte Angebote, angepasst an die Bedürfnisse der Studierenden im Diplomjahrgang, im Gegensatz zu allgemeinen Einführungen in die Bibliothek. Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle der Informationskompetenz, wie das Big6-Modell und das ISP-Modell, um ein effektives und zielgerichtetes Schulungskonzept zu entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist die Umsetzung des Teaching Library Ansatzes, der über die reine Vermittlung technischer Fertigkeiten hinausgeht und die aktive Beteiligung der Studierenden fördert. Die Fachhochschule Esslingen profitiert von diesem maßgeschneiderten Ansatz, der die Mitarbeiter der Bibliothek effektiv unterstützt.
1. Bedarf an Benutzerschulungen und Informationskompetenz
Die Arbeit beginnt mit der Feststellung des dringenden Bedarfs an effektiven Benutzerschulungen an Fachhochschulen. Die zunehmende Informationsflut und die Komplexität neuer Informationssysteme erfordern die Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Informationskompetenz. Viele Studierende und Lehrende fehlt jedoch das Problembewusstsein für die Notwendigkeit von Informationskompetenz. Diese Lücke stellt eine große Chance für Bibliotheken dar, ihre Rolle als Informationszentren zu stärken und durch gezielte Schulungsangebote die Informationskompetenz der Nutzer zu verbessern. Die Arbeit argumentiert, dass die Zukunft in themenorientierten Schulungsangeboten liegt, die den individuellen Bedürfnissen und dem spezifischen Informationsbedarf der Nutzer entsprechen. Dies im Gegensatz zu allgemeinen Einführungen, die oft eine geringere Motivation und einen geringeren Lernerfolg aufweisen. Die Entwicklung eines solchen Konzeptes steht im Mittelpunkt der Arbeit, angepasst an die spezifischen Gegebenheiten der Fachhochschulbibliothek Esslingen.
2. Theorie und Praxis der Benutzerschulung Teaching Library und Informationskompetenzmodelle
Dieser Abschnitt beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Benutzerschulung und Informationskompetenz. Der Begriff der 'Teaching Library' wird eingeführt und seine Bedeutung im Kontext der Informationskompetenzvermittlung erläutert. Es werden verschiedene Modelle zur Informationskompetenz vorgestellt, darunter das 'Big6 Skills Information Problem-Solving Approach' von Eisenberg/Berkowitz, das 'Information Searching Process' (ISP)-Modell von Carol Kuhltau und das 'Dynamische Modell der Informationskompetenz' (DYMIK) der Universitätsbibliothek Heidelberg. Diese Modelle bieten verschiedene Perspektiven auf den Informationssuchprozess und dienen als Grundlage für die Entwicklung des Schulungskonzeptes. Die 'Information Literacy Competency Standards for Higher Education' liefern zusätzliche Richtlinien für die zu vermittelnden Kompetenzen. Die Analyse zeigt, dass nicht alle Modelle gleichermaßen praktikabel sind, aber sie liefern wertvolle Orientierungspunkte und Ansätze für die Gestaltung einer effektiven Benutzerschulung. Der Abschnitt unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Herangehensweise, die über die reine Vermittlung technischer Fertigkeiten hinausgeht.
3. Derzeitige Situation an der Fachhochschulbibliothek Esslingen und Entwicklung des Schulungskonzeptes
Im Kern dieser Arbeit steht die Entwicklung eines maßgeschneiderten Schulungskonzeptes für die Fachhochschulbibliothek Esslingen. Zunächst wird die aktuelle Situation der Bibliothek bezüglich Benutzerschulungen analysiert. Es wird festgestellt, dass bisherige Bemühungen, regelmäßige Schulungen anzubieten, auf wenig Interesse gestoßen sind. Das Konzept konzentriert sich daher auf themenorientierte Schulungen für Studierende höherer Semester, insbesondere für die Recherche im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten. Diese themenzentrierte Herangehensweise soll die Motivation der Studierenden erhöhen. Es werden konkrete Beispiele für die Umsetzung des Konzeptes vorgestellt, unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten und des vorhandenen technischen Equipments. Die Rolle der Bibliothekarin als Tutor und die Bedeutung aktiver Beteiligung der Studierenden werden hervorgehoben. Die Arbeit berücksichtigt auch die Vorkenntnisse der Studierenden, ausgehend von einer bereits bestehenden Bibliothekseinführung und Datenbankschulung im ersten Semester. Das Konzept sieht eine grundlegende bis mittelschwere Schulung vor, um eine Überforderung der Studierenden zu vermeiden.
4. Lernziele Ablaufplan und Lernerfolgskontrolle
Ein wichtiger Aspekt des Schulungskonzeptes ist die präzise Formulierung von Lernzielen. Es werden verschiedene Lernzieltypen (kognitiv und affektiv) und Lernzielstufen (Richt-, Grob- und Feinlernziele) erläutert. Die Lernziele bilden die Grundlage für die Planung und Gestaltung der Schulung und dienen als Orientierungshilfe für die Studierenden. Ein detaillierter Ablaufplan für die Schulung wird erstellt, der den Zeitrahmen, die Lernziele und die Methoden beinhaltet. Die Arbeit betont die Notwendigkeit von Flexibilität während der Schulung, um auf spontane Änderungen und den individuellen Lernfortschritt der Teilnehmer reagieren zu können. Da eine detaillierte Evaluation der Schulung aus zeitlichen Gründen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, wird ein Konzept zur Lernerfolgskontrolle vorgestellt. Ein Fragebogen zur Evaluation nach der Schulung soll die Zufriedenheit der Studierenden und den Lernerfolg erfassen. Die Ergebnisse des Fragebogens sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Schulungsangebots der Fachhochschulbibliothek Esslingen verwendet werden.
II.Analyse bestehender Schulungskonzepte und Informationskompetenzmodelle
Die Arbeit analysiert bestehende Benutzerschulungen, identifiziert Defizite und präsentiert verschiedene Modelle zur Vermittlung von Informationskompetenz. Beispiele wie die Universitätsbibliothek Kassel und die Universitätsbibliothek Würzburg dienen als Vergleichsbasis. Die Analyse umfasst die Modelle von Eisenberg/Berkowitz (Big6), Kuhltau (ISP) und das DYMIK-Modell der Universitätsbibliothek Heidelberg. Diese Modelle beleuchten den Informationssuchprozess und bieten Orientierungspunkte für die Gestaltung effektiver Benutzerschulungen. Die 'Information Literacy Competency Standards for Higher Education' liefern zusätzliche Richtlinien für die zu vermittelnden Kompetenzen.
1. Bestandsaufnahme der Benutzerschulungen in Deutschland
Dieser Abschnitt untersucht den aktuellen Stand von Benutzerschulungen in deutschen Bibliotheken. Es wird deutlich gemacht, dass trotz des wachsenden Bedarfs an Informationskompetenz, Defizite in der Umsetzung von effektiven Benutzerschulungen bestehen. Die Analyse zeigt, dass viele Bibliotheken noch vor großen Herausforderungen stehen, um ihre Leistungen in diesem Bereich zu verbessern. Die Arbeit betont jedoch, dass dies nicht als Kritik an den Bibliotheken verstanden werden soll, sondern als Anstoß zur Reflexion bestehender Konzepte und zur Entwicklung zukünftiger Strategien. Der Abschnitt dient als Grundlage für die Entwicklung des eigenen Schulungskonzeptes, indem er die Stärken und Schwächen bestehender Ansätze aufzeigt und somit eine fundierte Basis für die Konzeption einer verbesserten Benutzerschulung schafft. Es wird betont, dass die Arbeit neue Denkanstöße liefern und zur Konfrontation mit der aktuellen Situation beitragen soll, um einen besseren Eindruck davon zu gewinnen, was bisher getan wurde und was zukünftig notwendig ist.
2. Analyse verschiedener Modelle der Informationskompetenz
Ein zentraler Teil der Analyse beschäftigt sich mit verschiedenen Modellen der Informationskompetenz und ihrer didaktischen Umsetzung. Drei wichtige Modelle werden im Detail vorgestellt: Das 'Big6 Skills Information Problem-Solving Approach' von Eisenberg/Berkowitz, das 'Information Searching Process' (ISP)-Modell von Carol Kuhltau und das 'Dynamische Modell der Informationskompetenz' (DYMIK) der Universitätsbibliothek Heidelberg. Zusätzlich werden die 'Information Literacy Competency Standards for Higher Education' herangezogen, um die notwendigen Kompetenzen eines informationskompetenten Studierenden zu definieren. Die Darstellung der Modelle macht deutlich, wie der Informationsprozess aufgebaut ist und wie Schulungen darauf abgestimmt sein sollten. Es wird jedoch auch kritisch reflektiert, dass nicht alle Aspekte der Modelle direkt in die Praxis übertragbar sind. Trotzdem bieten die Modelle wertvolle Orientierungspunkte und liefern wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung eines eigenen, praxistauglichen Schulungskonzeptes. Die Analyse dient als Grundlage für die Auswahl geeigneter Methoden und Inhalte der Benutzerschulung.
3. Beispiele erfolgreicher Teaching Libraries
Um die theoretischen Konzepte zu veranschaulichen, werden konkrete Beispiele von Teaching Libraries vorgestellt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von drei ausgewählten Beispielen, um deren Stärken und Schwächen aufzuzeigen und die jeweiligen Umsetzung der Informationskompetenz zu beleuchten. Besonders die Universitätsbibliothek Kassel wird als sehr hilfreich für die eigene Konzeptentwicklung hervorgehoben, da sie ausführlich und nachvollziehbar beschrieben wird. Die Analyse der Beispiele dient dazu, die verschiedenen Ansätze im Bereich der Benutzerschulung zu vergleichen und daraus best practice-Beispiele zu extrahieren, die für die Entwicklung des eigenen Konzeptes für die Fachhochschulbibliothek Esslingen relevant sind. Durch die Betrachtung verschiedener Modelle, werden sowohl die Vor- als auch Nachteile einzelner Ansätze sichtbar und unterstützen die Entwicklung eines optimalen Konzepts für die lokale Situation. Die Beschreibung der Entwicklung der Benutzerschulungen in Deutschland, angefangen von pragmatischen, objektorientierten Ansätzen bis hin zu umfassenderen pädagogischen Konzepten, liefert weitere wertvolle Einblicke.
III.Das entwickelte Schulungskonzept für die Fachhochschulbibliothek Esslingen
Das entwickelte Konzept für die Fachhochschulbibliothek Esslingen beinhaltet themenorientierte Benutzerschulungen für Studierende höherer Semester, speziell für die Recherche im Kontext von Abschlussarbeiten. Es werden klare Lernziele definiert (Richt-, Grob- und Feinlernziele), um den Lernerfolg zu gewährleisten. Die Schulung integriert praktische Übungen zur Datenbankrecherche (z.B. ReDI und WISO-Net), die aktive Teilnahme der Studierenden und die Unterstützung durch die Bibliothekarin als Tutor. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Recherchekompetenzen in spezifischen Datenbanken, angepasst an das vorhandene EDV-Wissen der Studierenden. Ein Fragebogen zur Evaluation des Lernerfolgs ist vorgesehen, um das Angebot stetig zu optimieren. Die Hochschulbibliothek Esslingen bietet bereits eine Bibliothekseinführung und Datenbankschulung im ersten Semester an, aber weitere regelmäßige Schulungen wurden bisher kaum angenommen.
1. Zielgruppe und Konzept der Benutzerschulung
Das entwickelte Schulungskonzept richtet sich gezielt an Studierende höherer Semester der Fachhochschule Esslingen, insbesondere an Studierende im Diplomjahrgang. Im Gegensatz zu allgemeinen Einführungen in die Bibliothek konzentriert sich die Schulung auf themenorientierte Einheiten. Diese thematische Fokussierung soll die Motivation der Studierenden erhöhen, da sie direkt an ihren Forschungs- und Schreibprozessen (z.B. Diplomarbeit) anknüpft. Die Erfahrung zeigt, dass eine höhere Motivation zu einem besseren Lernerfolg führt, da die Studierenden den direkten Nutzen der Schulung für ihre Arbeit erkennen. Allgemeine Einführungen hingegen stoßen oft auf geringeres Interesse, da der Bezug zum konkreten Informationsbedarf der Studierenden fehlt. Das Konzept betont daher die praktische Relevanz und den direkten Nutzen der Schulung für die angestrebten Forschungsziele der Studierenden. Die höhere Vorbereitungszeit für den Schulungsleiter wird durch den deutlich höheren Lernerfolg der Studierenden gerechtfertigt.
2. Methodische Umsetzung und didaktische Gestaltung
Das Schulungskonzept sieht eine Kombination aus theoretischer Vermittlung und praktischen Übungen vor. Die Studierenden sollen aktiv in den Lernprozess eingebunden werden, z.B. durch Gruppenarbeit und eigenständige Rechercheaufgaben. Die Bibliothekarin fungiert dabei als Tutorin und unterstützt die Studierenden bei der Bewältigung von Problemen und Fragen. Als didaktischer Ansatz wird der 'informierende Unterrichtseinstieg' verwendet, um den Studierenden von Beginn an die Lernziele und den Ablauf der Schulung transparent darzulegen und somit die Motivation und das Verständnis zu erhöhen. Die konkreten Lernziele werden in Richt-, Grob- und Feinlernziele unterteilt, um einen klaren Fokus zu setzen und einen strukturierten Lernprozess zu gewährleisten. Die Schulung beinhaltet Übungen zur Datenbankrecherche (z.B. ReDI und WISO-Net), die den Studierenden den Umgang mit relevanten Informationssystemen vermitteln. Die Möglichkeit der Fernleihe und die Nutzung des Online-Katalogs (WebPac) werden ebenfalls vermittelt und praktisch angewendet. Der Fokus liegt auf einer leichten bis mittelschweren Grundlagenschulung, um eine Überforderung der Studierenden zu vermeiden.
3. Evaluation und Lernerfolgskontrolle
Da die Durchführung und eine detaillierte Evaluation der Schulung aus zeitlichen Gründen nicht im Rahmen dieser Arbeit möglich sind, werden lediglich theoretische Überlegungen zur Lernerfolgskontrolle angestellt. Es wird vorgeschlagen, den Erfolg der Schulung mittels eines Fragebogens zu evaluieren, um die Zufriedenheit der Studierenden und den Lernerfolg zu messen. Dieser Fragebogen soll die Grundlage für zukünftige Optimierungen des Schulungsangebots bilden. Eine Vorevaluation wird aus Kapazitätsgründen abgelehnt. Die Evaluation soll der Fachhochschulbibliothek Esslingen ermöglichen, ihr Angebot gezielt an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen. Ein Test wird als nicht sinnvoll erachtet, da die Schulung nicht als Prüfungseinheit im Curriculum verankert ist. Das Konzept beinhaltet auch Überlegungen zur Nutzung von Arbeits- und Aufgabenblättern, die den Studierenden den Zugang zu wichtigen Informationen wie Login-Daten und Hinweise zu den verwendeten Datenbanken erleichtern sollen.
IV.Methoden und Evaluation
Die Arbeit beschreibt die gewählte Methodik, u.a. den 'informierenden Unterrichtseinstieg', um die Lernziele transparent zu machen und die Motivation der Studierenden zu steigern. Die Evaluation des entwickelten Schulungskonzeptes wird mit einem Fragebogen nach der Durchführung erfolgen. Eine Vorevaluation wird aufgrund des begrenzten Ressourcenaufwandes zunächst nicht durchgeführt. Die Evaluation zielt darauf ab, den Lernerfolg zu messen und das Angebot der Fachhochschulbibliothek Esslingen an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen. Der Fokus liegt auf der Verbesserung des Services der Bibliothek und der Stärkung der Informationskompetenz der Studierenden.
1. Methoden des Informationsvermittlung
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Informationsvermittlung und wählt den 'informierenden Unterrichtseinstieg' als didaktischen Ansatz für die Benutzerschulung. Diese Methode beinhaltet die transparente Darstellung der Lernziele und des Ablaufs der Schulung zu Beginn der Veranstaltung. Der Fokus liegt darauf, den Studierenden den Nutzen und die Relevanz der Schulung für ihre Arbeit deutlich zu machen, um Unsicherheiten und Unklarheiten von Anfang an zu vermeiden. Zusätzlich werden praktische Übungen integriert, die in Gruppenarbeit durchgeführt werden und die Studierenden aktiv in den Lernprozess einbeziehen. Die Bibliothekarin fungiert dabei als Tutorin, die den Studierenden bei Fragen und Problemen Unterstützung bietet. Diese Methode steht im Kontrast zu rein behavioristischen oder kognitivistischen Ansätzen, da sie einen größeren Spielraum für die selbstgesteuerte Gestaltung des Lernprozesses durch den Studierenden zulässt. Es wird jedoch betont, dass diese Form des Lehrens und Lernens einen größeren Zeitaufwand erfordert. Der Einsatz eines Arbeits- und Aufgabenblattes, welches Login-Daten, Zugriffsinformationen und Hinweise zu den Datenbanken ReDI und WISO-Net enthält, ist ebenfalls Teil des Konzepts. Die praktische Anwendung der recherchierten Informationen, inklusive des Zugriffs auf den WebPac und die Möglichkeit der Fernleihe, wird ebenfalls Bestandteil der Schulung sein.
2. Lernerfolgskontrolle und Evaluation
Die Arbeit betont die Wichtigkeit der Lernerfolgskontrolle und Evaluation der Benutzerschulung, auch wenn eine detaillierte Evaluation im Rahmen der Arbeit nicht möglich ist. Als erster Schritt zur Evaluation wird ein Fragebogen nach der Durchführung der Schulung vorgeschlagen. Dieser Fragebogen soll den Erfolg der Veranstaltung messen und Rückmeldungen der Studierenden zur Verbesserung des Angebots sammeln. Eine Vorevaluation mittels Fragebogen wird aufgrund des zu großen Aufwands für die Fachhochschulbibliothek Esslingen als derzeit nicht umsetzbar verworfen. Die Post-Evaluation mittels Fragebogen ermöglicht es der Bibliothek, ihr Angebot besser an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen und den Studierenden gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass ihre Rückmeldungen ernst genommen und für die Weiterentwicklung des Angebots verwendet werden. Ein Test wird als ungeeignet erachtet, da die Schulung nicht als eigenständige Lerneinheit im Curriculum verankert und somit nicht prüfungsrelevant ist. Die Ergebnisse der Evaluation sollen helfen, das Konzept der Benutzerschulung kontinuierlich zu verbessern und ein auf die Bedürfnisse der Studierenden abgestimmtes Angebot zu gewährleisten.
