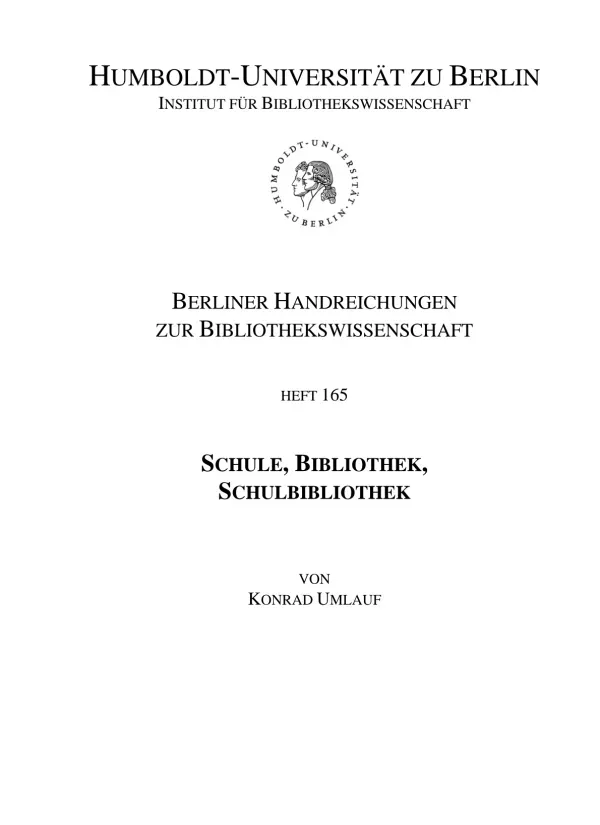
Schulbibliothek: Konzept & Kooperation
Dokumentinformationen
| Autor | Konrad Umlauf |
| Schule | Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliothekswissenschaft |
| Fachrichtung | Bibliothekswissenschaft |
| Ort | Berlin |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 782.00 KB |
Zusammenfassung
I.Informationskompetenz in Schule und Bibliothek
Dieser Artikel beleuchtet die zentrale Rolle der Informationskompetenz im Bildungssystem. Er vergleicht den eng gefassten Ansatz der Lesekompetenz (wie in der PISA-Studie) mit dem umfassenderen Konzept der Informationskompetenz, welches die Fähigkeit beinhaltet, relevante Informationen zu finden, zu verstehen, ethisch zu nutzen und kritisch zu bewerten. Der Ansatz der amerikanischen Association of College and Research Libraries (ACRL) dient als Beispiel für ein mehrstufiges Modell zur Messung von Informationskompetenz. Die Entwicklung von Recherchetechniken und die Nutzung verschiedener Medien (Bücher, Internet, Multimedia) stehen dabei im Mittelpunkt. Die Einbindung der Schulbibliothek und die Kooperation mit öffentlichen Bibliotheken werden als entscheidend für den Erfolg betrachtet.
1. Lesekompetenz vs. Informationskompetenz
Der Text beginnt mit einem Vergleich zwischen Lesekompetenz, wie sie in der PISA-Studie im angloamerikanischen Kontext definiert ist, und Informationskompetenz. Die PISA-Studie betont die Operationalisierbarkeit und Messbarkeit der Lesekompetenz, die sich auf das Verständnis, die Einordnung und Nutzung eines gegebenen Textes konzentriert. Im Gegensatz dazu umfasst Informationskompetenz die eigenständige Suche nach dem für die Fragestellung relevanten Text, bevor Lesen, Verstehen und Nutzen stattfinden. Die ethische Nutzung der gefundenen Informationen wird als weiterer wichtiger Aspekt der Informationskompetenz hervorgehoben. Es wird deutlich, dass Informationskompetenz weit über das reine Leseverstehen hinausgeht und eine lebensweltliche Relevanz besitzt, die die Weiterentwicklung des Wissens und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördert. Der Text beschreibt die Kompetenzstufen der PISA-Studie als Beispiel für die Kategorisierung von Leseleistungen, wobei die Kompetenzstufe I grundlegende Fähigkeiten und die Kompetenzstufe V Expertenwissen repräsentiert.
2. Der ACRL Ansatz zur Informationskompetenz
Als einführendes Beispiel für ein umfassendes Modell zur Informationskompetenz wird der Ansatz der American Association of College and Research Libraries (ACRL) vorgestellt. Dieser Ansatz zeichnet sich durch seine Operationalisierbarkeit aus, indem er Lernziele, Leistungsindikatoren und beispielhafte Ergebnisse miteinander verbindet. Er dient als Inventar von Lernzielen, an denen die Lernergebnisse gemessen werden können. Im Gegensatz dazu beschränkt sich der Lesekompetenzansatz der PISA-Studie auf lediglich zwei der vier Lernziele des ACRL-Ansatzes. Der ACRL-Ansatz wird als dreistufig beschrieben: Standards/Lernziele, Leistungsindikatoren und Handlungsweisen/Arbeitsergebnisse. Insgesamt listet er 87 Arbeitsergebnisse auf, die den hohen Anspruch des Ansatzes verdeutlichen. Es werden exemplarisch einige Arbeitsergebnisse genannt, wie die Bewertung von Informationsquellen, das Exzerpieren und Verwalten von Informationen sowie die kritische Beurteilung von Quellen und die Verbindung von Informationen zu neuen Konzepten.
3. Zusätzliche Ansätze und Lernziele zur Informationskompetenz
Der Text erwähnt verschiedene Ausprägungen des Informationskompetenz-Ansatzes, ohne näher darauf einzugehen. Ein weiterer Ansatz der American Association of School Librarians (AASL) für allgemeinbildende Schulen wird vorgestellt, der Lernziele wie das Verständnis ökonomischer, rechtlicher und sozialer Aspekte der Informationsnutzung sowie die ethisch und legal korrekte Informationsnutzung umfasst (z.B. Vermeidung von Plagiaten und Einhaltung der Netiquette). Ein weiteres Lernziel betrifft die effektive Nutzung von Informationen, sowohl individuell als auch in der Gruppe, zur Erreichung bestimmter Ziele, wobei handlungs- und produktorientierte didaktische Ansätze im Vordergrund stehen. Der Beitrag zur „lernenden Gesellschaft“ durch erfolgreiche Gruppenarbeit wird als weiterer wichtiger Aspekt genannt. Ein Vergleich mit dem Portal www.schulmediothek.de zeigt ein weniger umfassendes, aber ähnliches Konzept, das Phasen des Lernprozesses unter Einbezug der Schulbibliothek beschreibt (Basisangebot für Grundschüler, Spaßtag für 2.-6. Klasse mit Einführung in die systematische Aufstellung und den OPAC). Die Entwicklung von vier aufeinander aufbauenden Mustern für Klassenführungen, die auf Spielhandlungen basieren, wird kritisch betrachtet, da die angestrebten Ziele und die pädagogischen Konzepte teilweise ungenügend aufgegriffen werden.
II.Kooperation zwischen Schule und öffentlicher Bibliothek
Erfolgreiche Kooperationen zwischen Schulen und öffentlichen Bibliotheken fördern die Informationskompetenz der Schüler. Der Text beschreibt verschiedene Modelle, darunter spielerische Ansätze wie Bibliotheks-Rallyes (Beispiel: Stadtbibliothek Ludwigsburg) und themenbezogene Lernarrangements. Wichtige Aspekte sind die Einbindung von Lehrern (z.B. durch Fortbildungen im Rahmen des PISA-Koffers des Berliner LISUM) und Eltern, die Bereitstellung von Medienkoffern und die Entwicklung von Recherche-Übungen im OPAC und im Internet. Langfristige Kooperationen benötigen Zeit und eine systematische Organisation (Beispiel: Kooperationsvereinbarungen in verschiedenen Bundesländern wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen). Die Stadtbibliothek Bielefeld erweitert ihre Medienboxen um Online-Ressourcen und die Stadtbücherei Landshut betont die Wichtigkeit von Fortbildungen für Erzieher.
1. Modelle der Kooperation Spiel und Erlebnis
Der Text beschreibt verschiedene Modelle der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Bibliotheken, wobei spielerische Ansätze im Vordergrund stehen. Ein Beispiel ist die Bibliotheks-Rallye der Stadtbibliothek Ludwigsburg (1989), die in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule durchgeführt wurde. Diese Rallye nutzte spielerische Elemente, um Grundschülern die Bibliothek näherzubringen. Weitere Beispiele umfassen thematische Spielhandlungen wie „Ausflug auf eine unbekannte Insel“ oder „Gespenster im Gruselschloss“, die Lernprozesse mit Aktion, Bewegung und praktischem Tun verbinden. Der Ansatz des erlebenden Lernens wird als ganzheitlicher und tätigkeitsorientierter Standard bei Einführungen in Bibliotheken hervorgehoben. Es wird betont, dass derartige Spielhandlungen Lernprozesse nach dem Muster von Rallyes, Entdeckungsreisen oder Weltraumfahrten (Bibliotheksgalaxis) gestalten und den Erlebnisqualitäten der alltäglichen Lebenswelt nahekommen, was als informelles Lernen bezeichnet wird. Belohnungen wie Bibliotheksführerscheine oder Buchpreise (Beispiel: Projekt des medienpädagogischen Instituts Promedia in der Euregio Aachen) werden als Motivation eingesetzt. Die Stadtbibliothek Brilon vergibt ein von Schulen anerkanntes Zertifikat.
2. Kooperationsformen und aktivitäten
Das Spektrum der Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen und Bibliotheken ist vielfältig. Die Vernetzung der Bibliotheksangebote mit dem Unterricht wird als entscheidend erachtet, wobei eine Verankerung von Bibliotheksbesuchen im Curriculum angestrebt wird (Beispiel: Hamburg). Die Rolle der Bibliothek im Sinne der Chancengleichheit wird hervorgehoben, da sie die Unterschiede in der Leseerziehung im Elternhaus ausgleichen kann. Erfolgreiche Kooperationen umfassen Lehrerkonferenzen in der Schulbibliothek, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für Lehrer, die Registrierung von Schulanfängern mit Ausstellung eines Bibliotheksausweises und die Bereitstellung von Medienkoffern durch die Bibliothek (Beispiel: Stadtbibliothek Bielefeld, die Medienboxen um Online-Ressourcen erweitert). Rechercheübungen im OPAC und in elektronischen Nachschlagewerken, Internet-Training-Kurse mit Fokus auf Suchstrategien und Informationsbewertung (im Gegensatz zur reinen Technik) sowie medienvergleichende Schulungen (Beispiel: Stadtbibliothek Göppingen) werden als weitere Beispiele genannt. Die Absprache von Unterrichtsthemen mit Lehrern für die rechtzeitige Bereitstellung von Materialien und die Teilnahme des Bibliothekspersonals an Planungssitzungen der Schule werden ebenfalls als wichtige Aspekte hervorgehoben. Die Einbindung von Schülern in die Arbeit der Schulbibliothek, z.B. durch die Übernahme klar abgegrenzter Aufgaben, wird positiv bewertet.
3. Herausforderungen und langfristige Perspektiven
Der Text weist auf Herausforderungen bei der Kooperation hin. Unterschiedliche Einschätzungen des Bedarfs der Schüler durch Bibliothekare und Lehrer werden thematisiert, ebenso die Bedenken mancher Lehrer bezüglich der Schülergeeignetheit der Materialien. Die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit auf den Lernzielen und dem Curriculum der Schule zu basieren, wird betont. Es wird darauf hingewiesen, dass Schüler die öffentliche Bibliothek auch als außerschulischen Raum erleben und dort andere Lesestoffe finden sollten. Eine australische Studie verdeutlicht, dass die Etablierung einer stabilen Kooperation drei Jahre in Anspruch nehmen kann. Der Text erwähnt Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Deutschen Bibliotheksverband und Kultusministerien in verschiedenen Bundesländern (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen) sowie weitergehende Projekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die eine systematische Organisation der Kooperation anstreben. In Österreich wird eine bibliothekarische Qualifizierung von Lehrkräften erwähnt, die zu einer verstärkten Identifikation von Lehrpersonal und Bibliothek führt. Die Entwicklung von ad-hoc-abrufbaren Modulen, wie im dänischen BibTeach-Projekt, wird als bewährte Praxis hervorgehoben.
III.Räumliche und organisatorische Voraussetzungen
Eine gelingende Kooperation zwischen Schule und Bibliothek erfordert geeignete räumliche und organisatorische Voraussetzungen. Der Text nennt Beispiele für erfolgreiche Initiativen und betont die Notwendigkeit einer systematischen Planung und Verankerung von Bibliotheksbesuchen im Curriculum. Die Einbindung von Schülern in die Arbeit der Schulbibliothek fördert die Identifikation und Verantwortungsübernahme. Die Schaffung einer einladenden Atmosphäre in der Bibliothek, die Neugierde weckt und zum Entdecken anregt, ist ebenfalls wichtig. Die Berücksichtigung der verschiedenen Lernbedürfnisse der Schüler (curriculare und freizeitorientierte Themen) spielt eine entscheidende Rolle. Das Konzept des Lernarrangements, inspiriert vom EFIL-Projekt (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung und Stadtbücherei Stuttgart), wird als hilfreich beschrieben.
1. Räumliche Voraussetzungen in Bibliotheken
Der Text betont die Bedeutung der räumlichen Gestaltung von Bibliotheken für eine erfolgreiche Kooperation mit Schulen. In Bibliotheken soll eine Mediennutzung verschiedenster Art ermöglicht werden, vom Schmökern über das Kopieren aus Büchern bis zum Downloaden aus dem Internet, sowohl individuell als auch in Gruppen. Durch Veranstaltungen, Displays, Raumorganisation und Warenleitbilder soll eine einladende Atmosphäre geschaffen werden, die Neugierde weckt und zum Entdecken anregt. Die Erschließungsstrukturen in Bibliotheken müssen sowohl den curricularen Strukturen der Schule (z.B. Vulkane in der Geografie) als auch freizeitorientierten Themen Rechnung tragen, um sowohl den Unterricht als auch die individuellen Interessen der Schüler zu bedienen. Eine ähnliche Grundstruktur wird für schulinterne Bibliotheken empfohlen, um eine erfolgreiche Kooperation zu gewährleisten und den Zufall und die Initiative einzelner Personen zu vermeiden.
2. Organisatorische Voraussetzungen und Kooperationsmodelle
Organisatorisch wird die Notwendigkeit einer systematischen Kooperation zwischen Schulen und Bibliotheken betont. Mehrere Bundesländer (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen) haben Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Deutschen Bibliotheksverband und dem Kultusministerium abgeschlossen, um die Kooperation zu institutionalisieren und von zufälligen Initiativen zu lösen. Weitergehende Projekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zielen auf eine systematische Organisation der Kooperation ab. Die Einbindung von Schülern in die Arbeit der Schulbibliothek, nach vorheriger Schulung und Übernahme klar abgegrenzter Aufgaben, wird als förderlich für die Identifikation und die Übernahme von Verantwortung gesehen. Die Notwendigkeit einer Abstimmung mit den Lehrern über die im nächsten Schuljahr behandelten Themen, um Materialien rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, sowie die Teilnahme des Bibliothekspersonals an Planungssitzungen der Schule werden als wichtige Aspekte einer funktionierenden Kooperation hervorgehoben. Die Betrachtung des Lernarrangements, inspiriert durch das EFIL-Projekt, wird als relevant angesehen, wobei die emotional-motivationale Funktion, Lernkontakte zu anderen Personen und konkrete Lernangebote (Unterricht oder Medien) wichtige Aspekte darstellen.
3. Lernarrangements und die Rolle der Bibliothek
Im Kontext von Lernarrangements wird die Bibliothek als Ort gesehen, der verschiedene Funktionen erfüllt: emotionale Motivation durch die Verbindung von Lerninhalten mit den Interessen der Schüler, die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Lernenden und die Bereitstellung konkreter Lernangebote. Das Konzept des Lernarrangements im Bezug auf Bibliotheken greift Erkenntnisse aus dem EFIL-Projekt (Entwicklung und Förderung innovativer Lernarrangements) auf. Die Bibliothek bietet einen Raum für vielfältige Mediennutzung, schafft durch ihre Gestaltung eine einladende Atmosphäre und berücksichtigt sowohl curriculare als auch freizeitorientierte Themen. Die Einbeziehung der Standards für die Vermittlung von Informationskompetenz an der Hochschule dient als Inspiration für die organisatorischen und räumlichen Voraussetzungen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Bibliothek. Auch bei nur teilweiser Erfüllung dieser Voraussetzungen können beachtliche Erfolge erzielt werden. Die Notwendigkeit einer ähnlichen Grundstruktur für schulinterne Bibliotheken wird hervorgehoben, um eine erfolgreiche und nachhaltige Kooperation sicherzustellen.
