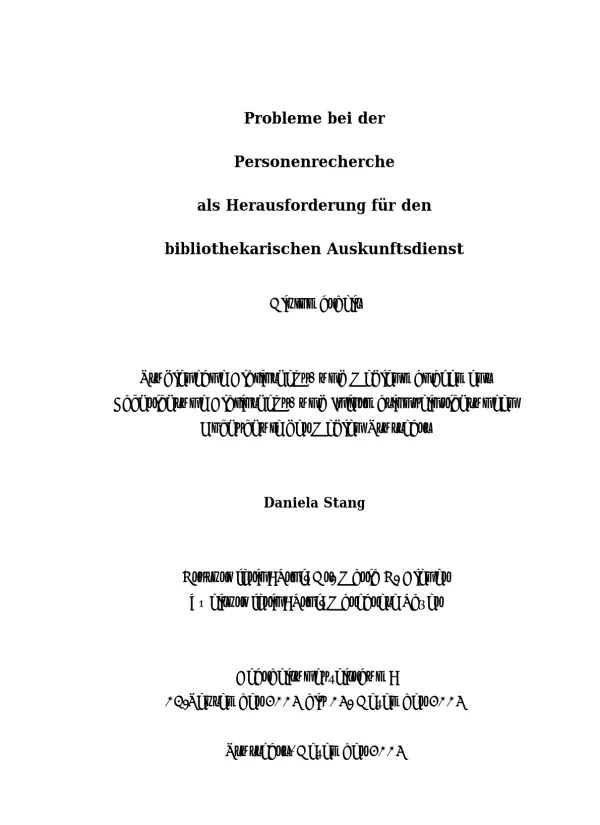
Personenrecherche: Herausforderungen für Bibliotheken
Dokumentinformationen
| Autor | Daniela Stang |
| instructor/editor | Prof. Dr. Maria E. Biener |
| Schule | Hochschule der Medien Stuttgart |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Medienmanagement, Fachrichtung Bibliotheks- und Informationseinrichtungen |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 327.37 KB |
Zusammenfassung
I.Herausforderungen bei der Personenrecherche in Bibliotheken
Die Personenrecherche in Bibliotheken stellt Bibliothekarinnen und Bibliothekare vor diverse Herausforderungen. Die Namensrecherche ist oft komplex, da Namensvarianten, Transkriptionen und Transliterationen je nach Sprache und Kultur stark variieren. Die Ansetzung von Namen in Bibliothekskatalogen weicht mitunter von der gewohnten Schreibweise ab, was die Suche für Benutzer erschwert. Dies betrifft besonders Namen mit Umlauten, Namen in nicht-lateinischen Schriften (z.B. Hebräisch, Arabisch), sowie Namen, die sich im Laufe des Lebens (Heirat, Auswanderung) geändert haben. Ein weiterer Punkt ist die Unzuverlässigkeit von Daten in einigen Quellen, besonders bei historischen Persönlichkeiten oder Personen des Showbusiness, wo falsche oder unvollständige Geburtsdaten häufig vorkommen. Die Suche nach Personen wird durch die unterschiedliche Ordnung in verschiedenen Nachschlagewerken, z.B. nach Rangfolge bei Herrschern oder alphabetisch, zusätzlich erschwert. Die Arbeit illustriert diese Probleme anhand von Beispielen wie der Namensvielfalt bei Georg Friedrich Händel, Osama bin Laden, dem Dalai Lama und anderen Persönlichkeiten. Die Lösung liegt in der geschulten Kompetenz der Auskunftsbibliothekarinnen und in der Verfügbarkeit von umfassenden Ressourcen wie Datenbanken (z.B. WBI, BMI, DDB) und Nachschlagewerken.
1. Namensvarianten und Transkriptionsprobleme
Ein zentrales Problem bei der Personenrecherche ist die Vielzahl an Namensvarianten. Die Schreibweise von Namen variiert stark je nach Sprache und Kultur. Die Transkription von Namen aus nicht-lateinischen Alphabeten (z.B. Arabisch, Hebräisch, Chinesisch) in lateinische Schrift ist oft fehleranfällig und führt zu unterschiedlichen Schreibweisen derselben Person. Beispiele hierfür sind die verschiedenen Schreibweisen von Osama bin Laden (Osama, Usama, Ossama, Ussama) oder die zahlreichen Varianten des Namens Goethe in japanischer Schrift. Auch die Anpassung von Namen bei Auswanderung in andere Länder (z.B. 'Schneider' zu 'Snider') führt zu Schwierigkeiten. Die Transkriptionstabellen des Dudens, die sich an internationalen ISO-Normen orientieren, dienen zwar als Richtlinie, können aber je nach Zielsprache zu Abweichungen führen, wie am Beispiel des Komponisten Tschaikowski illustriert wird (Tchaikovsky, Tsjaikowskij, Csajkovszkij). Die unterschiedlichen Transkriptionsweisen stellen für Benutzer eine große Hürde dar und erschweren die Suche nach der korrekten Namensform im Bibliothekskatalog erheblich. Die Inkonsistenz bei der Transkription hebräischer Namen aufgrund fehlender Vokale im hebräischen Alphabet wird ebenfalls hervorgehoben, mit dem Vorschlag von Herrn Dr. Zwink, digitale Titelbilder zur Klärung beizufügen.
2. Namensänderungen im Laufe des Lebens
Die Namensrecherche wird zusätzlich durch Namensänderungen im Laufe des Lebens erschwert. Viele Kulturen kennen den Brauch, den Namen bei wichtigen Lebensereignissen wie Heirat oder Inthronisation zu wechseln. Frauen, die vor der Heirat bereits unter ihrem Geburtsnamen publiziert haben, sind unter Umständen unter mehreren Namen in Bibliothekskatalogen zu finden, was die Suche erschwert. Beispiele hierfür werden im Text nicht explizit aufgeführt, aber die Problematik wird anhand von hypothetischen Fällen illustriert. Die unterschiedliche Behandlung von Herrschernamen in verschiedenen Ländern (Karl V. / Carlos V.) verdeutlicht die zusätzliche Komplexität, die durch die unterschiedlichen nationalen Konventionen entsteht. Auch der Umgang mit Künstlernamen oder Pseudonymen stellt eine Herausforderung dar, da der reale Name der Person oft unbekannt oder schwer auffindbar ist. Die Autorin erwähnt Willy Brandt (Herbert Ernst Karl Frahm) als Beispiel für eine Person mit unterschiedlichen Namen in verschiedenen Lebensphasen. Das Beispiel von Isabel Allende und ihrer gleichnamigen Cousine unterstreicht die Notwendigkeit eindeutiger Unterscheidungsmerkmale bei der Suche.
3. Ungenaue oder falsche Daten in Quellen
Ein weiteres Problem sind ungenaue oder falsche Daten in den verwendeten Quellen. Besonders bei historischen Persönlichkeiten sind die Geburtsdaten oftmals ungesichert. Der Text nennt Geoffrey Chaucer als Beispiel für eine Person mit unsicherem Geburtsdatum, dessen Lebensdaten in verschiedenen Quellen variieren. Auch im Showbusiness kommt es häufig zu bewussten oder unbewussten Falschangaben zum Geburtsdatum oder zur Karriere, um beispielsweise bessere Rollen zu ergattern. Karl Lagerfeld wird als aktuelles Beispiel genannt, dessen tatsächliches Geburtsdatum lange Zeit umstritten war. Die Problematik wird weiter durch das Beispiel des Schauspielers Yul Brynner veranschaulicht, dessen Herkunft und Geburtsdatum in unterschiedlichen Quellen unterschiedlich dargestellt werden. Benjamin Lebert wird als Beispiel für einen Autor genannt, der sein genaues Geburtsdatum der Öffentlichkeit vorenthält. Friedrich von Gärtner wird als Beispiel für einen Fall genannt, in dem ein lange Zeit als gesichert geltendes Geburtsdatum sich später als falsch herausstellte. Adam von Trott zu Solz wird als Beispiel für einen Fall genannt, in dem ein Schreibfehler in einem Nachschlagewerk zu einem falschen Geburtsdatum geführt hat. Die Unzuverlässigkeit von Daten in Online-Quellen wird ebenfalls angesprochen. Der Text zeigt, dass sich die Recherche von korrekten Daten als herausfordernd gestalten kann und eine kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Quellen unabdingbar ist.
4. Ordnung und Systematik in Bibliothekskatalogen
Die Ordnung und Systematik in Bibliothekskatalogen stellt ebenfalls eine Herausforderung dar. Die unterschiedliche Ordnung von Herrschern in Nachschlagewerken (zuerst nach Rang, dann alphabetisch nach Land) erschwert die Suche. Das Beispiel der englischen Königinnen Elisabeth veranschaulicht diese Problematik. Die Zählung der katholischen Päpste, die durch Gegenpäpste erschwert wird, wird als weiteres Beispiel für eine verwirrende Ordnung genannt. Auch die Ordnung von Komponisten in Nachschlagewerken kann inkonsistent sein, wie am Beispiel von Georg Friedrich Händel in der ADB gezeigt wird, dessen Eintrag erst verspätet im Register nachgetragen wurde. Der Text betont somit, dass die Organisation und die Ordnungssysteme in Printmedien und digitalen Katalogen ein bedeutender Faktor sind, der die Effizienz der Personenrecherche beeinflusst.
II.Methoden und Hilfsmittel zur erfolgreichen Personenrecherche
Erfolgreiche Personenrecherche erfordert den Einsatz verschiedener Methoden und Hilfsmittel. Bibliothekarinnen müssen mit den Regeln der Transkription und Transliteration vertraut sein, insbesondere mit den ALA-LC Romanization Tables für nicht-lateinische Schriften. Die Nutzung von OPACs (Online Public Access Catalogs) und Datenbanken wie der DDB (Deutsche Digitale Bibliothek) ist unerlässlich. Zusätzlich ist die Kenntnis von RAK (Regeln für die alphabetische Katalogisierung) und deren Anwendung wichtig. Die Berücksichtigung von Namensangleichungen in verschiedenen Sprachen und Kulturen ist entscheidend für den Erfolg der Suche. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, verschiedene Schreibweisen und Namensvarianten zu berücksichtigen und auf die Zuverlässigkeit der Quellen zu achten. Das Beispiel der unterschiedlichen Schreibweisen von 'Tchaikovsky' in verschiedenen Sprachen veranschaulicht die Herausforderungen der Namensrecherche.
1. Die Bedeutung von Transkription und Transliteration
Erfolgreiche Personenrecherche erfordert fundierte Kenntnisse in Transkription und Transliteration. Der Text betont die Herausforderungen bei der Übertragung von Namen aus nicht-lateinischen Schriften in das lateinische Alphabet. Die Verwendung der Duden-Transkriptionstabellen, die sich an internationalen ISO-Normen orientieren, wird als gängige Praxis im deutschen Verlagswesen und in den Medien beschrieben. Jedoch werden die bestehenden Abweichungen in der Schreibweise je nach Zielsprache hervorgehoben, was die Eindeutigkeit der Namensfindung erschwert. Das Beispiel des russischen Komponisten Tschaikowski veranschaulicht diese Problematik mit seinen verschiedenen Schreibweisen im Deutschen, Englischen, Holländischen und Ungarischen. Die ALA-LC Romanization Tables werden als Standard für die Transliteration nicht-lateinischer Schriften in US-amerikanischen Bibliotheken erwähnt. Die Komplexität der Transliteration hebräischer Namen aufgrund des Fehlens von Vokalen im hebräischen Alphabet und die damit verbundenen Probleme für Bibliothekarinnen bei der Katalogisierung werden ebenfalls diskutiert. Die unterschiedlichen Ansätze und die Notwendigkeit einer einheitlicheren Vorgehensweise in deutschen Bibliotheken werden thematisiert. Die Verwendung digitaler Titelbilder wird als möglicher Lösungsansatz zur Klärung von Rückfragen bezüglich der originalen hebräischen Schreibweise vorgeschlagen.
2. Nutzung von Bibliothekskatalogen und Datenbanken
Für eine erfolgreiche Personenrecherche sind Bibliothekskataloge und Datenbanken unverzichtbare Hilfsmittel. Der Text betont die Bedeutung von Online Public Access Catalogs (OPACs) für die Suche nach Personen. Die Arbeit unterstreicht, dass die Ansetzung von Namen in Bibliothekskatalogen von der gewohnten Schreibweise in Medien abweichen kann, was zu Schwierigkeiten für den Benutzer führen kann. Die Nutzung von Datenbanken wie WBI (wohl Welt-Biographie-Index), BMI und DDB (Deutsche Digitale Bibliothek) wird als essentiell für die umfassende Recherche beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass biographische Informationen zu bestimmten Personengruppen (z.B. Manager) oft nur versteckt und verstreut in verschiedenen Datenbanken und Nachschlagewerken verfügbar sind. Der „Science Citation Index“ wird als Beispiel für ein Informationsmittel zur quantitativen Bewertung von Wissenschaftlern genannt. Der Text betont die Notwendigkeit, diese Informationsmittel in der Bibliothek bereitzustellen. Die Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK) werden als relevante Richtlinien für die Ansetzung von Namen in Bibliotheken erwähnt. Die Bedeutung von Verweisen auf verschiedene Namensvarianten in den Katalogen wird hervorgehoben, um den Nutzern die Recherche zu erleichtern.
3. Moderne Informationsdienste und Technologien
Der Text beschreibt moderne Entwicklungen im Bibliotheksauskunftsdienst, die die Personenrecherche unterstützen. Der aufkommende Trend des „Digital Reference“ in den USA wird als Beispiel für eine neue Form der Dienstleistung genannt, bei der Auskünfte per E-Mail, Web-Formular oder Live-Chat gegeben werden. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der orts- und zeitunabhängigen Verfügbarkeit der Auskunft. Die Integration von Video Conferencing wird als weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Auskunftsarbeit erwähnt, um ein persönlicheres und umfassenderes Beratungsgespräch zu ermöglichen. Die Nützlichkeit dieser neuen Services wird an der Kundenzufriedenheit und der Effizienz der Auskünfte gemessen. Der Text impliziert, dass die Implementierung solcher Technologien die Effizienz und die Benutzerfreundlichkeit der Personenrecherche in Bibliotheken steigern kann, und strebt an, diese neuen Formen der Auskunft mit den etablierten Methoden vergleichbar zu machen.
III.Moderne Entwicklungen im Bibliotheksauskunftsdienst
Der Bibliotheksauskunftsdienst entwickelt sich weiter, um den veränderten Informationsbedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Neue Technologien wie Digital Reference (Auskünfte per E-Mail, Web-Formular oder Live-Chat) ermöglichen einen orts- und zeitunabhängigen Zugang zur Bibliotheksauskunft. Video Conferencing wird erprobt, um die Beratung zu verbessern und zu personalisieren. Diese modernen Ansätze zielen darauf ab, die Personenrecherche effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten und den Bedürfnissen der Nutzer bestmöglich zu entsprechen.
1. Digital Reference Neue Wege der Bibliotheksauskunft
Der Text beschreibt die Entwicklung des "Digital Reference" als moderne Form des Bibliotheksauskunftsdienstes, insbesondere in den USA. Dieser Service ermöglicht es Nutzern, Anfragen per E-Mail, Web-Formular oder Live-Chat zu stellen, unabhängig von Ort und Zeit. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber den traditionellen, zeit- und ortsgebundenen Auskunftssystemen dar. Der Vorteil liegt in der erhöhten Flexibilität für den Nutzer, der seine Fragen jederzeit stellen kann. Allerdings wird auch ein Nachteil angedeutet: Im Gegensatz zum persönlichen Gespräch fehlt der direkte Austausch und die Möglichkeit, nonverbale Kommunikation im Auskunftsgespräch zu berücksichtigen. Diese Methode wird als ein vielversprechender Ansatz beschrieben, der die traditionellen Methoden der Bibliotheksauskunft ergänzen kann. Die Autorin hebt die zunehmende Bedeutung digitaler Kommunikationskanäle für den Bibliotheksauskunftsdienst hervor und unterstreicht den Bedarf an flexibleren und zeitunabhängigen Services, um den veränderten Bedürfnissen der Nutzer zu entsprechen. Der Text fokussiert auf die Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen dieses innovativen Ansatzes für den Bibliotheksauskunftsdienst.
2. Video Conferencing Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten
Als weitere moderne Entwicklung im Bibliotheksauskunftsdienst wird Video Conferencing erwähnt. Diese Technologie befindet sich zum Zeitpunkt des Textes noch in der Testphase, ihre Potenziale sollen jedoch ausgelotet werden. Der Text beschreibt Video Conferencing als ein Mittel, um die Auskunftsarbeit zu verbessern und zu erweitern. Es wird erwartet, dass Video Conferencing nicht nur für die direkte Auskunftserteilung, sondern auch für Schulungen und Meetings eingesetzt werden kann. Das Ziel besteht darin, die Auskunftsarbeit per Internet-Video so zu optimieren, dass sie mit den herkömmlichen Formen der Auskunft vergleichbar wird. Die Bewertung der Nützlichkeit dieses Services soll anhand der Kundenzufriedenheit und der Effektivität der Informationsvermittlung erfolgen. Die Autorin zeigt sich offen für neue Technologien und ihre Anwendung im Bibliothekswesen, um die Qualität und den Zugang zur Information für die Nutzer zu verbessern. Die Vorteile liegen insbesondere in der verbesserten Kommunikation durch nonverbale Elemente und der Möglichkeit zur Visualisierung von Informationen, die das Verständnis erleichtern.
