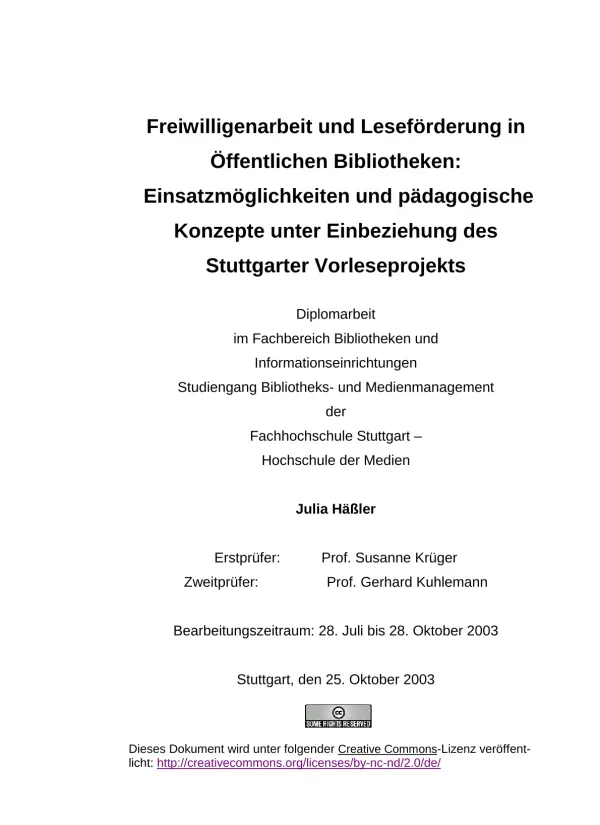
Freiwillige in Bibliotheken: Leseförderung
Dokumentinformationen
| Autor | Julia Häßler |
| school/university | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| subject/major | Bibliotheks- und Medienmanagement |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| city_where_the_document_was_published | Stuttgart |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 470.72 KB |
Zusammenfassung
I.Begrifflichkeiten des Ehrenamts und der Freiwilligenarbeit
Der Text beleuchtet die unterschiedlichen Begrifflichkeiten rund um das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit in Deutschland. Es wird zwischen dem traditionellen Ehrenamt, mit seiner Orientierung an formalen Strukturen, und dem „neuen Ehrenamt“, stärker geprägt von individuellen Interessen und Selbstverwirklichung, unterschieden. Weitere verwandte Begriffe wie Bürgerarbeit, Selbsthilfe und Eigenarbeit werden diskutiert, wobei die Grenzen zwischen diesen Begriffen fließend sind. Der Text verweist auf die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements als übergeordneten Begriff, der gesellschaftliche Verantwortung betont. Die angloamerikanische Tradition des „volunteering“ wird als Vergleich herangezogen.
1. Das traditionelle und das neue Ehrenamt
Der Text unterscheidet zwischen dem traditionellen Ehrenamt, charakterisiert durch Orientierung an etablierten Strukturen und öffentlichen Ämtern, und dem 'neuen Ehrenamt'. Bernd Wagner beschreibt diese Entwicklung als Hinzufügen einer weiteren Dimension. Das 'neue Ehrenamt', laut Wagner, fokussiert stärker auf persönliche Interessen, Bedürfnisse und Selbstverwirklichung. Thomas Strittmatter ergänzt, dass die Strukturen beim 'neuen Ehrenamt' weniger festgelegt sind, und die Freiwilligen selbst über Art und Dauer ihres Engagements entscheiden. Diese Form der Freiwilligenarbeit lehnt sich an das angloamerikanische 'volunteering' an. Christina Stecker kritisiert jedoch die implizite Annahme, dass nur diese Art von Arbeit freiwillig sei, im Gegensatz zu beispielsweise Erwerbsarbeit.
2. Verwandte Begriffe und ihre Abgrenzung
Neben Ehrenamt und Freiwilligenarbeit werden weitere verwandte Begriffe wie 'Eigenarbeit' (eine Zwischenform zwischen Ehrenamt und Erwerbsarbeit), 'Selbsthilfe' (vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich) und 'Bürgerarbeit' genannt. Der Text betont die fließenden Übergänge und die teilweise überschneidenden Bedeutungen dieser Begriffe. Eine klare Abgrenzung ist schwierig, da sie sich gegenseitig ergänzen oder ersetzen können. Der Text schlägt als Ansatz zur Einordnung folgende Schwerpunkte vor: Beim Ehrenamt die Orientierung an traditionellen und formalen Strukturen und öffentlichen Ämtern; bei der Freiwilligenarbeit das Zusammenspiel von 'Gutes tun für andere – Gutes tun für mich'; und beim bürgerschaftlichen Engagement die übergeordnete Perspektive mit Fokus auf gesellschaftliche Verantwortung.
3. Der DBV und das Verständnis von Freiwilligenarbeit
Das Positionspapier des Deutschen Bibliotheksverbands (DBV) 'Freiwillige – (k)eine Chance für Bibliotheken?' verwendet die Begriffe 'Freiwillige' und 'Freiwilligenarbeit'. Der DBV orientiert sich dabei an dem angloamerikanischen und niederländischen Verständnis von 'Volunteers'. Im Gegensatz zum Ehrenamt gibt es in diesen Ländern eine lange Tradition des freiwilligen Engagements ohne arbeitsrechtliche Schwierigkeiten oder Konkurrenz zum Hauptamt. Auslagenersatzansprüche bestehen nicht. Der DBV definiert Freiwilligenarbeit als 'ein freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement und eine vor diesem Hintergrund übernommene Tätigkeit ohne Zahlung eines Entgelts'. Diese Definition wird später kritisch diskutiert.
II.Freiwilligenarbeit in Bibliotheken Chancen und Herausforderungen
Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) diskutiert in einem Positionspapier den Einsatz von Freiwilligen in Bibliotheken. Dabei werden sowohl Chancen (z.B. Unterstützung in Bereichen mit allgemeinen kommunikativen Kompetenzen) als auch Risiken (z.B. Instrumentalisierung aufgrund knapper öffentlicher Mittel, Gefahr der Gefährdung von Arbeitsqualität und Arbeitsplätzen) hervorgehoben. Der DBV betont die Notwendigkeit hauptamtlicher Betreuung für Freiwillige. Kritiker bemängeln die fehlende Abgrenzung der Aufgaben zwischen hauptamtlichen Fachkräften und Freiwilligen in Bibliotheken und die potenzielle Gefährdung der öffentlichen Aufgabe von Bibliotheken.
1. Der DBV und der Einsatz von Freiwilligen in Bibliotheken
Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) befasst sich in seinem Positionspapier "Freiwillige – (k)eine Chance für Bibliotheken?" mit der Frage des Einsatzes von Freiwilligen in Bibliotheken. Er stellt fest, dass die Arbeitsabläufe in Bibliotheken oft hochspezialisiert und komplex sind und umfassendes bibliothekarisches und betriebswirtschaftliches Wissen erfordern. Daher sieht der DBV Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige vor allem in Bereichen, die allgemeine kommunikative oder soziale Kompetenzen erfordern, oder in denen Freiwillige besondere Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen können. Die Angaben des DBV orientieren sich an dem angloamerikanischen und niederländischen Modell des "volunteering", das eine lange Tradition aufweist und im arbeitsrechtlichen Bereich keine größeren Schwierigkeiten aufwirft. Im Gegensatz zum Ehrenamt entstehen hier keine Ansprüche auf Auslagenersatz.
2. Risiken und Kritikpunkte des Freiwilligeneinsatzes
Neben den Chancen des Freiwilligeneinsatzes warnt der DBV vor Risiken. Die Gefahr der Instrumentalisierung wird angesprochen, besonders im Kontext von Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor. Beispielsweise erwähnt der Göppinger Oberbürgermeister Reinhard Frank die Streichung freiwilliger Leistungen, darunter auch Stadtbibliotheken, als mögliche Einsparmassnahme. Der DBV betont die Notwendigkeit hauptamtlicher Betreuung und Ansprechpartner für Freiwillige, um Arbeitsqualität und Arbeitsplätze zu sichern und kommunale Kostenabwälzung zu vermeiden. Günter Pflaum, Leiter der Staatlichen Büchereistelle in Neustadt, kritisiert das DBV-Positionspapier als berufs- und bibliothekspolitisches Eigentor. Er bemängelt die fehlende Abgrenzung der Einsatzbereiche von Freiwilligen je nach Bibliotheksfunktion und -grösse sowie die fehlende Abgrenzung der Aufgaben von ausgebildeten Fachkräften und Freiwilligen. Die Gefahr, dass durch die Schaffung von Trägervereinen für Stadtteilbibliotheken die öffentliche Hand ihre Aufgabe entzogen bekommt, wird ebenfalls kritisiert.
3. Haftungs und Versicherungsfragen
Die Frage der Haftung und Versicherung von Freiwilligen wird im Text angesprochen. Die Haftpflicht-Fachinformation des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft besagt, dass eine Privatperson während der Ausübung eines Ehrenamts im engen Sinne nicht durch die gesetzliche Haftpflicht geschützt ist. Für Freiwilligenarbeit im weiteren Sinne besteht hingegen Versicherungsschutz, außer es handelt sich um eine "verantwortliche Betätigung" mit Überwachungspflicht. Die Grenzen der Verantwortlichkeiten sind jedoch, ähnlich wie die Definitionen von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit, unklar. Ein Beispiel hierfür ist die Frage, wie weit die Verantwortung einer Erzieherin während einer Vorlesestunde im Kindergarten auf eine freiwillige Vorleserin übergeht, besonders wenn diese allein mit den Kindern in einem anderen Raum ist.
III.Bürgerliches Engagement und Leseförderung in Stuttgart
Die Stadt Stuttgart setzt stark auf bürgerschaftliches Engagement in der Leseförderung. Das Bürgermeisteramt verfügt über Stabstellen für bürgerschaftliches Engagement und die Lokale Agenda Stuttgart. Die Bürgerstiftung Stuttgart trägt die frEE-Akademie, die Weiterbildungen im Bereich freiwilliges Engagement, Ehrenamt und Selbsthilfe anbietet. Das Stuttgarter Vorleseprojekt, gestartet 2002, mit ca. 70 initialen Lesepaten, kooperiert mit Schulen, Kindergärten (z.B. Vogelsangschule und Stöckachkindergarten), der Stadtbücherei Stuttgart und dem Literaturhaus Stuttgart. Das Projekt zielt auf die Verbesserung der Lesekompetenz bei Kindern, insbesondere derer, die keinen Zugang zur Leseförderung über das Elternhaus erhalten.
1. Stuttgarts Engagement für bürgerschaftliches Engagement und Leseförderung
Stuttgart zeigt ein starkes Engagement im Bereich bürgerschaftliches Engagement, insbesondere in der Leseförderung. Das Bürgermeisteramt unterhält eine Stabsstelle Förderung Bürgerschaftliches Engagement und eine Stabsstelle Lokale Agenda Stuttgart. Zusätzlich ist jeder städtische Amt mit einem Ehrenamtsbeauftragten besetzt. Die 2001 gegründete Bürgerstiftung Stuttgart trägt die frEE-Akademie, die Weiterbildungen zu Themen wie Freiwilligenarbeit, Ehrenamt, Selbsthilfe, Vereinsmanagement, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und EDV anbietet. Die Bürgerstiftung lobt zudem den Stuttgarter Bürgerpreis aus, um vorbildliche bürgerschaftliche Aktivitäten auszuzeichnen. Diese Strukturen unterstreichen das städtische Bemühen um die Förderung von ehrenamtlichem und freiwilligem Engagement in verschiedenen Bereichen, inklusive der Leseförderung.
2. Die Stadtbücherei Stuttgart und ihre Rolle in der Leseförderung
Die Stuttgarter Stadtbücherei nimmt eine zentrale Rolle in der kommunalen Kultur- und Bildungsarbeit ein. Die 16 Kinderbüchereien und zwei mobile Bücherbusse bieten einen umfangreichen Bestand an Kinderliteratur und -medien kostenlos an. Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, von dem mehr als 70% der Aktionen an pädagogische Institutionen gerichtet sind, um auch Kinder zu erreichen, die nicht über das Elternhaus den Weg in die Bibliothek finden, ergänzt das Angebot. Veranstaltungen für Kinder sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Aufgaben einer Kinderbibliothek, da sie der Leseförderung und der Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit Medien dienen. Die Stadtbücherei ist somit ein wichtiger Akteur in der lokalen Leseförderung.
3. Das Literaturhaus Stuttgart und seine Kooperation
Das Literaturhaus Stuttgart kooperiert mit zahlreichen Kultureinrichtungen der Stadt und engagiert sich in der Nachwuchsförderung. Es bietet bereits Schreibwerkstätten für Jugendliche an und beteiligte sich an der Pilotphase des Stuttgarter Vorleseprojekts. Das Literaturhaus stellt Räumlichkeiten, Personal und Know-how zur Verfügung, um den Grundstein für eine Stuttgarter Vorlesekultur zu legen und bestehende Angebote zu vernetzen. Durch die Kooperation mit anderen Institutionen trägt das Literaturhaus zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Leseförderung in Stuttgart bei und zeigt sich als ein wichtiger Partner im kulturellen und bildungspolitischen Kontext der Stadt.
IV.Das Stuttgarter Vorleseprojekt Auswertung und Ergebnisse
Das Stuttgarter Vorleseprojekt zeigt, wie freiwillige Vorlesepaten, nach entsprechender Schulung durch die Stiftung Lesen, in Kindergärten und Stadtteilbibliotheken zum Einsatz kommen. Die Auswertung der Pilotphase betont die positive Resonanz bei Eltern und Kindern. Herausforderungen bestehen in der Erreichbarkeit von nicht-lesenden Familien und dem Bedarf an weiterer Schulung der Lesepaten hinsichtlich Vorlesetechnik und Umgang mit schwierigen Situationen. Die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen wird als bereichernd empfunden. Der Fokus liegt auf der frühkindlichen Leseförderung.
1. Das Stuttgarter Vorleseprojekt Konzept und Zielgruppen
Das Stuttgarter Vorleseprojekt, gestartet im Jahr 2002, setzt sich zum Ziel, die Leseförderung bei Kindern zu verbessern, insbesondere bei Kindern, deren Leseinteresse nicht durch das Elternhaus gefördert wird. Schulen und Kindergärten wurden als wichtige Partner in die Pilotphase einbezogen. Konkret kooperierten Lehrerinnen, Eltern und Kinder der 2. Klasse der Vogelsangschule (ca. 80 Kinder) und des Stöckachkindergartens (ca. 60 Kinder). Zusätzlich gab es öffentlich zugängliche Veranstaltungen. Ein wichtiger Bestandteil des Projektes war die Rekrutierung und Schulung von freiwilligen Vorlesepaten, die in Stadtteilbibliotheken und Kindertagesstätten zum Einsatz kommen sollten. Elternabende wurden besucht, um das Projekt vorzustellen und die Familien einzubinden. Die positive Resonanz auf die persönlichen Besuche und die angebotenen Vorlesetipps unterstreicht die Sensibilisierung für das Thema Vorlesen.
2. Durchführung und angebotene Hilfestellungen
Das Projekt bot verschiedene Angebote, darunter Vorleseveranstaltungen, Lesepartys und Bilderbuchshows. Um die Auswahl geeigneter Literatur zu erleichtern, wurden Vorleselister erstellt, die eine Auswahl an Büchern mit kurzen Anmerkungen und Altersangaben enthielten. Die Lesepartys waren ein besonderes Highlight und wurden in fünf thematisch gestalteten Lesezelten durchgeführt. Die Familien rotierten zwischen den Zelten und nahmen an verschiedenen Vorlesungen und Erzählungen teil. Eine Autorenlesung und die Aktion des 'Bücherwurms', in den Kinder gelesene Bücher eintragen konnten, rundeten das Programm ab. Neben den Veranstaltungen für Gruppen wurden gezielte Angebote für Vorschulkinder im Kindergarten entwickelt.
3. Ergebnisse und Auswertung des Projekts
Die Auswertung des Projekts zeigt eine positive Resonanz bei den teilnehmenden Familien. Knapp 50% der Familien der Vogelsangschule beteiligten sich an der Befragung, wobei 28 Familien die Angebote nutzten. Zeitmangel und Terminschwierigkeiten wurden als Hauptgründe für die Nichtteilnahme genannt. Die Eltern schätzten vor allem die Informationsvermittlung über Bücher und Lesen, neue Eindrücke und phantasievolle Anregungen. Die Lesepartys wurden als besonderes Erlebnis empfunden. Bei den Kindern war die Begeisterung groß; 20% wünschten sich mehr Vorlesen zu Hause. Lehrerinnen berichteten von einer größeren Beteiligung als erwartet, jedoch gelang es nur bedingt, nicht-lesende Familien zu erreichen. Es wurde festgestellt, dass die Leseförderung nur ein Aspekt der erzieherischen Arbeit sein kann. Die individuelle Förderung sprachunsicherer Kinder benötigte mehr intensive Betreuung und direkte Kontakte, was den Einsatz von freiwilligen Vorlesepaten als Ergänzung wertvoll erscheinen lässt.
4. Freiwillige Vorlesepaten Schulung und Einsatz
Ein wichtiger Aspekt des Projekts war die Einbindung von freiwilligen Vorlesepaten. Nach einem Aufruf meldeten sich ca. 70 interessierte Personen. 54 Paten wurden in 21 Kindertagesstätten und 16 Stuttgarter Stadtteilbüchereien eingesetzt, nach dreitägigen Schulungen in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen. Die Schulungen vermittelten Hintergrundwissen, Vorlesetechnik, Umgang mit Konflikten und pädagogisches Grundwissen. Die Vorlesepaten arbeiten eng mit den Mitarbeiterinnen der Kinderbüchereien zusammen und bereichern das bestehende Veranstaltungsprogramm. Die Auswertung zeigt, dass die Vorbereitung gut war, jedoch weiterer Bedarf an Schulungen und Tipps besteht. Die Zusammenarbeit zwischen Patinnen und Einrichtungen wurde als positiv und bereichernd empfunden. Die Patinnen übernehmen eine wichtige soziale Funktion und stellen für leseungewohnte Kinder einen Bezug zum Buch her. Herausforderungen bestehen weiterhin in den unterschiedlichen Vorlesesituationen und dem Bedarf an intensiverer Betreuung einzelner Kinder.
V.Weitere Initiativen zur Leseförderung in Deutschland
Der Text erwähnt weitere bundesweite Initiativen zur Leseförderung, wie z.B. den Verein Lesewelt in Berlin (inspiriert durch das US-amerikanische Programm „Read Together“), und die bundesweite Kampagne „Deutschland liest vor“, unterstützt von der Körber-Stiftung und der Stiftung Lesen. Die Stiftung Lesen fördert ebenfalls die Schulung von Vorlesepaten und die Etablierung von Vorlesenetzwerken auf lokaler und regionaler Ebene. Der Text betont die Wichtigkeit der frühkindlichen Leseförderung.
1. Lesewelt Ein Berliner Modell für Leseförderung
Der Verein Lesewelt in Berlin, gegründet im Juni 2000, dient als Beispiel für eine erfolgreiche Leseförderungsinitiative. Inspiriert wurde er vom Programm "Read Together" der Initiative "Beginning with Books" aus Pittsburgh, Pennsylvania. Die Berliner Sozialarbeiterin Carmen Stürzel gewann 1999 mit diesem Konzept den Transatlantischen Ideenwettbewerb "USable" der Körber-Stiftung. Mit Unterstützung der Körber-Stiftung und weiteren Stiftungen sowie dem Kulturamt Berlin-Mitte konnte Lesewelt aufgebaut werden. Seit 2001 gibt es eine hauptamtliche Projektleitung (Carmen Stürzel), Fortbildungen und Büroräume. Der Verein präsentiert sich öffentlich mit einer Website (www.lesewelt.org) und einem Leitfaden für Vorleseprojekte ("Abenteuer Vorlesen"), ebenfalls mit Unterstützung der Körber-Stiftung.
2. Die Kampagne Deutschland liest vor
Die Kampagne "Deutschland liest vor" wurde ebenfalls von der Hamburger Körber-Stiftung angestoßen und orientiert sich am Modell von Lesewelt. Die Stiftung möchte dieses Konzept bundesweit verbreiten. Mittlerweile wird die Kampagne vom gemeinnützigen Trägerverein "Deutschland liest vor" organisiert. Schirmherrin ist Doris Schröder-Köpf. Ein Freundeskreis wirbt öffentlich für neue Initiativen. Kooperationspartner, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, und Sponsoren unterstützen die Kampagne. Die ehrenamtliche Geschäftsführung liegt weiterhin bei Carmen Stürzel in Berlin. Die Kampagne zielt darauf ab, einen Beitrag zur Alltagskultur der Demokratie zu leisten und das Vorlesen als wichtigen Bestandteil der Leseförderung zu fördern.
3. Die Stiftung Lesen und das Projekt Vorlesepaten
Die Stiftung Lesen bietet ein vielfältiges Angebot zur frühkindlichen Leseförderung an, darunter auch das Projekt Vorlesepaten. Dieses Projekt hat zum Ziel, freiwillige Vorleser zu motivieren und zu schulen sowie Multiplikatoren zu gewinnen, um Vorlesenetzwerke auf städtischer oder regionaler Ebene zu knüpfen. Die Stiftung möchte Freude an Büchern vermitteln, die Sprachentwicklung von Kindern fördern und generationenübergreifende Kontakte herstellen. Die Deutsche Bahn AG und Mitsubishi Motors Deutschland unterstützen das Projekt als Partner. Die Schulung der Vorlesepaten umfasst ein ganzheitliches Verständnis des Vorlesens, die Berücksichtigung körperlicher und psychischer Aspekte, sowie den Umgang mit Problemen und Konflikten in Vorlesesituationen. Das Ziel ist die kreative und kompetente Gestaltung der Vorlesestunden.
