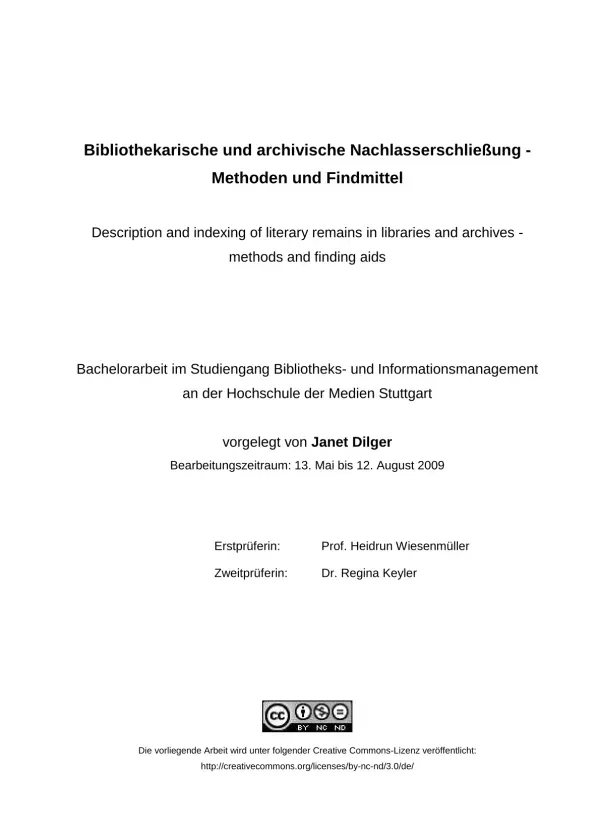
Nachlasserschließung: Methoden & Findmittel
Dokumentinformationen
| Autor | Janet Dilger |
| Schule | Hochschule der Medien Stuttgart |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Informationsmanagement |
| Dokumenttyp | Bachelorarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.31 MB |
Zusammenfassung
I. Bibliotheken
Der Text analysiert die unterschiedlichen Ansätze von Archiven und Bibliotheken bei der Erschließung von Nachlässen. Während Bibliotheken traditionell die Einzeldokumente im Fokus haben und oft auf die Rolle des Nachlassers als Autor achten, konzentrieren sich Archive auf die Verzeichnung ganzer Konvolute und das Provenienzprinzip. Historisch gesehen führten unterschiedliche Regelwerke und die fehlende Kooperation zu Konflikten bezüglich der Katalogisierung und der Abgrenzung von Archivgut und Bibliotheksgut. Schlüsselpersonen wie Harnack, Schreiber, Milkaus, Striedinger, Wenig und Stolzenberg werden in diesem Zusammenhang genannt, ihre Ansichten zur Nachlassverzeichnung und -aufbewahrung spiegeln die historischen Debatten wider.
1. Unterschiedliche Ansätze in der Nachlasserschließung Archive vs. Bibliotheken
Der zentrale Konfliktpunkt liegt in den unterschiedlichen Herangehensweisen von Archiven und Bibliotheken an die Erschließung von Nachlässen. Bibliotheken fokussieren sich traditionell auf die Beschreibung einzelner Dokumente, wobei die Rolle des Nachlassers als Autor im Vordergrund steht. Dies spiegelt sich in der detaillierten Katalogisierung einzelner Briefe, Manuskripte oder Werke wider. Im Gegensatz dazu bevorzugen Archive die Verzeichnung ganzer Konvolute, also zusammenhängender Bestände. Das Provenienzprinzip, die Erhaltung der ursprünglichen Ordnung und des Zusammenhangs der Überlieferung, steht hier im Mittelpunkt. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte führen zu divergierenden Methoden der Katalogisierung und der Verzeichnung, was zu einer erheblichen terminologischen und methodischen Diskrepanz zwischen den beiden Institutionen führt. Die Frage nach der optimalen Aufbewahrung und Zugänglichkeit von Nachlässen wird dadurch zusätzlich erschwert.
2. Historische Entwicklung und frühe Debatten zur Nachlasserschließung
Nach dem Zweiten Weltkrieg äußerte sich Harnack als erster Bibliothekar grundlegend zur Bedeutung, Verzeichnung und Verwertung handschriftlicher Nachlässe von Politikern und Gelehrten. Seine Erfahrungen mit der Ordnung des väterlichen Nachlasses flossen in seine Forderung ein, Nachlässe an regionale Einrichtungen mit bereits vorhandenen Beständen zu geben. Bereits 1935 forderte der Bibliothekar Schreiber ein Inventar aller verfügbaren Handschriften, inklusive Nachlässe, und plädierte für verbindliche Katalogisierungsregeln, insbesondere für neuere Handschriften. Die damalige Praxis orientierte sich an Antiquariatskatalogen, wo die Erfahrung größer war. Gleichzeitig kritisierte Milkaus die Ablehnung von Harnacks Vorschlag, junge Wissenschaftler zur Bearbeitung von Nachlässen einzusetzen. Diese frühen Debatten belegen die Herausforderungen, die sich schon vor der Entwicklung umfassender Regelwerke und digitaler Möglichkeiten stellten; der Mangel an einheitlichen Standards und die fehlende Koordination zwischen Bibliotheken und Archiven erschwerten die systematische Erfassung und Bereitstellung dieser wichtigen Quellen.
3. Konflikte um Archiv und Bibliotheksgut und die Rolle der Archivverordnung
Der Text beleuchtet den Unterschied zwischen Bibliotheksgut (massenhaft produzierte Medien für Bildung und Unterhaltung) und Archivgut. Wissenschaftliche Bibliotheken hingegen sammeln neben gedrucktem Schrifttum auch audiovisuelle und elektronische Medien, wobei ihre Sammeltätigkeit im Gegensatz zu Archiven nicht auf bestimmte Zuständigkeiten beschränkt ist (Ausnahme: Pflichtexemplarrecht). Für Nachlässe gilt jedoch weder das Pflichtexemplarrecht noch die archivische Ablieferungspflicht. Striedinger entwickelte eine Zwecktheorie, wonach ein Nachlass je nach seinem Schwerpunkt (rechtlich oder literarisch) einheitlich in einer Sammelstelle verwahrt werden sollte. Wenig bestätigte 1954 die Bedeutung dieser Theorie. Die Archivverordnung der DDR von 1965 machte Nachlässe zwar zum Bestandteil des staatlichen Archivfonds, doch eine Übergabe von Bibliotheken an Archive fand nicht statt, aufgrund der Bewahrungs- und Erschließungsfunktion der Bibliotheken und bestehender Verträge. Stolzenberg betonte 1987 die Wichtigkeit eines festen Standorts für einen einmal geordneten und verzeichneten Nachlass, um dessen Eingehen in die Literatur und entsprechende Zitierfähigkeit zu sichern. Die unterschiedlichen Auffassungen über die Zuständigkeit für Nachlässe, die hier deutlich werden, zeigen den Konflikt zwischen archivischer und bibliothekarischer Praxis.
4. Kritik an der Archivguttheorie und unterschiedliche Erschließungstiefen
Die stark erweiterte Archivguttheorie stieß auf Kritik von Bibliotheksseite, die den literarischen Endzweck als Begründung für ihre Theorie anführten. Auch von archivischer Seite gab es Kritik; Papritz argumentierte, dass allein die Tatsache, dass es sich um Schriftgut handelt, Nachlässe nicht automatisch zu potentiellem Archivgut macht. Die Forderung nach einer archivischen Erschließung, die Bibliotheksstandards entsprechen soll, verdeutlicht den Konflikt. Der Vorwurf an Archivare, Nachlasser als verhinderte Behörden zu betrachten, rührt von der Praxis der Pflichtablieferung amtlichen Schriftguts her. Treffeisen betonte die Verbindung der Archivalieneinheit zum Registraturbildner (Nachlasser), was Bibliotheken als Begründung ihrer Methoden verwenden. Archive hingegen betonen den Zusammenhang mit anderen Archivalien gleicher Provenienz, der traditionell im Findbuch vermittelt wird. Die unterschiedlichen Erschließungstiefen, die sowohl von Bibliotheken als auch Archiven angewandt werden – je nach Rang des Nachlassers – zeigen eine Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse, verdeutlichen aber die anhaltende Problematik.
II.Konzepte der Nachlassgliederung und Erschließung
Der Text beschreibt verschiedene Ansätze zur Gliederung von Nachlässen, von der starren, vorgegebenen Ordnung bis hin zu flexibleren Methoden, die die bestehende Ordnung des Bestandes berücksichtigen (Höötmann, Klauß). Die Erschließung umfasst die Beschreibung der Überlieferungsgeschichte, biographische Angaben zum Nachlasser, Angaben zur Laufzeit der Verzeichnungseinheiten, die Materialart (Werk, Korrespondenz, Lebensdokument, Sammlung/Objekt) und die Signaturvergabe. Dabei werden sowohl archivische als auch bibliothekarische Methoden beleuchtet, inklusive der Diskussion um die Verwendung von Normdateien wie PND und GKD für die Personennamenansetzung.
1. Methoden der Nachlassgliederung Von starren zu flexiblen Modellen
Die Gliederung von Nachlässen wird im Text als wichtiger Aspekt der Erschließung behandelt. Es werden unterschiedliche Ansätze beschrieben, angefangen von starren, vorgegebenen Ordnungsschemata bis hin zu flexibleren Modellen. Königs Vorschlag aus dem Jahr 1992, der eine strenge, administrative Vorgehensweise mit Erfassungsformularen, Inventarnummern und Katalogkarten vorsah, wird als nicht mehr zeitgemäß bewertet, insbesondere im Hinblick auf die Effizienzsteigerung durch die EDV. Im Gegensatz dazu wird der Ansatz von Höötmann (2004) hervorgehoben, der trotz der Individualität von Nachlässen die Möglichkeit einer überschaubaren Ordnung sieht, die sich an der gegebenen Ordnung des Bestandes orientiert und im Laufe der Bearbeitung angepasst werden kann. Klauß (1993) liefert dazu praktische Beispiele für eine flexible Gliederung, basierend auf den Arbeiten am Nachlass von Hermann Schumacher. Die Autorin plädiert für eine Anpassung des Gliederungsschemas an den vorhandenen Bestand und nur bei fehlender Überlieferungsordnung für eine Neugliederung nach anderen Gesichtspunkten. Die Diskussion um die optimale Gliederungsmethode verdeutlicht die Notwendigkeit einer pragmatischen und an den jeweiligen Nachlass angepassten Vorgehensweise.
2. Archivische und bibliothekarische Perspektiven auf die Nachlassgliederung
Die unterschiedlichen Perspektiven von Archivaren und Bibliothekaren auf die Gliederung von Nachlässen werden deutlich. Während Bibliothekare traditionell ein stärkeres Interesse an der Einzeldokumentbeschreibung hatten, ist bei Archivaren die Verzeichnung ganzer Konvolute üblicher. Diese unterschiedlichen Praktiken haben sich im Laufe der Zeit zwar teilweise angeglichen, es gibt aber weiterhin Unterschiede in den Erschließungstiefen, abhängig vom Rang des Nachlassers. Bibliotheken verwenden über einzelne Findbücher hinausgehende Nachweisinstrumente, um jeden Nachlassteil gleich intensiv zu erfassen. Archive hingegen verwenden traditionell bestandsgebundene Findbücher, die einen einzelnen Nachlass beschreiben und die Funktion eines Lagerbuches übernehmen. Die Diskussion um die optimale Struktur von Online-Findbüchern und die Frage, ob die starre Struktur zugunsten einer vom Kunden beeinflussbaren Ordnung aufgegeben werden sollte, verdeutlicht die anhaltende Auseinandersetzung um effiziente und nutzerfreundliche Methoden der Nachlasserschließung.
3. Erschließungselemente und Standardisierung Einleitung Datierung und Materialart
Der Text beschreibt wichtige Elemente der Nachlasserschließung. Die Einleitung eines archivischen Findbuchs, genormt nach ISAD(G), soll umfassende Informationen zum Inhalt, zur Überlieferungsgeschichte und zur Bearbeitung des Nachlasses liefern, inklusive biographischer Notizen zum Nachlasser, Angaben zu Bewertung, Kassation und Ordnungskriterien, Nutzungsbedingungen und Erhaltungszustand. Die Datierung von Verzeichnungseinheiten erfolgt oft als Laufzeit, angelehnt an die Verzeichnung von Akten, wobei der Zeitraum durch das älteste und jüngste Stück bestimmt wird. Für Einzelstücke reicht eine einzelne Datumsangabe. Die Regeln für die Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA) schreiben die Angabe der Materialart (Werk, Korrespondenz, Lebensdokument, Sammlung/Objekt) für jede Verzeichnungseinheit vor, um gezielte Recherchen zu ermöglichen. Die Erfassung des Medientyps ist ebenfalls vorgesehen, falls das Material nicht in konventioneller Papierform vorliegt. Diese Standardisierung zielt auf eine verbesserte Auffindbarkeit und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Institutionen.
4. Signaturenvergabe historische Praktiken und Magazinaufstellung
Die Vergabe von Signaturen für Nachlässe wird thematisiert. Ein Dezimalsystem, das die Gliederungsschemata abbildet, bietet den Vorteil flexibler Ergänzungen. Moisy bevorzugt eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Eine reine Durchnummerierung oder Zählung nach Behältnissen wird als weniger praktikabel angesehen. Der Text verweist auf historische Praktiken, wie das Binden von Nachlassteilen als Codex oder die Auflösung von Briefnachlässen zugunsten von Autographensammlungen im 19. Jahrhundert. Die strikte Einhaltung des Provenienzprinzips sei lange Zeit nicht üblich gewesen. Die Frage nach der zwingenden alphabetischen Aufstellung im Magazin, basierend auf dem Namen des Nachlassers, wird hinterfragt; die Autorin schlägt eine flexible Lagerung bei gutem Lageplan und Kennzeichnung der Regale vor. Diese Aspekte unterstreichen die Herausforderungen, die sich aus der Verschmelzung historischer Praktiken und modernen Anforderungen an die Erschließung und Organisation ergeben.
III.Die Entwicklung von Nachlassverzeichnissen in Deutschland
Der Text dokumentiert die Geschichte der Nachlassverzeichnisse in Deutschland, beginnend mit Diltheys frühen Forderungen nach Literaturarchiven. Er beschreibt die Herausforderungen bei der Erstellung umfassender Verzeichnisse, wie die von Mommsen (Bundesarchiv) und Denecke (Bibliotheken), die durch organisatorische Hürden, personelle Schwierigkeiten und unterschiedliche Auffassungen über den Umfang und die Art der Erschließung gekennzeichnet waren. Die Rolle der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) bei der Förderung und Koordinierung dieser Projekte wird hervorgehoben. Die Zentralkartei der Autographen (ZKA) an der Staatsbibliothek zu Berlin als frühes Beispiel der kooperativen Katalogisierung und der Übergang zu elektronischen Datenbanken wie Kalliope und der Zentralen Datenbank Nachlässe (ZDN) werden ebenfalls dargestellt.
1. Frühe Ansätze und Herausforderungen vor der Digitalisierung
Der Text beschreibt die Anfänge der systematischen Erfassung von Nachlässen in Deutschland. Dilthey plädierte bereits 1889 für die Einrichtung von Literaturarchiven, um Handschriften und Nachlässe vor Verlust zu schützen. Diese Forderung blieb jedoch lange Zeit weitgehend unbeachtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg betonte Harnack die Bedeutung der Verzeichnung und Verwertung von Nachlässen. Schreiber forderte bereits 1935 ein Inventar aller Handschriften, einschließlich Nachlässe, und die Festlegung verbindlicher Katalogisierungsregeln. Der Bibliothekar Milkaus kritisierte die staatliche Ablehnung eines Vorschlags Harnacks, junge Wissenschaftler zur Bearbeitung von Nachlässen einzusetzen. Diese frühen Bemühungen zeigen die Herausforderungen der Nachlasserschließung vor dem Hintergrund fehlender Standards, mangelnder Koordination und begrenzter Ressourcen. Die Orientierung an Antiquariatskatalogen verdeutlicht den damaligen Mangel an spezifischen Regelwerken für die Erschließung von Nachlässen.
2. Die Entstehung der ersten umfassenden Nachlassverzeichnisse
Angesichts der wachsenden Bedeutung von Nachlässen als Forschungsmaterial wurden in der Mitte des 20. Jahrhunderts die ersten umfassenden Verzeichnisse in Angriff genommen. Mommsen, ein Archivar, veröffentlichte bereits 1955 ein Verzeichnis zum Verbleib von Nachlässen. Auf diesem aufbauend, wurde er mit der Erstellung eines umfassenden Nachlassverzeichnisses für deutsche Archive beauftragt. Gleichzeitig begann Denecke mit der Erstellung eines parallel laufenden Verzeichnisses für Bibliotheksnachlässe. Beide Projekte waren mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, darunter personelle Probleme, Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Kooperationspartnern (insbesondere österreichische Archive und die DDR) und eine langwierige Bearbeitung. Die DFG spielte eine wichtige Rolle bei der Förderung und Koordination dieser Vorhaben. Die Schwierigkeiten der Projekte zeigen die Herausforderungen, die sich bei der Zusammenarbeit verschiedener Institutionen, bei der Vereinheitlichung von Methoden und bei der Bewältigung großer Datenmengen stellten. Mommsens Verzeichnis für Archive erschien erst 1971, Deneckes Verzeichnis für Bibliotheken 1969.
3. Die Zentralkartei der Autographen ZKA und der Weg zur Digitalisierung
Der Versuch, die beiden Nachlassverzeichnisse durch die Einbeziehung von Splitternachlässen und Einzelautographen zu erweitern, mündete 1966 in der Einrichtung der Zentralkartei der Autographen (ZKA) an der Staatsbibliothek zu Berlin. Dieses Projekt, gefördert von der DFG, zielte auf eine zentrale Erfassung und Auskunftsstelle für Autographen im öffentlichen Besitz. Es ermöglichte den teilnehmenden Institutionen einen vergleichsweise geringen Aufwand für eine überregionale Recherchemöglichkeit. Die alphabetische Ordnung aller Nachweise in einem einzigen Alphabet vereinfachte die Recherche und vermied Mehrfacheintragungen. Die Integration von Archiven in die ZKA erwies sich jedoch als schwierig, da die Materialien oft nicht in der für die ZKA geeigneten Form verzeichnet waren und die vorhandenen Findbücher eine andere Struktur aufwiesen. Das enorme Wachstum der ZKA führte schließlich zu einem Platzproblem, das mit Hilfe moderner Datenverarbeitung gelöst werden musste. Die ZKA bildete die Grundlage für die Datenbank Kalliope, die 2004 online ging. Der Erfolg der ZKA zeigte die Bedeutung von kooperativer Katalogisierung und den dringenden Bedarf an einer zentralen, digitalisierten Plattform.
4. Zentrale Datenbanken Nachlässe ZDN und Kalliope Kooperation und Herausforderungen
Die Entwicklung der Datenbanken ZDN (Zentrale Datenbank Nachlässe) und Kalliope markierte einen entscheidenden Schritt hin zur digitalen Nachlasserschließung. Die ZDN, initiiert vom Bundesarchiv, und Kalliope, betreut von der Staatsbibliothek zu Berlin, basieren auf unterschiedlichen Software-Systemen und Erfassungsschemata. Trotz Bemühungen um ein gemeinsames Erfassungsschema in den 1990er-Jahren, bleiben die Datenbanken zunächst getrennt. Die ZDN meldet summarische Bestandsbeschreibungen und verlinkt auf Online-Findbücher. Kalliope ermöglicht eine detailliertere Erschließung, inklusive der virtuellen Zusammenführung von Nachlasssplittern und Einzelautographen. Diese virtuelle Zusammenführung stößt jedoch auf Kritik von Archivseite, da sie zu einer Verwässerung von Qualitätsstandards führen kann. Die Nutzung von Normdaten (PND, GKD) ist zwar vorgesehen, wird aber von Archiven als aufwendig empfunden. Die zukünftige Zusammenführung beider Datenbanken über eine gemeinsame Rechercheplattform ist geplant, steht aber aufgrund finanzieller Engpässe noch aus. Das BAM-Portal zeigt bereits eine erste Form der Kooperation.
IV.Kalliope und ZDN Kooperation und Herausforderungen der Digitalisierung
Der Text beschreibt die Datenbanken Kalliope (Staatsbibliothek zu Berlin) und ZDN (Bundesarchiv) als wichtige Instrumente der digitalen Nachlasserschließung. Es werden die Möglichkeiten der Recherche, die unterschiedlichen Suchfunktionen und die Herausforderungen bei der Integration von Daten aus Archiven und Bibliotheken beleuchtet. Der Text diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der virtuellen Zusammenführung von Nachlasssplittern und Einzelautographen, sowie die kritischen Stimmen zur Verwendung des Begriffs „Autograph“ in Kalliope. Die Bedeutung der Normdaten (PND, GKD) für die Erschließung und die zukünftige Zusammenarbeit von Kalliope und ZDN werden ebenfalls besprochen. Die Integration in Portale wie BAM wird ebenfalls erwähnt.
1. Kalliope und ZDN Zwei zentrale Datenbanken für Nachlässe
Der Text beschreibt die beiden Datenbanken Kalliope (Staatsbibliothek zu Berlin) und ZDN (Zentrale Datenbank Nachlässe, Bundesarchiv) als wichtige Instrumente für die digitale Nachlasserschließung. Kalliope, hervorgegangen aus der Zentralkartei der Autographen (ZKA), bietet eine detailliertere Erschließung und erlaubt den Nachweis von Einzelautographen und Nachlasssplittern. Die ZDN hingegen konzentriert sich auf Nachlässe in Archiven und liefert summarische Bestandsbeschreibungen mit Links zu Online-Findbüchern. Die unterschiedlichen Datenbanken basieren auf verschiedenen Software-Systemen (Kalliope: aStec; ZDN: MySQL und PHP), was die zukünftige Zusammenführung erschwert. Beide Datenbanken nutzen unterschiedliche Zugänge und Suchmöglichkeiten, um die Nachlässe zu erschließen. Kalliope bietet beispielsweise einen Sucheinstieg über Personen, Autographen und Bestände, während die ZDN eine Volltextsuche ermöglicht. Die Unterschiede in der Suchfunktionalität und Datenstruktur verdeutlichen die Herausforderung bei der Integration beider Systeme.
2. Herausforderungen der Integration und der virtuelle Gesamtnachlass
Ein zentrales Thema ist die angestrebte, aber noch nicht realisierte Zusammenführung von Kalliope und ZDN. Anfang der 1990er-Jahre wurde ein gemeinsames Erfassungsschema entwickelt, doch unterschiedliche Software-Systeme (Kalliope: aStec, ZDN: Open Source) behindern die vollständige Integration. Die Zusammenführung steht laut Grothe (2006) auf der Agenda der zuständigen Institutionen, wird aber durch fehlende finanzielle Mittel behindert. Die DFG zeigt sich nach der Förderung von Kalliope II nicht bereit, die Anbindung der Archive an Kalliope erneut zu finanzieren. Kalliope ermöglicht die virtuelle Zusammenführung von Nachlasssplittern und Einzelautographen, was von Archivseite kritisch gesehen wird, da die großzügige Verwendung des Begriffs „Autograph“ zu einer Verwässerung von Qualitätsstandards führen könne. Die Integration von verschiedenen Arten von Materialien in Kalliope (z.B. auch Protokolle oder Programmankündigungen) wird als ein Grund für diese Kritik genannt. Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Plattform, die die Recherche in beiden Systemen vereinfacht, bleibt bestehen, jedoch wird die Datenerfassung weiterhin getrennt erfolgen.
3. Nutzung von Normdaten und zukünftige Perspektiven
Die Nutzung von Normdaten wie der Personennamennormdatei (PND) und der Gemeinsamen Körperschaftsdatei (GKD) ist in beiden Datenbanken vorgesehen, wird aber von Archivseite als aufwendig kritisiert. Die Autorin argumentiert jedoch, dass der Aufwand vertretbar ist und die Vorteile die Vereinfachung der Recherche und die Vermeidung von Mehrfacheinträgen überwiegen. Die Verknüpfung mit Normdatensätzen erleichtert die Identifizierung von Personen, auch bei unterschiedlichen Schreibweisen oder Pseudonymen. Für die Zukunft ist eine gemeinsame Präsentation der Nachweissysteme für Nachlässe in Archiven und Bibliotheken geplant, wobei die Daten weiterhin in getrennten Datenbanken gespeichert werden sollen. Die Recherchen sollen über ein gemeinsames Portal gleichzeitig in beiden Teilsystemen laufen und die Ergebnisse zusammengefasst präsentiert werden. Das BAM-Portal (Bibliothek, Archiv, Museum) dient als Beispiel für eine bereits existierende Kooperation, in die Kalliope und das Bundesarchiv eingebunden sind. Eine umfassende Lösung für die gemeinsame Datenbank steht jedoch weiterhin aus.
V.Österreichischer Verbundkatalog ÖVK NAH und internationale Vernetzung
Der Text erwähnt kurz den Österreichischen Verbundkatalog für Nachlässe, Autographen und Handschriften (ÖVK-NAH) als Beispiel für eine nationale Initiative zur Nachlasserschließung. Er hebt die Bedeutung von internationalen Kooperationen und der Vernetzung von Normdaten (LEAF-Projekt) hervor, um die Erschließung von Nachlässen auf internationaler Ebene zu verbessern.
1. Kalliope und ZDN Zwei Datenbanken unterschiedliche Ansätze
Der Text beschreibt die beiden deutschen Datenbanken Kalliope und ZDN, die sich der Nachlasserschließung widmen, jedoch unterschiedliche Herangehensweisen verfolgen. Kalliope, an der Staatsbibliothek zu Berlin angesiedelt, entstand aus der Zentralkartei der Autographen (ZKA) und ermöglicht eine detaillierte Erschließung von Nachlässen, einschließlich einzelner Autographen und Nachlasssplitter. Die ZDN (Zentrale Datenbank Nachlässe) des Bundesarchivs hingegen bietet summarische Bestandsbeschreibungen und verlinkt auf die detaillierten Findbücher der jeweiligen Archive. Diese unterschiedlichen Ansätze spiegeln die traditionellen Diskrepanzen zwischen archivischer und bibliothekarischer Praxis wider. Die verschiedenen Suchmöglichkeiten und die unterschiedliche Datenstruktur in beiden Datenbanken (Kalliope: aStec-System; ZDN: Open-Source-Produkte wie MySQL und PHP) zeigen die Herausforderungen einer zukünftigen Integration auf. Die unterschiedlichen Suchmöglichkeiten in Kalliope (Suche nach Personen, Autographen, Beständen) im Gegensatz zur Volltextsuche in der ZDN stellen weitere Hürden für eine Harmonisierung dar.
2. Virtuelle Zusammenführung und Kritik an der Autographen Definition
Ein wichtiges Thema ist die Möglichkeit der virtuellen Zusammenführung von Nachlasssplittern und Einzelautographen in Kalliope, um einen „virtuellen Gesamtnachlass“ zu schaffen. Dieser Ansatz, der es erlaubt, auch Teile eines Nachlasses, die an verschiedenen Institutionen verwahrt werden, digital zusammenzuführen, ist jedoch nicht unumstritten. Archivseite kritisiert den in Kalliope praktizierten großzügigen Umgang mit dem Begriff „Autograph“, da dies zu einer potenziellen Verwässerung der Qualitätsstandards führen könnte. Diese Kritik richtet sich gegen die Praxis, in Kalliope nicht nur echte Autographen, sondern auch andere Schriftstücke aus einem Nachlass zu erfassen (z.B. Protokolle, Programmankündigungen). Die Autorin kontert, dass Kalliope nicht nur Autographen erschließt, sondern alle Schriftstücke aus einem Nachlass, und dass die Anreicherung von Nachlässen mit verschiedenen Materialarten (siehe Diskussion um „echte“ vs. „angereicherte“ Nachlässe) eine gängige Praxis ist. Die Diskussion verdeutlicht die Notwendigkeit klarer Definitionen und einheitlicher Standards in der digitalen Nachlasserschließung.
3. Herausforderungen der Datenintegration und zukünftige Kooperationen
Obwohl ein gemeinsames Erfassungsschema für Kalliope und ZDN bereits in den 1990er Jahren entwickelt wurde, steht eine vollständige Datenintegration bis zum Zeitpunkt des Textes aus. Die unterschiedlichen Software-Systeme und die fehlenden finanziellen Mittel behindern die Zusammenführung. Trotzdem wird eine gemeinsame Präsentation der Nachweissysteme für die Zukunft angestrebt, wobei Recherchen über ein gemeinsames Portal in beiden Teilsystemen erfolgen und die Ergebnisse zusammengefasst präsentiert werden sollen. Das Bundesarchiv und die Staatsbibliothek zu Berlin planen eine XML-basierte Schnittstelle. Die finanzielle Unterstützung durch die DFG ist jedoch nach der Förderung von Kalliope II nicht mehr sichergestellt. Die Einbindung in das BAM-Portal (Bibliothek, Archiv, Museum) zeigt bereits eine Form der Kooperation, bietet aber noch keine umfassende Lösung für die Suche nach Nachlässen. Die Herausforderungen der technischen und finanziellen Umsetzung einer gemeinsamen Datenbank bleiben bestehen.
