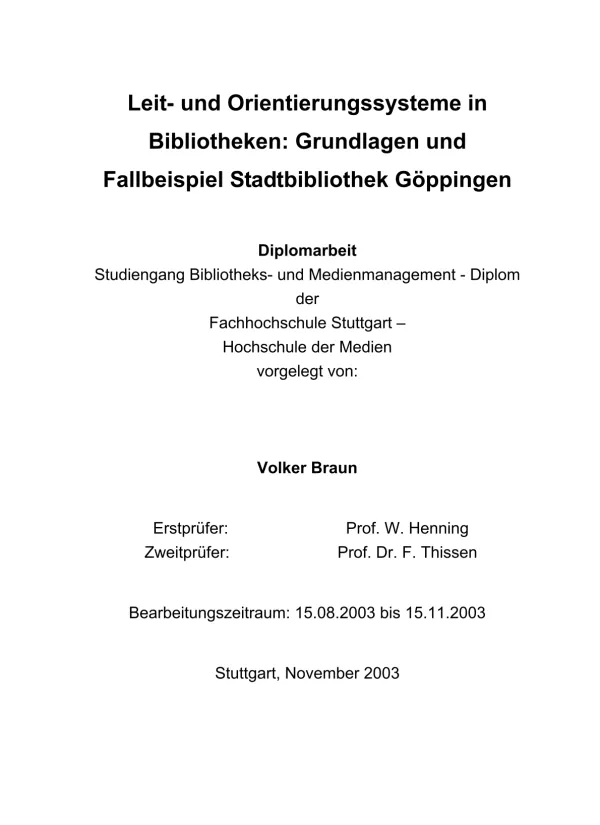
Bibliotheks-Leitsysteme: Orientierung optimieren
Dokumentinformationen
| Autor | Volker Braun |
| instructor/editor | Prof. W. Henning |
| Schule | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Medienmanagement |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 2.00 MB |
Zusammenfassung
I.Psychologische Grundlagen der räumlichen Orientierung in Bibliotheken
Diese Arbeit untersucht die psychologischen Mechanismen der räumlichen Orientierung, insbesondere im Kontext von Bibliotheken. Der Fokus liegt auf Wayfinding, der zielgerichteten Suche nach einem Weg. Es werden kognitive und sinnliche Grundlagen beleuchtet, einschließlich der Rolle von kognitiven Karten und der individuellen Raumwahrnehmung. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Bedürfnissen älterer Menschen, Kinder und Menschen mit Behinderungen, deren Informationsaufnahme und -verarbeitung eingeschränkt sein kann. Die Arbeit bezieht sich auf Erkenntnisse von Lynch und anderen, die die Bedeutung von Wegen, Begrenzungen, Knotenpunkten und Landmarken für die Orientierung hervorheben.
1. Wayfinding Grundlagen der räumlichen Orientierung
Der Abschnitt definiert den Begriff Wayfinding als zielgerichtetes räumliches Problemlösen, das sowohl von individuellen Fähigkeiten als auch von Umgebungsmerkmalen beeinflusst wird. Golledge definiert Wayfinding als die kognitiven und verhaltensbezogenen Fähigkeiten, einen Weg von einem Ursprung zu einem Ziel zu finden. Menschliche Eigenschaften wie sinnliche und kognitive Fähigkeiten, Erfahrung, Gewohnheit, Motivation, Emotion und Einstellung spielen eine entscheidende Rolle. Besondere Berücksichtigung finden spezifische Benutzergruppen wie Kinder, ältere Menschen, Behinderte und Analphabeten, deren Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung im Vergleich zum Durchschnittsnutzer eingeschränkt ist. Ältere Menschen mit verminderten kognitiv-räumlichen Fähigkeiten benötigen besondere Aufmerksamkeit in der Bibliotheksgestaltung.
2. Kognitive Karten und Raumwahrnehmung
Der Abschnitt thematisiert kognitive Karten als innere geistige Abbildungen der räumlichen Umwelt. Der Unterschied zwischen Images (Repräsentation einzelner Orte) und kognitiven Karten (Repräsentation größerer räumlicher Abschnitte mit mehreren Objekten und deren Relationen) wird nach Janzen erläutert. Lynchs Erkenntnisse zeigen, dass individuelle Vorstellungsbilder derselben Umwelt sehr unterschiedlich sein können, sowohl im Detaillierungsgrad als auch im strukturellen Aufbau. Einige bilden hierarchische Vorstellungen (vom Allgemeinen zum Besonderen), andere dynamische, zeitlich geordnete, die mit dem Erlebnis des Durchschreitens verbunden sind. Diese unterschiedlichen kognitiven Stile müssen bei der Bibliotheksgestaltung berücksichtigt werden, um eine optimale Orientierung für alle Nutzer zu gewährleisten.
3. Wayfinding Aufgaben und kognitive Fähigkeiten
Arthur und Passini beschreiben sieben Wayfinding-Aufgaben mit den dazugehörigen kognitiv-räumlichen Fähigkeiten. Dazu gehört beispielsweise das Lernen einer neuen Strecke (Entwicklung einer kognitiven Karte), die Rückkehr zum Ausgangspunkt, die Verbindung bekannter Strecken mit neuen räumlichen Anordnungen, das Lernen von Strecken über verkleinerte Darstellungen, das Zeigen in die Richtung bestimmter Orte, das Lernen einer Strecke anhand einer nicht-ausgerichteten Darstellung und das Verständnis des Gesamtlayouts. Die Fähigkeit, diese Aufgaben zu lösen, ist abhängig von den individuellen kognitiv-räumlichen Fähigkeiten der Nutzer. Eine gute Bibliotheksgestaltung sollte diese verschiedenen Fähigkeiten und die damit verbundenen Herausforderungen berücksichtigen.
4. Computermodell zum Wayfinding und Bibliotheksgestaltung
Der Abschnitt beschreibt ein vereinfachtes Computermodell von Raubal zum Wayfinding in Gebäuden. Das Modell basiert auf unvollständigen Beobachtungen des Raumes, aus denen unvollständiges Wissen abgeleitet wird, um darauf basierend Handlungen vorzunehmen. Diese Handlungen führen zu weiteren Beobachtungen und Wissen, bis das Ziel erreicht ist. Obwohl vereinfacht und Faktoren wie Störungen im Wayfinding-Prozess nicht berücksichtigt werden, bietet das Modell eine gute Grundlage für die Evaluation von Gebäuden, wie zum Beispiel Bibliotheken. Die verschiedenen Blickrichtungen eines Besuchers können beispielsweise durch Fotos oder Videos dokumentiert werden, um die Orientierung im Raum zu analysieren und zu optimieren. Die Anwendung dieses Modells auf Bibliotheken unterstreicht den Fokus auf die Verbesserung der räumlichen Orientierung für die Nutzer.
5. Spezifische Herausforderungen der Bibliotheksgestaltung im Vergleich zu Ladengeschäften
Der Abschnitt vergleicht die Zielsetzungen und die Herausforderungen der Gestaltung von Bibliotheken mit denen von gewinnorientierten Ladengeschäften. Während Bibliotheken nicht primär auf Gewinn ausgerichtet sind, ist ihr Erfolg dennoch von einer modernen, übersichtlichen und logischen Raumgestaltung abhängig. Bibliotheken sollten zum Flanieren, Stöbern und Entdecken anregen, gleichzeitig aber auch einen verständlichen und direkten Weg zur gesuchten Information ermöglichen. Dieser scheinbare Widerspruch kann bis zu einem gewissen Grad gelöst werden. Allerdings unterliegen Bibliotheken bei der Medienpräsentation engeren Grenzen als Buchhandlungen, da das Auffinden der Medien über Signaturen eine wichtige Rolle spielt. Die Berücksichtigung dieser spezifischen Bedingungen ist essentiell für ein effektives Orientierungssystem.
II.Architektur und Innenarchitektur für eine orientierungsfreundliche Bibliothek
Die Gestaltung von Bibliotheken, angelehnt an Prinzipien der Ladenplanung, wird analysiert. Es wird untersucht, wie architektonische und innenarchitektonische Maßnahmen die Orientierung verbessern können. Die optimale Gestaltung von Eingängen, die Platzierung von Raumelementen (z.B. Säulen) als Orientierungspunkte und die Anordnung von Regalen (max. 4-5m Länge, im Kinderbereich 3m) werden diskutiert. Die Arbeit vergleicht dabei Bibliotheken mit gewinnorientierten Geschäften, betont aber die spezifischen Herausforderungen der Medienpräsentation in Bibliotheken mit dem Fokus auf Signaturen.
1. Gestaltung von Eingängen und Fassaden
Die Gestaltung des Eingangs und der Fassade ist entscheidend für die Orientierung und den ersten Eindruck. Eingänge sollten hell, breit, hoch und offen sein, ohne Bodenschwellen. Drehtüren, kleine Öffnungen oder weit zurückversetzte Eingänge sind nachteilig. Der Kontrast des Bodenmaterials zum Außenbereich sollte gering gehalten werden, um optische Hemmschwellen zu vermeiden. Laut Kreft liegt der optimale Eingang auf der linken Seite, um die linke Raumseite nah und die rechte Seite übersichtlich zu halten. Beschriftungen links sind einfacher zu lesen. Fassaden symbolisieren den Nutzungszweck, präsentieren die Werte des Betreibers und wecken das Interesse der Kunden. Ein beleuchtetes Bibliothekslogo und Hinweise auf die Einrichtung sind Standard.
2. Raumgliederung und Orientierungspunkte
Die Raumgliederung spielt eine wichtige Rolle für die Orientierung. Säulen in unterschiedlichen Höhen und Formen dienen als überragende Raumelemente, Orientierungspunkte und Informationsträger. Künstliche Bezugspunkte (Weg- und Landmarken) können zusätzliche Orientierungshilfen bieten, besonders wenn sonstige Raumelemente nicht ausreichend auffällig sind. Das Beispiel des Kaufhauses Breuninger in Stuttgart mit einer vergoldeten Statue und einem Brunnen veranschaulicht den Einsatz solcher künstlichen Landmarken zur Verbesserung der Orientierung. Die gezielte Platzierung solcher Elemente kann die Übersichtlichkeit und die Wegfindung in Bibliotheken deutlich verbessern.
3. Regalaufstellung und Möblierung
Die Anordnung von Regalen beeinflusst die Übersichtlichkeit und Orientierung. Laut Gretz führen durchgehend gleich hohe Möbel zu Spannungslosigkeit und Unübersichtlichkeit. Unterschiedliche Höhenlevels lockern den Raum auf. Regalstrecken sollten maximal 4-5 Meter lang sein (Kinderbereich 3 Meter). Für öffentliche Bibliotheken ist eine aufgelockerte Aufstellung sinnvoll, die Platz für Präsentationen, Ausstellungen und Sitzmöglichkeiten bietet. Verdichtete und aufgelockerte Zonen sollten im Wechsel angeordnet werden. Regalkojen eignen sich für eine aufgelockerte Aufstellung. Die optimale Anordnung hängt vom Bibliothekskonzept und dem Raumangebot ab. Eine gute Planung berücksichtigt die Bedürfnisse der Nutzer und sorgt für eine angenehme und effiziente Raumnutzung.
4. Anwendung von Erkenntnissen der Stadtplanung
Die Arbeit überträgt Erkenntnisse von Lynch zur Orientierung in Städten auf die Bibliotheksgestaltung. Wichtige Straßenmerkmale wie extreme Enge oder Breite, klare Anfangs- und Endpunkte, aufeinanderfolgende Merkzeichen und rechtwinklige Kreuzungen beeinflussen die Orientierung positiv. Kreuzungen mit mehr als vier Ausgängen und kleine Winkelunterschiede zwischen Wegen erschweren die Orientierung. Rechtwinklige Anordnungen scheinen das Überblickswissen schneller zu ermöglichen. Der Vergleich der empirischen Befunde aus der Stadtplanung mit den Anforderungen an die Ladenplanung und deren Übertragbarkeit auf Bibliotheken zeigt die Relevanz städteplanerischer Erkenntnisse für die Gestaltung von Bibliotheken.
5. Vertikale Erschließung und Hauptwege
Die vertikale Erschließung, insbesondere die Anordnung von Treppen, ist ein wichtiger Aspekt. Treppen sollten als Fortsetzung der Hauptwege (Loops) gestaltet sein und vom Eingang aus sichtbar sein. Bei langen Grundrissen sind zwei Treppen vorteilhaft. In großen Räumen kann eine zentrale Treppenlage die Erreichbarkeit der Randzonen verbessern. Eine Randlage an der Längswand öffnet den Raum, während eine freie Treppe im Raum den Loop ermöglicht und Wandfläche schafft, aber Hintergrundflächen verdeckt. Eine leichte und transparente Gestaltung der Treppe verbessert die Durchsicht. Die Antrittsstufen sollten einladend zum Eingang gerichtet sein, und am Etagenaustritt sollte genügend Raumtiefe vorhanden sein.
III.Leit und Orientierungssysteme in Bibliotheken Schilder Print und elektronische Medien
Ein zentraler Teil der Arbeit befasst sich mit der Planung und Gestaltung von Leit- und Orientierungssystemen. Verschiedene Formen der Beschilderung (Schilder, Banner, Raumpläne), Printprodukte (Broschüren, Faltblätter) und elektronische Systeme (digitale Raumpläne, Kiosksysteme) werden betrachtet. Die Arbeit definiert Anforderungen an Schilder (Platzierungshöhe, Informationsmenge, Farbgestaltung, Piktogramme), untersucht die Gestaltung von Raumplänen (2D vs. 3D) und die Möglichkeiten der Farbcodierung. Die Lesbarkeit und Erkennbarkeit von Informationen werden als wichtige Faktoren hervorgehoben.
1. Leitsysteme Funktionen und Anforderungen
Ein Leitsystem leitet den Nutzer von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel. Es muss klar die richtige Richtung anzeigen und sollte nicht alle Routenalternativen anbieten, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Der Kunde kann zusätzliche Routen durch erworbenes Überblickswissen selbständig finden. Architektonische Kriterien für die Notwendigkeit eines Leitsystems sind mehrere Geschosse, deutliche räumliche Trennungen oder getrennte Gebäudeteile. Beispiele für Leitsysteme sind Schilder mit Pfeilen oder Markierungen an Böden, Wänden und Decken. Ein überschaubares Bibliotheksdesign benötigt ein weniger ausgeprägtes Leitsystem. Die Effektivität eines Leitsystems hängt stark von seiner Klarheit und der Vermeidung unnötiger Informationen ab.
2. Orientierungssysteme Topographie und Inhalt
Ein Orientierungssystem informiert über die topografische Lage und den Inhalt von Objekten. Dazu gehören Raumpläne, Raummodelle, sowie Haus-, Etagen-, Raum-, Bereichs-, Sachgebiets- und Regalinformationen und Medienetiketten. Orientierungssysteme haben auch eine leitende Funktion. Ein Raumplan ermöglicht es dem Kunden, sein Ziel zu erkennen und den Weg selbständig zu finden. Idealerweise überträgt der Kunde das Kartenwissen auf seine Feldperspektive ohne zusätzliche Richtungshinweise. Die Abgrenzung zwischen Leit- und Orientierungssystemen ist nicht immer eindeutig, da beide Aspekte oft miteinander verknüpft sind und zur Gesamtorientierung beitragen. Die Bereitstellung von Überblicksinformationen ist essentiell für die erfolgreiche Nutzung eines Orientierungssystems.
3. Schilder Anforderungen an Gestaltung und Platzierung
Schilder und Banner ergänzen die Möblierung und Wegeführung, können aber komplexe Grundrisse nicht vollständig ausgleichen. Gut gestaltete Schilder werden nicht immer wie geplant genutzt. Nutzer orientieren sich zuerst am Raum und versuchen einen Überblick zu gewinnen. Bei Stress oder Eile wenden sie sich an Mitarbeiter. Übermäßige Beschilderung kann in einfachen Umgebungen störend wirken. Auffällige Objekte wie Treppenhäuser benötigen keine Beschilderung. Die optimale Platzierungshöhe für Schilder liegt laut Arthur/Passini bei 1,20-1,60m (InfoBand 1), berücksichtigt aber den Blickwinkel verschiedener Nutzergruppen. Die Informationsmenge pro Schild sollte überschaubar sein, um Reizüberflutung zu vermeiden.
4. Schildergestaltung Materialien Beschriftung und Piktogramme
Geeignete Trägermaterialien für Schilder sind Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Holz. Acrylglas und PVC eignen sich für Abdeckungen. Beschriftungen sollten flexibel sein, da sich Sachgebiete, Signaturen und Serviceeinrichtungen ändern können. Papiereinlagen sind eine günstige und flexible Lösung. Selbstklebeschriften und -piktogramme sind preiswert und korrigierbar. Bei systematischer Medienordnung muss die Ordnung an den Regalen abgebildet werden, z.B. mit Systemauszügen oder alphabetischen Listen thematischer Suchbegriffe mit Notationen. Große Informationsmengen und kleine Schriftgrade sind nachteilig. Piktogramme sollen die Wahrnehmung beschleunigen und die Aufmerksamkeit erhöhen, ihre Bedeutung ist aber nicht immer eindeutig. Es gibt wenige Normen, selbst Standardpiktogramme werden unterschiedlich gestaltet. Der Geradeaus-Pfeil ist ein besonderes Problem in mehrgeschossigen Gebäuden.
5. Farbcodierung und Schriftgestaltung auf Schildern
Farbcodierungen kennzeichnen Sachverhalte oder Funktionen durch Farben und können auch auf Raumelemente angewandt werden. Sie erleichtern die Orientierung bei großen Informationsmengen, setzen aber gutes Design und eine Begrenzung der Farben voraus. Das Verständnis von Farbcodierungen erfordert einen Lernprozess. Nach Gretz und Arthur/Passini sollten nur eindeutig benennbare Farben verwendet werden (rot, orange, gelb, grün, blau, violett, rosa, braun, grau). Leuchtkräftige und gesättigte Farben werden als angenehmer empfunden. Braun ist unbeliebt, Violett und Rosa können verwechselt werden. Bei der Schriftgestaltung hat schwarze Schrift auf weißem Grund die beste Nahwirkung, helle Schrift auf dunklem Grund ist bei größerer Entfernung besser lesbar. Sehr helle Hintergründe sollten vermieden werden, da sie blenden.
6. Raumpläne und Webbasierte Anwendungen
Raumpläne (Grundrisse oder 3D-Ansichten) ermöglichen die Wegweisung, z.B. direkt aus der Titelanzeige im OPAC. Die Stadtbibliothek Ludwigsburg bietet dies bereits webbasiert an. Ein Hauptproblem ist die fehlende Ausrichtung und der fehlende Bezug zum eigenen Standort. Eine Wegeführungsanimation könnte die Bildung kognitiver Karten erleichtern. Elektronische Informationssysteme wie Kiosksysteme oder Point-of-Information (POI)-Systeme mit Wegeleitsystemen sind Standard außerhalb von Bibliotheken (z.B. Galeria Kaufhof). Die Hochschule für Technik Stuttgart nutzt ein ähnliches Terminal. Weitere Anwendungen könnten eine Hypertext-Klassifikation mit animierter Wegeführung oder lokale Funksysteme sein, die mit Handys, PDAs oder Notebooks genutzt werden können.
IV.Zusammenarbeit von Fachleuten und Bibliotheken bei der Gestaltung von Orientierungssystemen
Die erfolgreiche Implementierung von Orientierungssystemen erfordert die Zusammenarbeit von Bibliotheken mit Fachleuten. Die Arbeit betont die Bedeutung der frühzeitigen Einbeziehung von Architekten, Innenarchitekten, Grafikdesignern und Informationsdesignern in die Planung, insbesondere bei Neubauten. Die Rolle der staatlichen Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen wird ebenfalls angesprochen. Der Text unterstreicht den Unterschied zwischen der Perspektive von Architekten (oftmals fokussiert auf den Gesamteindruck) und Designern, die sich stärker auf die Signalwirkung von Beschilderung konzentrieren.
1. Zusammenarbeit bei Neubauten und Modernisierungen
Die Konzeption von Leit- und Orientierungssystemen unterscheidet sich zwischen Neubauten und Modernisierungen. Bei Neubauten sollte das System integraler Bestandteil der Bauplanung sein. Eine frühzeitige Zusammenarbeit von Architekten, Bauherren, Informationsdesignern und Bibliothekaren ist essentiell für die Entwicklung passender Lösungen. Der Architekt ist laut Eckart für die Planung und Umsetzung eines sinnvollen Systems von Räumen, Wegen und Plätzen verantwortlich. Eine frühzeitige und umfassende Planung führt zu einer selbstverständlichen und effektiven Orientierung. Bei Modernisierungen ist die Anpassung bestehender Strukturen an die neuen Anforderungen im Fokus der Zusammenarbeit.
2. Rollenverteilung und Planungsprozess
Ein wichtiger Teil der Konzeption ist die Erstellung einer Liste mit den Standorten der Orientierungselemente. Es muss festgelegt werden, welche Einrichtungen Beschilderung benötigen. Die Planungsgruppe klärt die Verantwortlichkeiten für die Textproduktion und -redaktion. Die Entscheidung, welche Elemente elektronischer Orientierungssysteme wo eingesetzt werden und ob Printprodukte das System ergänzen oder ersetzen sollen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Planung. Eine klare Rollenverteilung und ein strukturierter Planungsprozess sind unerlässlich für ein effizientes und erfolgreiches Ergebnis. Die Zusammenarbeit erfordert eine gute Kommunikation und Abstimmung zwischen allen beteiligten Parteien.
3. Notwendige Fachkompetenzen
Für die Gestaltung von Leit- und Orientierungssystemen sind verschiedene Fachkompetenzen notwendig. Architekten und Innenarchitekten können die räumliche Struktur und die Kundenleitwege optimieren. Die staatlichen Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen bieten ebenfalls Unterstützung. Architekten konzentrieren sich oft auf den harmonischen Gesamteindruck und bevorzugen unauffällige Beschilderung. Informationsdesigner hingegen legen Wert auf die Signalwirkung der Beschilderung. Grafikdesigner und Kommunikationsdesigner eignen sich für die Gestaltung der Beschilderung. Für elektronische Systeme sind die Firma des Bibliotheksmanagementsystems und Webdesigner relevant. Ein Büro, das verschiedene Professionen vereint, kann ganzheitliche Lösungen anbieten. Die Auswahl der richtigen Fachkräfte ist entscheidend für die Qualität des Orientierungssystems.
V.Fallstudie Stadtbibliothek Göppingen
Die Arbeit präsentiert eine Fallstudie zur Stadtbibliothek Göppingen. Die Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse wird an konkreten Beispielen aus der Bibliothek gezeigt. Eine Kundenumfrage (250 Teilnehmer ab 14 Jahren im Februar 2003) diente als Grundlage für die Gestaltung des Orientierungssystems. Konkrete Herausforderungen wie die Gestaltung des OPACs, die Anordnung von Regalen, die Platzierung von Etageninformationsschildern und die Integration von elektronischen Anwendungen werden diskutiert. Die Leiterin der Stadtbibliothek Göppingen, Frau Buck, ist eine wichtige Bezugsperson in diesem Abschnitt.
1. Vorbereitende Kundenumfrage und Themenfindung
Die Fallstudie beginnt mit einer vorbereitenden Kundenumfrage zur Orientierung in der Stadtbibliothek Göppingen. Im Februar 2003 wurden 250 Kunden ab 14 Jahren befragt. Der Fragebogen umfasste 13 Fragen zur Nutzung und Bewertung von Etagenraumplänen, Regalbeschilderungen, OPAC und Web-OPAC. Die Ergebnisse flossen in die weiteren Kapitel ein. Vor der Umfrage erstellte die Leiterin der Stadtbibliothek Göppingen, Frau Buck, eine grobe Übersicht über relevante Themen, die von Mitarbeitergruppen bearbeitet wurden. Diese vorbereitende Phase zeigt die Nutzerperspektive und dient als Basis für die anschließende Gestaltung des Orientierungssystems.
2. Analyse des bestehenden Orientierungssystems
Die Analyse des bestehenden Orientierungssystems der Stadtbibliothek Göppingen deckt verschiedene Schwachstellen auf. Der Stadtplan auf der Webseite der Stadtbibliothek ist schwer zu navigieren und sollte aus Kundensicht besser erreichbar sein (z.B. über die Kontaktseite). Die Systematik in einigen Sachgebieten wurde durch Klartextgruppen ersetzt oder umgebildet. Diese bestehen aus maximal drei Hierarchieebenen, sind meist alphabetisch geordnet und stehen oft in Regalen oder Cargos. Im zweiten Obergeschoss ist der Interessenkreisbereich „Mensch“ mit 20 heterogenen Themen auf acht Freiständern unübersichtlich verteilt. Der Etagenraumplan zeigt den genauen Standort nicht an, was zu Kundenfragen führt. Der OPAC weist Schwächen im Informationsdesign auf, besonders die Profisuche ist unverständlich.
3. Gestaltungsvorschläge und Verbesserungen
Der Bericht enthält Gestaltungsvorschläge zur Verbesserung des Orientierungssystems. Im Erdgeschoss wird ein verständlicheres Möblierungsmuster vorgeschlagen, um den unübersichtlichen Nebenweg zu beseitigen. Ein neuer Entwurf für ein Etageninformationsschild, exemplarisch für das 1. OG, soll auf jeder Etage aufgestellt werden. Der Plan soll übersichtlich sein, ohne Farbcodierung und Perspektive. Die Sachgebietsbezeichnungen heben sich kontrastreich ab, und Piktogramme markieren Serviceeinrichtungen. Eine alphabetische Liste der Sachgebiete wird hinzugefügt, und der Standort des Betrachters ist als roter Punkt eingezeichnet. Für die Platzierung der neuen Etagenschilder gibt es wenige Alternativen; der Aufzugsbereich wird nur für bestimmte Personengruppen genutzt. Die bisherigen Regalbeschriftungen werden als ausdruckslos, zu klein und kontrastarm kritisiert und Verbesserungsvorschläge unterbreitet.
