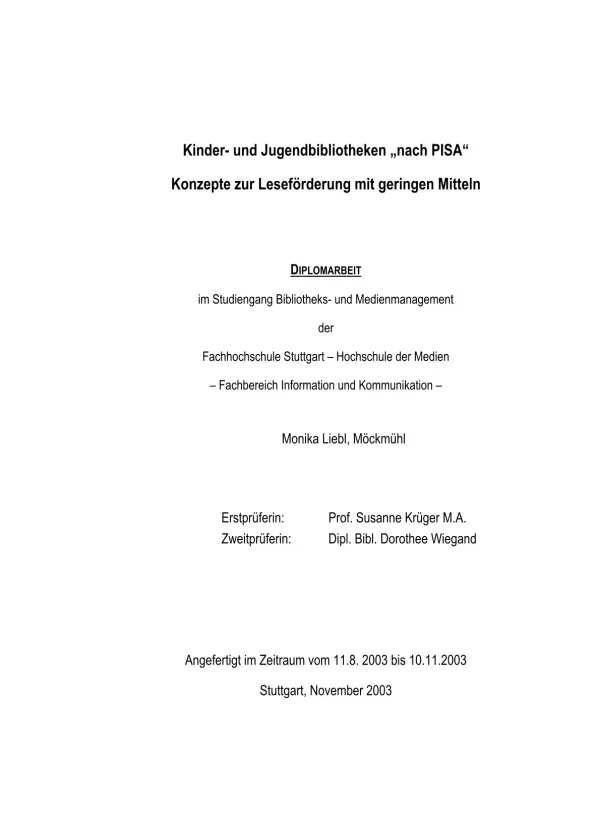
Leseförderung: Konzepte für Bibliotheken
Dokumentinformationen
| Autor | Monika Liebl |
| instructor | Prof. Susanne Krüger M.A. |
| Schule | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien – Fachbereich Information und Kommunikation |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Medienmanagement |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Ort | Möckmühl |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.32 MB |
Zusammenfassung
I.Die Bedeutung von Lesekompetenz und Leseförderung
Die Studie untersucht die Lesekompetenz deutscher Schüler im Kontext internationaler Vergleichsstudien wie PISA und IGLU. Ein zentrales Thema ist die Leseförderung, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen durch neue Medien und den Einfluss des familiären Hintergrunds auf die Sprachentwicklung und den Wortschatz von Kindern. Die Studie betont die Notwendigkeit einer umfassenden Leseförderung, die sowohl die Lesefreude als auch die Aneignung von Lesestrategien fördert. Die Ergebnisse unterstreichen den starken Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und schulischem Erfolg, wobei der Einfluss der Familie als besonders wichtig hervorgehoben wird.
1. Lesekompetenz als Grundlage für den Umgang mit neuen Medien
Der Text beginnt mit der Feststellung, dass die Förderung von Lesekompetenzen und Lesekenntnissen wieder im Fokus steht. Ein wichtiger Grund hierfür ist die Erkenntnis, dass Lesekompetenz die Grundlage für den Umgang mit anderen, insbesondere elektronischen Medien bildet. Dies unterstreicht die Bedeutung von Lesefähigkeiten in der heutigen, digitalisierten Welt. Die Fähigkeit, Texte zu verstehen und Informationen zu verarbeiten, ist nicht nur für den schulischen Erfolg, sondern auch für die erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft unerlässlich. Die zunehmende Verbreitung von elektronischen Medien verändert Lesestrategien und -techniken. Als Beispiel wird das „Lesezapping“ genannt, eine Technik des überfliegenden Lesens, bei der gezielt nur interessante Textpassagen gelesen werden. Diese Technik erfordert jedoch die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und die relevanten Informationen zu extrahieren. Die Studie betont, dass diese Fähigkeit zur Informationsentnahme aus Texten ein essentieller Bestandteil der Lesekompetenz ist und gezielt gefördert werden muss, um die Herausforderungen der Informationsgesellschaft zu meistern.
2. Einfluss des sozialen Umfelds und der Familie auf die Lesekompetenz
Der Text hebt den starken Einfluss des sozialen Umfelds und insbesondere der Eltern auf die Sprachentwicklung und den Wortschatz eines Kindes hervor. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die Lesekompetenz. Eine verbreitete Ansicht, dass die Familie den mündlichen und die Schule den schriftlichen Spracherwerb vermittelt, wird als unvollständig bezeichnet. Der Spracherwerb und der Schrifterwerb sind eng miteinander verknüpft und bedürfen kontinuierlicher Förderung. Der Text unterstreicht die Bedeutung des frühkindlichen Lesens, beispielsweise durch das Betrachten von Bilderbüchern und das Vorlesen im Kindergarten. Die Rolle der Eltern wird als besonders wichtig hervorgehoben, da sie die frühzeitige Entwicklung der Lesefreude maßgeblich beeinflussen und die schulischen Lernprozesse begleiten. Studien belegen, dass der familiäre Hintergrund einen stärkeren Einfluss auf die Lesekompetenz hat als das Bildungssystem selbst. Zitiert wird der wissenschaftliche Beirat für Familienfragen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der die Bedeutung informeller Kontexte der Herkunftsfamilien für die Lesekompetenz von Jugendlichen betont.
3. Herausforderungen der Schule und die Notwendigkeit von Leseförderung
Der Text weist darauf hin, dass schulische Methoden und Lehrpläne die Entwicklung von Lesefreude oft behindern. Eine Befragung von Bonfadelli und Saxer zeigt, dass ein Fünftel der Fünfzehnjährigen angibt, dass die Schule ihnen das Lesen verleidet. Ähnliche Erfahrungen berichten auch Erwachsene, die negative Erfahrungen mit Schultexten als Grund für ihr Nichtlesen angeben. Die Schule vermittelt zwar Lesekompetenz, aber oft werden Texte verwendet, die nicht altersgerecht oder für die Schüler uninteressant sind. Deshalb gehen von der Schule sowohl lesefördernde als auch lesefreudehemmende Impulse aus. Das Ziel der schulischen Leseförderung sollte neben der Vermittlung von Lesestrategien für informative Texte auch die Förderung der Lesefreude und die Gewohnheit des Lesens sein. Um dem entgegenzuwirken, werden Reformen des Bildungswesens und Veränderungen in der Lehrerausbildung als notwendig erachtet, allerdings als langfristige Maßnahmen. Bibliotheken können hier eine wichtige ergänzende Rolle übernehmen, indem sie Lehrer bei der Literaturauswahl unterstützen und eigene Angebote schaffen, die auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen eingehen.
4. Entwicklung des Begriffs Leseförderung und aktuelle Herausforderungen
Der Begriff Leseförderung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Zunächst konzentrierte er sich auf die Förderung des Lesens von „guten Büchern“. Später, mit der Verbreitung des Fernsehens, lag der Schwerpunkt auf dem Ausgleich des „schlechten Einflusses“ des Fernsehens. Heute geht es vor allem darum, die gefährdete „kulturelle Praxis“ des Lesens zu fördern, sowohl im Hinblick auf die Verbesserung der Lesefähigkeit als auch auf die Lesefreude. Der Text erwähnt die zunehmende Konkurrenz durch Fernsehen und elektronische Medien. Obwohl eine Erweiterung des Medienangebots die Nutzungszeit anderer Medien verkürzt, muss das Lesen besonders gefördert werden, da es auch bei freiwilliger Nutzung wichtige Kompetenzen vermittelt. Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit höherer Lesekompetenz elektronische Medien sinnvoller nutzen. Trotz technischer Entwicklungen bleibt Lesen eine grundlegende Fähigkeit, gleichzeitig steigt jedoch der Anteil der Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen haben. Daher ist eine gezielte Leseförderung unerlässlich.
5. Internationale Vergleichsstudien PISA und IGLU und deren Ergebnisse für Deutschland
Der Text bezieht sich auf die internationalen Vergleichsstudien PISA und IGLU, die den Stand der Lesekompetenz in verschiedenen Ländern untersuchen. Deutschland schneidet in diesen Studien im Vergleich zu anderen Ländern eher schlecht ab, wobei auch innerhalb Deutschlands große Unterschiede in der Lesekompetenz der Schüler bestehen. Ein besonders besorgniserregender Aspekt ist der hohe Anteil an Jugendlichen mit sehr schlechten Leistungen, bei denen der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung gefährdet ist. Diese Schüler haben deutlich größere Schwierigkeiten beim Lesen als ihre Altersgenossen in vielen anderen Ländern. Während die IGLU-Studie im Vergleich zu PISA bessere Ergebnisse für Deutschland zeigt, weisen beide Studien auf Defizite im deutschen Bildungssystem hin. Die Studien sollen den teilnehmenden Staaten ermöglichen, ihr Bildungssystem zu bewerten und Mängel zu erkennen, um die Entwicklung des Bildungssystems zu beobachten und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu überprüfen. Deutschland liegt in beiden Studien hinter Ländern wie Schweden, Niederlande, England, Kanada und den USA.
II.Die Rolle von Bibliotheken in der Leseförderung
Bibliotheken spielen eine entscheidende Rolle in der Leseförderung. Sie sehen die Vermittlung von Informationsgewinnung und Freizeitgestaltung durch das Lesen als ihre Aufgabe. Die Studie beleuchtet jedoch auch die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen Bibliotheken aufgrund der Krise der kommunalen Haushalte konfrontiert sind, und die damit verbundenen Einschränkungen bei Leseförderungsmaßnahmen. Trotz knapper Budgets setzen sich Bibliotheken verstärkt für die Leseförderung ein und bieten diverse Programme an, oft in Kooperation mit Schulen und Kindergärten.
1. Bibliotheken und ihre traditionelle Rolle in der Leseförderung
Der Text beschreibt Bibliotheken als traditionell wichtige Akteure in der Leseförderung. Sie sehen die Förderung des Lesens als Möglichkeit zur Informationsgewinnung und Freizeitgestaltung und betrachten dies als eine ihrer Kernaufgaben. Trotzdem werden sie in der öffentlichen Diskussion nach der PISA-Studie und in der Studie selbst kaum erwähnt. Der Text hebt hervor, dass Bibliotheken verstärkt auf ihre Aktionen zur Leseförderung aufmerksam machen, um ihre Bedeutung zu unterstreichen und ihre aktive Rolle im Bereich der Lesekompetenz zu verdeutlichen. Die Tatsache, dass Bibliotheken in den öffentlichen Diskursen rund um PISA und die Bildungsmisere oft unerwähnt bleiben, ist ein wichtiges Indiz für die Notwendigkeit einer stärkeren Sichtbarmachung ihrer Leistungen im Bereich der Leseförderung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, der oft nicht ausreichend gewürdigt wird.
2. Finanzielle Herausforderungen für Bibliotheken und ihre Auswirkungen auf die Leseförderung
Ein weiteres zentrales Thema ist die schwierige Haushaltslage der Kommunen, die als „schwerwiegendste der Nachkriegszeit“ bezeichnet wird. Diese Krise wirkt sich stark auf Bibliotheken aus, die, wie andere Kultureinrichtungen auch, von drastischen Sparmaßnahmen betroffen sind. Die sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben der Gemeinden führen zu erheblichen Budgetkürzungen, was die Durchführung und das Angebot von Leseförderprogrammen einschränkt. Die finanzielle Notlage stellt eine immense Herausforderung für Bibliotheken dar, da sie ihre Aufgaben der Leseförderung trotz knapper Mittel aufrechterhalten müssen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit von zusätzlichen Fördermitteln und einer stärkeren politischen Unterstützung für Bibliotheken, damit diese ihre wichtige Rolle in der Leseförderung auch weiterhin wahrnehmen können.
3. Bibliotheken als Ergänzung zum Schulsystem in der Leseförderung
Der Text sieht Bibliotheken als wichtige Ergänzung zum bestehenden Schulsystem in der Leseförderung. Sie können durch ihr Fachwissen Lehrer bei der Auswahl geeigneter Literatur unterstützen und parallel zum Unterricht Angebote schaffen, die auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen eingehen. Ob das Gelesene anspruchsvolle oder triviale Literatur ist, spielt für die Förderung der Lesefreude zunächst eine untergeordnete Rolle. Die Bibliotheken können somit die Lücke zwischen dem schulischen Unterricht und den individuellen Interessen der Kinder schließen. Durch gezielte Angebote und die Zusammenarbeit mit Schulen und Lehrkräften kann eine effektive und nachhaltige Leseförderung erreicht werden. Im Vergleich zu den oft frustrierenden Erfahrungen mit Schultexten, können Bibliotheken eine positive und motivierende Lernumgebung bieten, die die Freude am Lesen fördert.
4. Kooperation mit Schulen und Kindergärten als strategischer Ansatz
Der Text hebt die Bedeutung der Kooperation von Bibliotheken mit Schulen und Kindergärten für eine effektive Leseförderung hervor. Diese Zusammenarbeit ist besonders wichtig angesichts begrenzter Mittel, da sich die Leseförderung durch die Konzentration auf diese Einrichtungen systematisch und effektiv betreiben lässt. Die Zusammenarbeit bietet nicht nur die Möglichkeit, Ressourcen zu bündeln, sondern auch die Reichweite von Leseförderprogrammen zu erhöhen. Die kontinuierliche Kommunikation und der Informationsaustausch zwischen Bibliotheken, Lehrkräften und Erziehern tragen zur Etablierung von Angeboten bei. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt der Bertelsmann Stiftung, welches die Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und Schulen in Nordrhein-Westfalen fördert. Diese Kooperationen sind nicht nur für die Bibliotheken selbst von Vorteil, sondern ermöglichen auch eine ganzheitliche und nachhaltige Leseförderung.
5. Konkrete Beispiele für Leseförderangebote in Bibliotheken und Herausforderungen
Der Text nennt verschiedene konkrete Beispiele für Leseförderungsangebote in Bibliotheken, wie Bilderbuchkinos, Themenkisten, Traumlesestunden und Vorlesepaten. Die Stadtbibliothek Heilbronn dient als Fallbeispiel, in dem die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, der Einsatz von Ehrenamtlichen und die Durchführung von Veranstaltungen wie Lesepartys beschrieben werden. Es wird auch die Herausforderung von Budgetkürzungen und der Notwendigkeit von Sponsoren erwähnt, um den Bestand an Medien zu erweitern. Trotz des großen Aufwands bei einmaligen Aktionen und Projekten ist der langfristige Erfolg schwer zu beurteilen, der Vorteil liegt jedoch oft in einem positiven Presseecho, welches das Image der Bibliothek stärkt. Die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Leseförderung wird hervorgehoben, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Das Beispiel der Stadtbibliothek Heilbronn verdeutlicht, wie Bibliotheken trotz finanzieller Einschränkungen kreative und effektive Leseförderungsangebote umsetzen können.
III.Herausforderungen und Lösungsansätze für die Leseförderung
Die Studie identifiziert verschiedene Herausforderungen: Frustrationen mit Schultexten, der Einfluss von Fernsehen und elektronischen Medien, sowie unzureichende Leseförderung im Schulsystem. Als Lösungsansätze werden eine Reform des Bildungssystems, verbesserte Lehrerfortbildung und verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken, Schulen und Eltern vorgeschlagen. Die Bedeutung frühkindlicher Leseförderung und die Rolle der Eltern als Vorbilder werden hervorgehoben. Konkrete Beispiele für Leseförderprojekte, wie die Zusammenarbeit der Bertelsmann Stiftung mit Bibliotheken und Schulen in Nordrhein-Westfalen, werden vorgestellt.
1. Frustrationen mit Schultexten und die Hemmung der Lesefreude
Ein Hauptproblem, das im Text angesprochen wird, sind negative Erfahrungen von Schülern mit Schultexten. Laut einer Befragung von Bonfadelli und Saxer findet jeder fünfte Fünfzehnjährige, dass die Schule das Lesen verleidet. Auch bei Erwachsenen wird in Studien häufig Frustration mit Schultexten als Grund für mangelnde Lesegewohnheiten genannt. Die Schüler werden oft mit Texten konfrontiert, die nicht altersgerecht sind oder sie nicht interessieren. Dies führt dazu, dass die Schule nicht nur positive, sondern auch lesefreudehemmende Impulse auslöst. Die Folge ist eine sinkende Lesemotivation und eine Abnahme der Lesekompetenz. Es wird betont, dass das Ziel der Leseförderung nicht nur die Aneignung von Lesestrategien für informative Texte sein sollte, sondern auch die Entwicklung einer positiven Einstellung zum Lesen und einer selbstverständlichen Integration des Lesens in den Alltag.
2. Konkurrenz durch Medien und die Notwendigkeit besonderer Leseförderung
Der Text benennt die Konkurrenz durch Fernsehen und elektronische Medien als eine weitere Herausforderung für die Leseförderung. Obwohl eine Ausweitung des Medienangebots automatisch zu einer Verkürzung der Nutzungszeit anderer Medien führt, benötigt das Lesen besondere Förderung. Dies liegt daran, dass Lesen, selbst bei freiwilliger Nutzung, wichtige Kompetenzen vermittelt und für die sinnvolle Nutzung anderer Medien unerlässlich ist. Studien belegen, dass eine höhere Lesekompetenz zu einer kompetenteren Mediennutzung führt. Trotz der technischen Entwicklungen und neuen Medien ist Lesen eine grundlegende Fähigkeit, doch gleichzeitig nimmt die Zahl der Menschen mit Leseschwierigkeiten zu. Um dem entgegenzuwirken, ist eine gezielte und intensive Leseförderung unabdingbar. Diese Förderung muss die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder berücksichtigen und das Lesen als positive und bereichernde Aktivität präsentieren.
3. Lösungsansätze Reformen im Bildungssystem und die Rolle der Bibliotheken
Um die beschriebenen Probleme zu beheben, werden Reformen des Bildungssystems und Veränderungen in der Lehrerausbildung als notwendig erachtet. Dies ist jedoch keine kurzfristige Lösung. Bibliotheken können hier eine wichtige ergänzende Funktion übernehmen. Sie können Lehrer bei der Auswahl geeigneter Literatur unterstützen und eigene Angebote entwickeln, die auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen eingehen. Für die Förderung der Lesefreude ist dabei die Qualität der Lektüre zunächst zweitrangig. Die Bibliotheken können somit einen wichtigen Beitrag leisten, um die Lesemotivation zu steigern und die Lesekompetenz zu verbessern. Die frühzeitige Entwicklung von Freude am Lesen durch Eltern und das soziale Umfeld spielt dabei eine entscheidende Rolle. Eine kontinuierliche Leseförderung ist notwendig, um nachhaltige Erfolge zu erzielen.
4. Die Bedeutung der Eltern und des familiären Umfelds
Der Text betont die entscheidende Bedeutung der Eltern und des familiären Umfelds für die Entwicklung der Lesekompetenz. Studien belegen immer wieder den starken Einfluss des familiären Hintergrunds auf die Lesefreude und den Lernerfolg. Die Eltern wirken als Vorbilder und Kommunikationspartner. Ihre Unterstützung und ihr Interesse sind essenziell für die Begleitung der schulischen Lernprozesse. Es wird der Einfluss des Elternhauses auf die Sprachentwicklung und den Wortschatz hervorgehoben, der eng mit der Lesekompetenz verknüpft ist. Um die Lesekompetenz zu fördern, ist es daher unerlässlich, die Eltern in die Leseförderung einzubeziehen und sie zu unterstützen. Nur durch eine Zusammenarbeit von Schule, Bibliothek und Familie kann ein nachhaltiger Erfolg im Bereich der Leseförderung erreicht werden.
5. Weitere Lösungsansätze Frühkindliche Förderung und innovative Konzepte
Der Text schlägt weitere Maßnahmen zur Leseförderung vor, wie die stärkere Anbindung von Kindergärten an das Schulsystem und eine frühere Förderung von Kindern. Er betont die Notwendigkeit, dem Kindergarten und der frühkindlichen Erziehung einen höheren Stellenwert einzuräumen. Eine Verbesserung der Ausbildung von Erziehern ist hierfür unerlässlich. Zusätzlich werden innovative Konzepte wie ein Infochat erwähnt, bei dem Bibliothekar*innen Kindern und Jugendlichen per Computer bei der Themenrecherche helfen. Die Bertelsmann Stiftung wird als Beispiel für ein Projekt genannt, das Bibliotheken und Schulen in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung neuer Leseförderungsmaßnahmen unterstützt. Ein nachhaltiger Erfolg setzt eine kontinuierliche Fortführung der Leseförderung im schulischen und familiären Bereich voraus, wie es auch von Georg Braun betont wird. Der Text unterstreicht damit die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der verschiedene Akteure und innovative Methoden verbindet.
IV.Erfolgsfaktoren und Beispiele aus der Praxis Stadtbibliothek Heilbronn
Am Beispiel der Stadtbibliothek Heilbronn werden erfolgreiche Konzepte der Leseförderung vorgestellt. Hierbei spielt die Kooperation mit Kindergärten und Schulen eine zentrale Rolle. Die Bibliothek setzt auf verschiedene Maßnahmen, wie Bilderbuchkino, Themenkisten, Vorlesestunden und Angebote für Eltern und Lehrer. Die Herausforderungen durch Einkommenskürzungen und die Notwendigkeit der Akquise von Sponsoren werden angesprochen. Der Einsatz von Ehrenamtlichen wird als Möglichkeit zur Entlastung des Personals und zur Erweiterung des Angebots diskutiert. Die Lesewoche und das Projekt Schnapp dir ein Buch! der Stiftung Lesen werden als Beispiele erfolgreicher Aktionen genannt. Die Bedeutung einer positiven Lernumgebung und die Berücksichtigung der Interessen der Kinder werden betont. Zusätzliche Informationen: Die Stadtbibliothek Heilbronn konnte durch Verhandlungen und den Einsatz der Bürger die Schließung von Zweigstellen verhindern.
1. Die Stadtbibliothek Heilbronn und die Bewältigung finanzieller Herausforderungen
Die Stadtbibliothek Heilbronn wird als Beispiel für die Herausforderungen und den Umgang mit knappen Ressourcen im Kontext der Leseförderung genannt. Wie andere städtische Einrichtungen wurde sie aufgefordert, Sparvorschläge zu unterbreiten. Die Krise der kommunalen Haushalte wird als „schwerwiegendste der Nachkriegszeit“ beschrieben, mit drastisch sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben. Um die notwendigen Einsparungen zu erreichen, wären weitreichendere Maßnahmen wie die Schließung aller ortsfesten Zweigstellen und der Fahrbibliothek notwendig gewesen. Durch Verhandlungen mit Gemeinderäten und den Einsatz von Bürgern, die sich mit Leserbriefen für den Erhalt der Bibliothek einsetzten, konnte die Schließung verhindert werden. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die Unterstützung der Bevölkerung und der politische Wille für den Erhalt von Bibliotheken und deren Leseförderungsaktivitäten sind, selbst unter schwierigen finanziellen Bedingungen.
2. Kooperation mit Schulen und Kindergärten Ein strategischer Ansatz der Stadtbibliothek Heilbronn
Ein wichtiger Aspekt des Konzepts der Stadtbibliothek Heilbronn ist die starke Kooperation mit Kindergärten und Schulen. Dies wird vor allem im Hinblick auf beschränkte Mittel als wichtiger Ansatz gesehen, um die Leseförderung systematisch und effektiv zu betreiben. Durch die Konzentration auf Kindergärten und Schulen kann die Leseförderung effizienter gestaltet werden. Die Kommunikation mit den Einrichtungen erfolgt ohne großen Werbeaufwand, da die Kontakte zwischen Erzieherinnen und Lehrern die Verbreitung der Angebote unterstützen. Neben der Effizienzsteigerung wirkt sich die Kooperation auch positiv auf das Image der Bibliothek aus. Das Beispiel der verstärkten Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen eines Projekts der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Bibliotheken durch erfolgreiche Kooperationen nicht nur Partner in der Leseförderung, sondern auch wichtige Akteure im Bildungssystem werden können.
3. Konkrete Leseförderungsmaßnahmen der Stadtbibliothek Heilbronn Beispiele und Herausforderungen
Die Stadtbibliothek Heilbronn setzt auf verschiedene Leseförderungsmaßnahmen, darunter Bilderbuchkinos, Themenkisten mit 15-20 Medien, Traumlesestunden mit regelmäßigen Vorlesungen im Kindergarten und die Erweiterung des Fachbuchbestands nach Vorschlägen der Erzieherinnen. Ein weiteres Projekt zielt auf die Sprachförderung von Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache ab. Es werden auch Vorlesepaten in Kindergärten eingesetzt und Fortbildungen für Erzieher organisiert. Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird auf einen geringen Vorbereitungsaufwand geachtet, um die Effizienz zu erhöhen. Die Nutzung bestehender Bilderbuchkinos von anderen Bibliotheken oder Fachstellen wird als Möglichkeit zur Kostensenkung genannt. Ein Kritikpunkt ist die oft geringe Betonung des Buches als Medium. Als Beispiel wird ein Konzept vorgestellt, bei dem Kinder mit ihren Erzieherinnen Bilderbuchpakete abholen und in der Bibliothek auswählen können, um die Nutzung der Bibliothek zu erlernen.
4. Angebote für Eltern und Lehrer Wichtige Zielgruppen in der Leseförderung
Der Text betont die Bedeutung von Angeboten für Eltern und Lehrer als ergänzenden Bestandteil der Leseförderungsarbeit. Eltern haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes zum Leser. Ihre Rolle als Vorbilder und Kommunikationspartner sollte gestärkt werden. Die Bibliothek sollte Eltern durch Ratschläge und Anleitung unterstützen. Aufgrund der berufstätigen Eltern werden späte Nachmittage oder Samstagstermine vorgeschlagen. Für Informationsveranstaltungen sollten Materialien wie Merkblätter mit Tipps und Empfehlungslisten zur Verfügung stehen. Die Organisation solcher Veranstaltungen könnte an einen Förderverein delegiert werden. Der Veranstaltungsort sollte den Zusammenhang zwischen Bibliothek und Leseförderung verdeutlichen. Die räumlichen Gegebenheiten der Bibliothek spielen eine Rolle. In der Heilbronner Kinderbibliothek besteht beispielsweise ein Problem mit der Schaffung von „kuscheligen Leseecken“ in einem großen Raum.
5. Der Einsatz von Ehrenamtlichen und die Lesewoche als Beispiele
Die Stadtbibliothek Heilbronn setzt bereits Ehrenamtliche ein, die bei verschiedenen Aufgaben wie dem Rücksortieren von Medien und der Unterstützung bei Veranstaltungen helfen. Der Einsatz von Ehrenamtlichen kann die Bibliothek entlasten und das Angebot erweitern. Es wird jedoch das Risiko erwähnt, dass die Politik den Einsatz von Ehrenamtlichen als Möglichkeit zur Einsparung von Fachpersonal sehen könnte. Richtig geplant, kann der Einsatz von Freiwilligen jedoch hilfreich sein. Die Lesewoche, die in der Faschingswoche 2003 stattfand, wird als Beispiel für eine einmalige Aktion zur Leseförderung genannt. Die Aktion richtete sich an Kinder aus drei Grundschulen und wurde mit Unterstützung von Musikschule und Theater durchgeführt. Aufgrund des einmaligen Charakters ist der langfristige Erfolg schwer zu beurteilen. Ein großer Vorteil solcher Aktionen ist das positive Presseecho und die Stärkung des Images der Bibliothek in der Öffentlichkeit. Die Aktion 'Schnapp dir ein Buch!' der Stiftung Lesen wird als Beispiel genannt, wie man Kinder durch Beteiligung an der Auswahl von Büchern zum Lesen motivieren kann.
V.Fazit und Ausblick
Zusammenfassend betont die Studie die unerlässliche Bedeutung von Lesekompetenz in einer sich verändernden Medienlandschaft. Eine effektive und nachhaltige Leseförderung erfordert ein gemeinsames Engagement von Schulen, Bibliotheken, Eltern und Politik. Frühkindliche Leseförderung und die Schaffung einer lesefreundlichen Umgebung sind entscheidend für den Erfolg. Die Ergebnisse der Studie sollen dazu beitragen, das deutsche Bildungssystem zu verbessern und die Lesekompetenz der Schüler zu stärken.
1. Zusammenfassende Bewertung der Leseförderungsmaßnahmen
Der Text fasst zusammen, dass Lesen trotz technischer Entwicklungen eine grundlegende Fähigkeit bleibt. Gleichzeitig steigt jedoch der Anteil der Menschen mit Leseschwierigkeiten, weshalb eine Förderung unerlässlich ist. Der Fokus liegt nicht auf internationalen Vergleichen, sondern auf der Möglichkeit für die teilnehmenden Staaten, ihr Bildungssystem anhand der Ergebnisse zu bewerten und Mängel zu identifizieren. Die zyklische Wiederholung der Studien soll die Entwicklung des Bildungssystems beobachten und die Wirksamkeit von Maßnahmen überprüfen. Es wird betont, dass die untersuchten Basiskompetenzen praxisnäher sind als in anderen Studien. Die Ergebnisse zeigen, dass deutsche Schüler nicht nur im internationalen Vergleich schlecht abschneiden, sondern dass auch innerhalb Deutschlands große Kompetenzunterschiede bestehen. Ein hoher Anteil der Jugendlichen zeigt sehr schlechte Leistungen, was den erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung gefährdet. Die Studie hebt hervor, dass diese Schüler erheblich größere Schwierigkeiten beim Lesen haben als ihre Altersgenossen in vielen anderen Ländern.
2. Langfristiger Erfolg von Leseförderprojekten und der Einfluss der Medien
Bei einmaligen Aktionen oder Projekten, die immer andere Kindergruppen ansprechen, ist der langfristige Erfolg schwer zu beurteilen. Der Aufwand für solche Aktionen wird kritisch hinterfragt, obwohl ein positives Presseecho das Image der Bibliothek verbessern kann. Eine kontinuierliche Leseförderung in einer lesefreundlichen Umgebung wird als wichtiger Faktor für den Erfolg hervorgehoben. Die Konkurrenz durch Fernsehen und elektronische Medien wird als Herausforderung genannt, aber auch die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche mit höherer Lesekompetenz diese Medien kompetenter nutzen. Lesekompetenz wird als Grundkompetenz zur sinnvollen Nutzung von AV-Medien und elektronischen Medien bezeichnet. Die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Leseförderung im schulischen und familiären Bereich wird erneut betont, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern spielt dabei eine zentrale Rolle.
3. Ausblick Notwendige Schritte zur Verbesserung der Lesekompetenz
Zusammenfassend wird betont, dass Lesen trotz neuer Medien eine grundlegende Fähigkeit bleibt. Die steigende Anzahl von Menschen mit Leseschwierigkeiten erfordert eine dringende und umfassende Förderung. Erfolgreiche Leseförderung benötigt ein gemeinsames Engagement von Schulen, Bibliotheken, Eltern und Politik. Frühkindliche Leseförderung und eine lesefreundliche Umgebung sind entscheidend. Die Ergebnisse der Studie sollen zur Verbesserung des deutschen Bildungssystems beitragen und die Lesekompetenz der Schüler stärken. Die Studie selbst dient nicht primär dem internationalen Vergleich, sondern der Selbstevaluation der teilnehmenden Staaten. Die Bedeutung der kontinuierlichen Fortführung von Lesefördermaßnahmen in Schule und Familie wird als entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg hervorgehoben. Eine effektive Leseförderung muss die individuellen Bedürfnisse und den Kontext der Kinder berücksichtigen.
