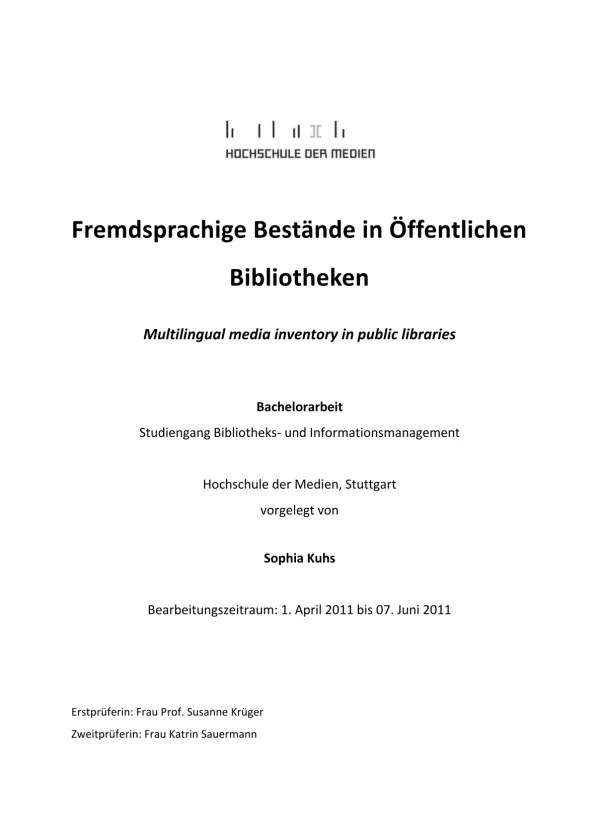
Fremdsprachige Medien in Bibliotheken
Dokumentinformationen
| Autor | Sophia Kuhs |
| Schule | Hochschule der Medien, Stuttgart |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Informationsmanagement |
| Dokumenttyp | Bachelorarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 3.28 MB |
Zusammenfassung
I.Fremdsprachige Medienbestände in Öffentlichen Bibliotheken Deutschlands Eine Bestandsaufnahme
Diese Studie untersucht den Bestand an fremdsprachigen Medien in deutschen öffentlichen Bibliotheken. Die Ergebnisse zeigen einen insgesamt geringen Anteil dieser Medien am Gesamtbestand, wobei Englisch, Französisch und Spanisch dominieren. Migranten-Herkunftssprachen wie Türkisch, Russisch und Polnisch sind zwar vertreten, jedoch oft nur in einigen wenigen Städten konzentriert. Die Studie analysiert die Finanzierung dieser Bestände, die oft nur unzureichend ist und auf Drittmittel angewiesen ist. Die Katalogisierung und Recherche dieser Medien stellen weitere Herausforderungen dar, da viele Bibliotheksysteme nicht-lateinische Schriften nur unzureichend unterstützen. Die Studie empfiehlt eine verstärkte Kooperation zwischen Bibliotheken und den Ausbau von Unterstützungsangeboten zum Erwerb und zur Pflege fremdsprachiger Medienbestände.
1. Gesamtbestand und Verteilung fremdsprachiger Medien
Die Studie untersucht den Anteil fremdsprachiger Medien im Gesamtbestand deutscher öffentlicher Bibliotheken. Die Ergebnisse zeigen einen überraschend niedrigen Anteil, obwohl in nahezu allen befragten Bibliotheken fremdsprachige Medien vorhanden sind. Englisch, Französisch und Spanisch dominieren deutlich den Bestand. Medien in anderen Sprachen, insbesondere in den Herkunftssprachen von Migrantengruppen, sind vergleichsweise selten. Nur die Sprachen der drei größten Migrantengruppen in Deutschland (Türkisch, Russisch und Polnisch) weisen einen nennenswerten Anteil auf, wobei diese Bestände oft auf einzelne Städte konzentriert sind. Die Daten wurden statistisch ausgewertet, um mögliche Ursachen und Einflussfaktoren zu identifizieren. Die Untersuchung legt nahe, dass die Bereitstellung fremdsprachiger Medien nicht immer an fehlenden finanziellen Mitteln scheitert, sondern auch an der Priorisierung durch die einzelnen Bibliotheken. Die geringe Repräsentation von Migranten-Herkunftssprachen ist ein zentrales Ergebnis, das weitere Untersuchungen erfordert.
2. Finanzierungslage und Bezugsquellen fremdsprachiger Medien
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie liegt auf der Finanzierung und den Bezugsquellen fremdsprachiger Medien. Es zeigt sich, dass die Finanzierung oft nur punktuell und zeitlich begrenzt ist. Viele Bibliotheken finanzieren ihre fremdsprachigen Medienbestände aus dem laufenden Bibliotheksbudget, sind aber auf zusätzliche Drittmittel wie Spenden oder Fördergelder angewiesen. Etwa 43% der Bibliotheken verfügen zwar über einen separaten Etat für den Erwerb fremdsprachiger Medien, dieser ist jedoch oft sehr gering (bis zu 3.000 Euro). Die wichtigsten Bezugsquellen sind der Buchhandel und die ekz (einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken), wobei die Auswahl insbesondere bei kleineren Migranten-Herkunftssprachen stark eingeschränkt ist. Schenkungen spielen eine bedeutende Rolle, bergen aber auch Risiken hinsichtlich der Qualität und der Relevanz für die Zielgruppe. Die Studie hebt die Schwierigkeit beim Aufbau von Beständen in weniger verbreiteten Sprachen hervor und betont die Notwendigkeit alternativer Bezugsquellen und Strategien.
3. Katalogisierung und Recherche fremdsprachiger Medien
Die Studie beleuchtet die Herausforderungen bei der Katalogisierung und Recherche von fremdsprachigen Medien. Viele Bibliotheksysteme können nicht-lateinische Schriften nicht oder nur unzureichend in ihren Online-Katalogen darstellen. Dies erschwert die Recherche für Muttersprachler dieser Sprachen erheblich. Die meisten Bibliotheken verfügen nicht über das Personal, um Medien in nicht-lateinischer Schrift selbstständig zu erschließen. Im Gegensatz zu anderen Ländern fehlen in Deutschland zentrale Dienstleister für die Transkription bibliographischer Informationen. Die IFLA-Richtlinien schreiben die Katalogisierung in der Ursprungssprache und -schrift vor, was die meisten Bibliotheken jedoch nicht erfüllen können, was dazu führt, dass nur kurze oder gar keine Katalogdatensätze vorhanden sind. Die Studie betont die Notwendigkeit von technischen und personellen Verbesserungen, um die Recherche von fremdsprachigen Medien zu gewährleisten und den Zugang für die Zielgruppen zu verbessern.
4. Unterstützungsangebote und Kooperationen
Die Studie bewertet verschiedene Unterstützungsangebote für den Erwerb und die Pflege fremdsprachiger Medienbestände. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedürfnisse der Bibliotheken sehr unterschiedlich sind, was auf unterschiedliche Rahmenbedingungen und Erfahrungswerte zurückzuführen ist. Während einige Bibliotheken bereits gut funktionierende Netzwerke aufgebaut haben, stehen andere erst am Anfang des Aufbaus fremdsprachiger Bestände. Die Untersuchung zeigt, dass trotz bestehender Unterstützungsangebote wie annotierte Angebotslisten oder die Mailingliste ÖB_Multikulturell, viele Bibliotheken den einfachen Weg über die ekz bevorzugen und auf aktive Kooperation und den Ausbau von Netzwerken verzichten. Die Studie betont die Notwendigkeit einer verstärkten interbibliothekarischen Kooperation, um Ressourcen und Wissen zu bündeln und den Aufbau und die Pflege fremdsprachiger Medienbestände effektiv zu gestalten. Die Ergebnisse zeigen einen Mangel an bundesweiten, koordinierten Strategien.
II.Besondere Herausforderungen beim Aufbau fremdsprachiger Bestände
Der Aufbau von fremdsprachigen Medienbeständen in deutschen öffentlichen Bibliotheken wird durch verschiedene Faktoren erschwert. Die Studie zeigt, dass die Finanzierung oft nur unzureichend und projektbezogen ist. Ein Mangel an nationalen Regelungen und ein fehlendes Bibliotheksgesetz erschweren die dauerhafte Sicherung und den Ausbau der Medienbestände. Die Kooperation zwischen Bibliotheken ist schwach ausgeprägt, was den Austausch von Wissen und Ressourcen behindert. Die Zielgruppenanalyse ist oft unzureichend, was zu einer nicht zielgerichteten Anschaffung von Medien führt. Der Erwerb von Medien in kleineren Migranten-Herkunftssprachen ist besonders schwierig, da der Buchhandel und die ekz hier nur ein eingeschränktes Angebot vorhalten. Die technische Katalogisierung von Medien in nicht-lateinischer Schrift stellt eine weitere Hürde dar. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten Kooperation, um Ressourcen zu bündeln und den Bestandsaufbau zu optimieren.
1. Mangelnde Finanzierung und Ressourcen
Ein zentrales Problem beim Aufbau fremdsprachiger Medienbestände ist die unzureichende Finanzierung. Die Mittel sind oft projektgebunden und zeitlich begrenzt, was einen kontinuierlichen Ausbau erschwert. Viele Bibliotheken greifen auf ihren regulären Etat zurück, was die Anschaffung fremdsprachiger Medien oft einschränkt. Zusätzliche Drittmittel, wie Spenden oder Fördergelder, sind zwar möglich (Sauermann 2009), aber nicht verlässlich. Die Höhe der Etats für fremdsprachige Medien ist im Vergleich zum Gesamtmedienbudget sehr gering (unter 5% in den meisten Fällen). Die Aufrechterhaltung aktueller und attraktiver Bestände gestaltet sich daher als große Herausforderung. Die Abhängigkeit von zufälligen finanziellen Mitteln und die unzureichende finanzielle Ausstattung stellen somit eine signifikante Hürde für den Ausbau der fremdsprachigen Angebote dar.
2. Defizite in der Kooperation und Vernetzung
Die mangelnde Kooperation und Vernetzung zwischen den Bibliotheken behindert den Aufbau fremdsprachiger Bestände. Es fehlt an einem übergreifenden Konzept, Projekte werden punktuell und unkoordiniert umgesetzt (Krüger 2007). Der Austausch von Informationen über Auswahl, Erwerb und Katalogisierung findet nur unzureichend statt. Obwohl Plattformen wie ÖB_Multikulturell existieren, nutzen diese nur wenige Bibliotheken aktiv für den Informationsaustausch oder die Kooperation beim Erwerb von Medien. Der Austausch von Bestellunterlagen wird von keiner der befragten Bibliotheken als gängige Praxis genannt. Die Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen (Stadtverwaltung, VHS etc.) wird zwar als wichtig erachtet, um Zielgruppen zu erreichen und Finanzierungen zu unterstützen, aber auch hier mangelt es oft an systematischer Zusammenarbeit. Eine verstärkte Kooperation ist daher entscheidend für den effizienten Aufbau und die Pflege fremdsprachiger Medienbestände.
3. Herausforderungen bei der Katalogisierung und Erschließung
Die Erschließung fremdsprachiger Medien stellt eine weitere große Herausforderung dar. Viele Bibliotheksysteme ermöglichen die Darstellung aller relevanten Sprachen und Schriften in den Online-Katalogen nicht (Pirsich 2010). Dies erschwert die Recherche, insbesondere für Nutzer mit nicht-lateinischen Schriften. Die selbstständige Erschließung von Medien in nicht-lateinischer Schrift ist für die meisten Bibliotheken nicht möglich. Im Gegensatz zu anderen Ländern fehlen in Deutschland zentrale Dienstleister, die Bibliotheken bei der Katalogisierung unterstützen. Die IFLA-Richtlinien fordern die Katalogisierung in der Ursprungssprache und -schrift, was aufgrund fehlenden Personals mit entsprechenden Sprachkenntnissen oft nicht realisierbar ist. Die Konsequenz sind oft unvollständige oder fehlende Katalogdatensätze, was den Zugang zu den Medien für die Zielgruppen stark einschränkt. Eine Verbesserung der technischen Ausstattung und die Bereitstellung von qualifiziertem Personal sind daher dringend erforderlich.
4. Mangelnde Zielgruppenorientierung und unzureichende Unterstützungsangebote
Die Anschaffung fremdsprachiger Medien erfolgt oft nicht zielgruppenorientiert, sondern orientiert sich an den Angeboten der ekz und des Buchhandels. Die begrenzte Auswahl bei den Migranten-Herkunftssprachen führt zu einer unzureichenden Abdeckung der tatsächlichen Bedürfnisse. Obwohl es verschiedene Unterstützungsangebote gibt (annotierte Angebotslisten, Standing-Order-Angebote etc.), werden diese von einem Großteil der Bibliotheken nicht ausreichend genutzt. Viele Bibliotheken bevorzugen den einfachen Weg über die ekz, anstatt zusätzliche Anstrengungen zur Kooperation oder zur Suche nach muttersprachlichen Kontaktpersonen zu unternehmen. Regelmäßige Zielgruppenanalysen sind notwendig, um den tatsächlichen Bedarf an fremdsprachigen Medien zu ermitteln und eine gezielte Anschaffung zu ermöglichen. Die unzureichende Nutzung von bestehenden Unterstützungsangeboten und die mangelnde Zielgruppenorientierung behindern einen effektiven Aufbau fremdsprachiger Bestände. Eine Verbesserung der bestehenden Angebote und eine Sensibilisierung der Bibliotheken sind notwendig.
III.Ergebnisse der empirischen Untersuchung zum Medienbestand
Die empirische Untersuchung umfasste ca. 70% der öffentlichen Bibliotheken in Städten mit über 50.000 Einwohnern. Der Anteil fremdsprachiger Medien am Gesamtbestand ist in allen Bibliotheken sehr gering (unter 5%). Englisch, Französisch und Spanisch sind am häufigsten vertreten. Migranten-Herkunftssprachen wie Türkisch, Russisch und Polnisch zeigen einen höheren Anteil, jedoch mit regionaler Konzentration. Die Studie analysiert die Finanzierung der Medienbestände, wobei fast 70% der Bibliotheken einen hohen Gesamtbudget aufweisen, der fremdsprachige Medienbestand aber dennoch sehr klein ist. Viele Bibliotheken nutzen Schenkungen, was die Qualität der Medienbestände beeinflussen kann. Die Studie hebt die Diskrepanz zwischen vorhandenen Budgets und dem geringen Anteil an fremdsprachigen Medien hervor, was auf mangelnde Priorisierung durch die Bibliotheken hinweist. Die ekz und der Buchhandel sind die Hauptbezugsquellen, was die Auswahl an Migranten-Herkunftssprachen einschränkt.
1. Gesamtbestand an fremdsprachigen Medien
Die Studie basiert auf einer Umfrage in öffentlichen Bibliotheken Deutschlands mit über 50.000 Einwohnern. Der Anteil fremdsprachiger Medien am Gesamtbestand ist mit unter 5% in allen Bibliotheken sehr gering. Die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch dominieren deutlich, während Medien in anderen Sprachen, insbesondere den Herkunftssprachen von Migrantengruppen, nur einen geringen Anteil ausmachen. Nur Türkisch, Russisch und Polnisch als Sprachen der drei größten Migrantengruppen in Deutschland sind nennenswert vertreten, jedoch häufig konzentriert auf einzelne Bibliotheken in bestimmten Städten. Die regionale Verteilung der teilnehmenden Bibliotheken ist ungleichmäßig, mit einer Überrepräsentation von Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Bibliotheken aus Rheinland-Pfalz nahmen gar nicht an der Umfrage teil. Selbst in Bibliotheken mit einem vergleichsweise hohen Anteil fremdsprachiger Medien übersteigt dieser maximal 8-10% des Gesamtbestands. Diese Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit eines verstärkten Fokus auf den Ausbau fremdsprachiger Medienbestände.
2. Sprachliche Verteilung der Medienbestände
Die Umfrage erfasste Medienbestände in insgesamt 32 Sprachen. Bei Medien für Erwachsene zeigen sich die größten Bestände erwartungsgemäß in den Weltsprachen Englisch (85%), Französisch (82%) und Spanisch (77%). Russisch folgt mit 72%, danach Italienisch (65%) und Türkisch (62%). Die Bestände in anderen Sprachen, wie z.B. Polnisch, Griechisch, Arabisch oder Portugiesisch, sind deutlich geringer. Sprachen wie Hindi, Thai und Tigrinya wurden in keiner der befragten Bibliotheken nachgewiesen. Bei Medien für Kinder und Jugendliche zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die Herkunftssprachen der drei größten Migrantengruppen (Türkisch, Russisch, Polnisch) einen ähnlich hohen Anteil wie bei den Medien für Erwachsene aufweisen. Der geringe Bestand in vielen anderen Sprachen deutet auf eine eher zufällige Entstehung dieser Bestände hin, z.B. durch Schenkungen oder lokale Initiativen. Das Beispiel der Bücherhallen Hamburg mit dem Projekt „Window of Shanghai“ veranschaulicht den Aufbau eines attraktiven Bestands durch Kooperationen und Schenkungen.
3. Finanzierung und Erwerb fremdsprachiger Medien
Die Ergebnisse zur Finanzierung zeigen, dass fast 70% der teilnehmenden Bibliotheken über einen hohen Gesamtmedienetat verfügen (90.000 bis über 500.000 Euro). Trotzdem ist der Anteil der Mittel, die für den Erwerb fremdsprachiger Medien eingesetzt werden, mit unter 5% des Gesamtetats sehr gering. Nur 43% der Bibliotheken gaben einen separaten Etat für fremdsprachige Medien an, wobei dieser bei über der Hälfte (23%) lediglich bis zu 3.000 Euro umfasst. Die wichtigsten Bezugsquellen für fremdsprachige Medien sind der Buchhandel und die ekz, wobei Schenkungen für fast zwei Drittel der Bibliotheken eine gängige Bezugsquelle darstellen. Der Erwerb von Medien in kleineren Migranten-Herkunftssprachen gestaltet sich schwierig, da das Angebot des Buchhandels und der ekz hier sehr begrenzt ist. Die Bibliotheken orientieren sich daher oft am bestehenden Angebot, anstatt die Bedürfnisse der Nutzer gezielt zu berücksichtigen (Atlestam; Myhre 2010). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die unzureichende Finanzierung und die begrenzten Auswahlmöglichkeiten beim Erwerb der Medien den Ausbau fremdsprachiger Bestände stark behindern.
IV.Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation
Die Studie identifiziert den dringenden Bedarf an Verbesserungen in der Versorgung mit fremdsprachigen Medienbeständen. Wichtige Punkte sind die verstärkte Kooperation zwischen Bibliotheken zum Austausch von Wissen und Ressourcen, Verbesserung der Finanzierung und die Entwicklung zielgruppenorientierter Konzepte für den Bestandsaufbau. Die Verbesserung der technischen Möglichkeiten zur Katalogisierung von Medien in nicht-lateinischen Schriften ist ebenfalls essentiell, um die Recherche zu erleichtern. Die Studie plädiert für regelmäßige periodische Erhebungen, um die Entwicklung der fremdsprachigen Medienbestände zu verfolgen und einen konstruktiven Wettbewerb anzuregen. Der Fokus sollte dabei sowohl auf quantitativen als auch qualitativen Aspekten liegen.
1. Stärkere Finanzierung und nachhaltige Strategien
Die Studie zeigt deutlich, dass eine verbesserte Finanzierung von entscheidender Bedeutung für den Ausbau fremdsprachiger Medienbestände ist. Obwohl viele Bibliotheken über hohe Gesamtetats verfügen, wird ein nur sehr geringer Teil davon für fremdsprachige Medien verwendet. Es braucht daher eine gezieltere und nachhaltigere Finanzierung, die nicht nur punktuelle Projekte, sondern einen kontinuierlichen Aufbau ermöglicht. Die Abhängigkeit von unsicheren Drittmitteln sollte reduziert werden. Langfristige Strategien zur Medienanschaffung sind unerlässlich, um den Bestand aktuell und attraktiv zu halten und die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen zu erfüllen. Es muss sichergestellt werden, dass die Bereitstellung fremdsprachiger Medien als integraler Bestandteil der bibliothekarischen Arbeit verstanden und entsprechend priorisiert wird.
2. Förderung der Kooperation und des Informationsaustauschs
Eine verstärkte Kooperation zwischen den Bibliotheken ist essentiell für den Erfolg. Derzeit mangelt es an einem bundesweiten, koordinierten Konzept. Der Austausch von Informationen über Auswahl, Erwerb, Katalogisierung und Pflege fremdsprachiger Medien ist unzureichend. Die Studie empfiehlt die verstärkte Nutzung bestehender Plattformen wie ÖB_Multikulturell und den aktiven Austausch von Bestellunterlagen. Die Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen, Vereinen und anderen Kooperationspartnern sollte ausgebaut werden, um Zielgruppen zu erreichen und die Finanzierung zu sichern. Eine stärkere Vernetzung der Bibliotheken ermöglicht es, Ressourcen zu bündeln, Synergien zu nutzen und das Know-how im Bereich der interkulturellen Bibliotheksarbeit zu teilen. Das Ziel ist ein gemeinsames Netzwerk, das den Aufbau und die Pflege fremdsprachiger Bestände effizienter gestaltet.
3. Verbesserung der technischen und personellen Ressourcen
Die technische Ausstattung der Bibliotheken muss verbessert werden, um die Erschließung und Recherche fremdsprachiger Medien zu erleichtern. Viele Systeme unterstützen nicht-lateinische Schriften nicht ausreichend, was den Zugang für Muttersprachler dieser Sprachen behindert (Pirsich 2010). Die Bibliotheken benötigen mehr Personal mit entsprechenden Sprachkenntnissen für die Katalogisierung und Erschließung von Medien in nicht-lateinischen Schriften. Die Implementierung von Transkriptionsdiensten könnte hier unterstützen, analog zu den Verfahren in anderen Ländern (Larsen u.a. 2004). Die Einhaltung der IFLA-Richtlinien zur Katalogisierung in der Ursprungssprache und -schrift erfordert eine entsprechende technische und personelle Ausstattung. Investitionen in diese Bereiche sind notwendig, um den Zugang zu den vorhandenen Beständen für alle Nutzergruppen zu gewährleisten.
4. Regelmäßige Erhebungen und qualitative Auswertungen
Um die Entwicklung der fremdsprachigen Medienbestände langfristig zu verfolgen und den Fortschritt zu messen, werden regelmäßige periodische Erhebungen empfohlen. Diese ermöglichen es, einen realistischen Eindruck über die Ausstattung der Bibliotheken zu gewinnen und einen Anreiz für den Ausbau der Bestände zu schaffen. Zukünftige Erhebungen sollten neben quantitativen Daten auch qualitative Aspekte berücksichtigen, um ein detaillierteres Bild über die Zusammensetzung und die inhaltliche Ausrichtung der Bestände zu erhalten. Nur durch eine umfassende Erfassung der Bestände kann die Möglichkeit einer kooperativen Nutzung von fremdsprachigen Medien bundesweit verbessert werden. Die Integration qualitativer Fragestellungen ermöglicht zudem eine differenziertere Analyse der Bedürfnisse der Zielgruppen und eine effektivere Anpassung der Medienangebote.
