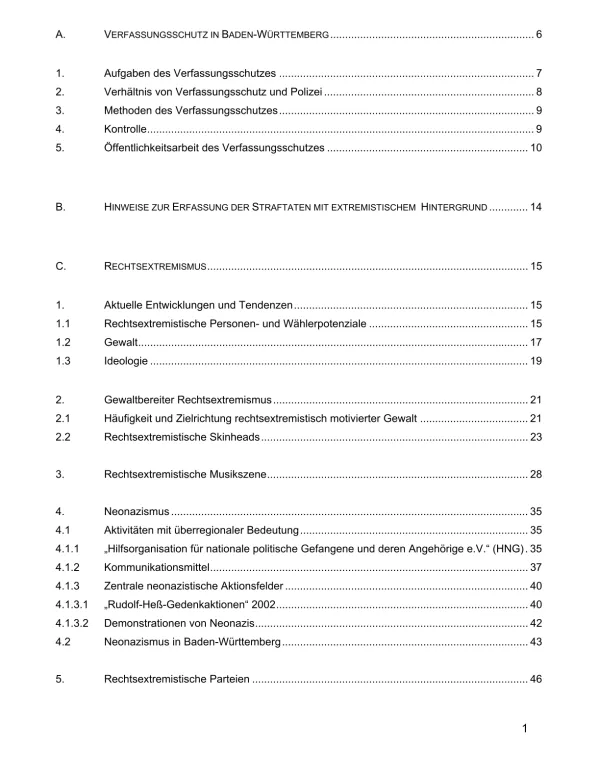
Rechtsextremismus BW: Analyse & Fakten
Dokumentinformationen
| Autor | Ministerium Des Inneren Baden-Württemberg |
| Fachrichtung | Staatswissenschaften, Sicherheitspolitik, Rechtswissenschaften |
| Unternehmen | Ministerium des Inneren Baden-Württemberg |
| Dokumenttyp | Verfassungsschutzbericht |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 3.70 MB |
Zusammenfassung
I.Rechtsextremismus in Baden Württemberg 2002
Der Bericht dokumentiert die Aktivitäten von Rechtsextremisten in Baden-Württemberg im Jahr 2002. Ein tief verwurzelter Glaube an einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel und ein vermeintlicher „Rechtstrend“ in Europa prägten die Szene. Die enttäuschende Bundestagswahl 2002 erschütterte diese Hoffnungen. Neonazistische Organisationen existierten zwar nicht mehr offiziell, doch lose Zusammenschlüsse wie „Kameradschaften“ und „Freundeskreise“ blieben aktiv, organisierten Demonstrationen (z.B. zu Themen wie der Wehrmachtsausstellung und Rudolf Heß) und nutzten das Internet zur Kommunikation. Die Skinheadszene stellte ein wichtiges Mobilisierungspotential dar, mit Bands wie „Blutrausch“ und „Landser“, die mit volksverhetzenden Texten und Aufrufen zur Gewalt auffielen. Der Fall Rennicke und dessen Verurteilung wegen Volksverhetzung zeigte die anhaltende Problematik. Internationale Verflechtungen, insbesondere mit der Schweiz und Österreich, waren ebenfalls präsent.
1. Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen des Rechtsextremismus
Im Jahr 2002 glaubte ein Großteil der deutschen Rechtsextremisten an eine Trendwende des Zeitgeistes und einen bevorstehenden Paradigmenwechsel. Sie interpretierten die öffentliche Debatte um Vertreibung und Antisemitismus von 2002, sowie die Diskussion um alliierte Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg als Bestätigung ihrer Thesen. Hinzu kam die Hoffnung, dass ein in einigen europäischen Nachbarländern (Niederlande, Frankreich, Dänemark) beobachteter Rechtstrend sich auch auf Deutschland ausweiten und die politische Landschaft beeinflussen würde. Die Bundestagswahl am 22. September 2002, die für rechtsextreme Parteien enttäuschend verlief, dürfte diese Hoffnungen jedoch erheblich geschwächt haben. Gleichzeitig unterstreichen Studien des Bundesministeriums des Innern (veröffentlicht Anfang 2002) und der Universität Leipzig (Sommer 2001 und April 2002) einen starken Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und rechtsextremen Einstellungen. Personen mit höherer Schulbildung zeigten eine deutlich geringere Tendenz zu fremdenfeindlichen Straftaten. Das Landesamt für Verfassungsschutz engagierte sich verstärkt in der geistig-politischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus an Schulen.
2. Gewaltdelikte und Rechtsextremismus
Der Bericht dokumentiert mehrere Gewaltdelikte mit rechtsextremistischem Hintergrund. Ein besonders brutaler Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 18. auf den 19. August 2002 in einer Regionalbahn zwischen Backnang und Murrhardt. Mehrere Skinheads verletzten und beraubten einen Inder, wobei sie ihn mit einem Messer bedrohten und seinen Bart anzündeten. Das Amtsgericht Waiblingen verurteilte die Haupttäter zu Freiheitsstrafen von 18 Monaten, Mittäter erhielten zwölf Monate auf Bewährung beziehungsweise Jugendstrafe. Ein weiterer Fall betraf eine Auseinandersetzung in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Verurteilung von Rennicke wegen Volksverhetzung im Jahr 2000 führte im März 2002 zu einer Solidaritätsdemonstration von ca. 200 Rechtsextremisten in Ludwigsburg. Im Oktober 2002 wurde Rennicke in der Berufungsverhandlung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung verurteilt, zudem wurde der Verfall von 70.450 DM (36.021 Euro) angeordnet.
3. Rolle der Skinheadszene und Neonazistische Musik
Die deutsche Skinheadszene spielte 2002 eine verstärkt Rolle bei neonazistischen Demonstrationen. Ihre erlebnis- und aktionsorientierte Natur macht sie zu einem wichtigen Mobilisierungspotential für Neonazis. Die Texte rechtsextremer Skinheadbands wie "Blutrausch" (Wehr/Kreis Waldshut), "Keltensturm" (Tuttlingen), "Kampfgeist" (Enzkreis) und "Carpe Diem" (Esslingen) thematisierten die Ideologie der Szene und hetzten gegen Ausländer, Juden, Homosexuelle, Dealer, Obdachlose, Presse und den Verfassungsschutz. Oftmals wurden Gewaltverherrlichung und Aufrufe zu Straftaten propagiert. Die Band "Landser" war besonders berüchtigt für ihre Texte, die zu schweren Straftaten wie Brandstiftung und Mord aufriefen. Gegen die Bandmitglieder ermittelt seit Oktober 2001 der Generalbundesanwalt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung; im September 2002 wurde Anklage erhoben.
4. Neonazistische Strukturen und Kommunikation
Nach den Organisationsverboten der 90er Jahre existierten in Baden-Württemberg 2002 keine formellen neonazistischen Organisationen mehr. Stattdessen bildeten sich lose, hierarchisch strukturierte Zusammenschlüsse wie "Freundeskreise" und "Kameradschaften". Diese Gruppen trafen sich zu internen Veranstaltungen, Rechtsschulungen und öffentlichen Auftritten unter Bezeichnungen wie "Nationaler Widerstand" oder "Freie Nationalisten". Sie organisierten eigene Demonstrationen oder beteiligten sich an bundesweiten Aktionen. Die Kommunikation erfolgte überwiegend informell und konspirativ über das Internet, E-Mail, Handys und SMS, um einen hohen Geheimhaltungsgrad zu gewährleisten. Die "Kameradschaft Karlsruhe", seit zehn Jahren aktiv, betrieb seit dem 15. Januar 2002 eine eigene Homepage, die Informationen über NIT-Ansagen und Demonstrationstermine bereitstellte.
5. Situation der NPD und Versuche der Zusammenarbeit im rechten Lager
Die NPD war 2002 stark vom im März 2003 eingestellten Verbotsverfahren beeinflusst. Die Aufdeckung von V-Leuten im Verfassungsschutz führte zu Unsicherheit und gegenseitigen Denunziationen. Der Bundesvorsitzende Udo Voigt appellierte an die Delegierten des Bundesparteitags (16./17. März 2002) zur Vermeidung von Streitigkeiten. Trotzdem bewertete Voigt die Situation als insgesamt optimistisch und hob die verbesserte Medienberichterstattung hervor. Der "Cannstatter Kreis e.V." (CK), gegründet in Stuttgart-Bad Cannstatt, versuchte ab 1997 die Zusammenarbeit im rechten Lager zu fördern. Der CK hatte jedoch nur ca. 50 Mitglieder und meldete im Sommer 2002 Insolvenz an, kündigte aber im November 2002 die Gründung eines neuen Vereins an. Ähnlich war die Situation beim FHD und der DLVH, die auf ihren Parteistatus verzichtete, ohne dadurch eine größere Akzeptanz zu erreichen.
6. Internationale Verflechtungen
Rechtsextremisten in Baden-Württemberg pflegten intensive Beziehungen zu Gleichgesinnten im Ausland, insbesondere in der Schweiz und Österreich aufgrund der geografischen Nähe und fehlender historischer Belastung. Großdeutsch orientierte Rechtsextremisten betrachteten Österreicher und deutschsprachige Schweizer als Volksgenossen. Verbindungen bestanden auch nach Frankreich (als Erbfeind betrachtet), Italien, Großbritannien, den USA und Kanada. Baden-württembergische Skinheads unterhielten Kontakte ins Ausland.
II.Linksextremismus in Baden Württemberg 2002
Der Bericht analysiert den Linksextremismus in Baden-Württemberg im Jahr 2002. Die Anschläge vom 11. September 2001 und der anschließende Afghanistan-Krieg prägten die Szene stark. Die PDS, die MLPD, die DKP und die VVN-BdA interpretierten die Ereignisse als imperialistische Kriegspolitik der USA, wobei der Kampf um Öl im Mittelpunkt stand. Die Debatte um den Nahost-Konflikt und den Antisemitismus führte zu innerer Spaltung, insbesondere bezüglich der Solidarität mit Israel oder Palästina. Es gab Proteste gegen den Krieg und Militarismus (z.B. Demonstrationen in Heidelberg, Mannheim und Konstanz), aber auch Auseinandersetzungen über die Rolle des Staates und die Innere Sicherheit. Die Nutzung des Internets und der Fokus auf die Verschlüsselung und Steganographie zur sicheren Kommunikation wurden ebenfalls thematisiert. Die Antifaschistische Initiative Heidelberg (AIHD) organisierte Demonstrationen gegen Überwachung und Polizeistaat. Die Akzeptanz von Linksextremisten in globalisierungskritischen Bündnissen, wie dem „Social Forum Tübingen/Reutlingen“, wurde ebenfalls analysiert.
1. Auswirkungen der Anschläge vom 11. September 2001 und der daraus resultierenden politischen Entwicklungen
Die Anschläge vom 11. September 2001 und der darauffolgende Afghanistan-Krieg dominierten die politische Landschaft und beeinflussten maßgeblich die linksextremistische Szene in Baden-Württemberg im Jahr 2002. Die Ereignisse wurden von Parteien wie der PDS, der MLPD, der DKP und Organisationen wie der VVN-BdA weitgehend als imperialistische Kriegspolitik der USA interpretiert, wobei der Kampf um Öl als zentrales Motiv gesehen wurde. Diese Interpretation führte zu einer intensiven Debatte innerhalb der Szene, die andere politische Aktivitäten weitgehend überschattete. Die eskalierende Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern verschärfte die Lage zusätzlich und löste kontroverse Diskussionen über Solidarität mit den jeweiligen Konfliktparteien aus, was zu innerer Uneinigkeit führte. Die Frage nach dem Umgang mit dem Antisemitismus und der eigenen Positionierung zum Nahost-Konflikt bildeten einen zentralen Konfliktpunkt.
2. Politische Aktivitäten und Demonstrationen
Im Jahr 2002 fanden in Baden-Württemberg verschiedene Protestaktionen und Demonstrationen statt, die sich gegen die Kriegspolitik der USA und den vermeintlichen Abbau bürgerlicher Rechte in Deutschland richteten. Beispiele hierfür sind Demonstrationen am 22. Mai 2002 in Heidelberg und Mannheim, sowie eine Kundgebung in Konstanz am 23. Mai. Das "Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg" veranstaltete eine Diskussion zum Thema "Kriegsopfer Demokratie". Ein Aufruf zu bundesweiten Aktionstagen gegen Krieg und Militarismus am 31. Mai und 1. Juni 2002 fand in Baden-Württemberg jedoch nur wenig Resonanz. Bessere Beteiligung gab es hingegen beim globalen Aktionstag gegen einen möglichen Irak-Krieg am 26. Oktober 2002. Die MLPD führte unter dem Motto "Aktiver Widerstand gegen Bushs 'New War'" Antikriegsdemonstrationen in verschiedenen Städten Baden-Württembergs durch. Die Partei plädierte bei der Bundestagswahl für einen aktiven Wahlboykott.
3. Innerparteiliche Entwicklungen und die Rolle der PDS
Die PDS erlebte im Jahr 2002 nach hohen Stimmenverlusten bei Landtagswahlen eine verheerende Wahlniederlage bei der Bundestagswahl. Als Ursachen wurden ein von der Basis abgehobenes "Eigenleben" der Reformerriege an der Parteispitze, Rücktritte und Affären (Gregor Gysi, Helmut Holter) genannt. Ein entscheidender Faktor war das Eingeständnis, der SPD in Koalitionsregierungen auf Landesebene weitgehend das Handeln überlassen zu haben, ohne ein eigenes klares politisches Konzept zu vertreten. Die Parteitagung in Gera im Oktober 2002 führte zu personellen Veränderungen im Bundesvorstand. Gabi Zimmer wurde als Parteivorsitzende bestätigt und setzte sich mit ihrer Konzeption der "gestaltenden Opposition" durch, welche die Kombination von Protest und Mitregieren anstrebte. Die bundesweite Ausdehnung der Partei sollte beibehalten werden, wobei ein sozialdemokratischer oder kommunistischer Charakter vermieden werden sollte.
4. Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und das Thema Antifaschismus
Linksextremistische und linksextremistisch beeinflusste Parteien und Organisationen wie die MLPD, DKP, VVN-BdA und PDS sahen im Kampf um Öl das wahre Motiv für das Handeln der USA. Sie betonten die Notwendigkeit eines breiten antifaschistischen Bündnisses und betonten die Zusammenarbeit mit autonomen Gruppen und lokalen Antifa-Initiativen. Die Grußadresse der AG Antifa in der Revolutionären Aktion Stuttgart an die VVN-BdA unterstrich die gute Zusammenarbeit trotz bestehender Kontroversen. Die VVN-BdA arbeitete mit linksextremistisch beeinflussten, aber auch demokratischen Organisationen zusammen. Der Antifaschismus wurde im Laufe des Jahres 2002 von den Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 überlagert. Die Szene war sich weitgehend einig, dass die Anschläge ein Vorwand für einen bereits geplanten Krieg waren, um von der kapitalistischen Überproduktionskrise abzulenken und den Demokratieabbau voranzutreiben.
5. Der Nahost Konflikt und die Debatte um den Antisemitismus
Der Nahost-Konflikt und die damit verbundene Antisemitismusdebatte führten zu einer tiefgreifenden Spaltung innerhalb der linksextremistischen Szene. Während die MLPD den israelischen Staatsterror verurteilte und den Kampf des palästinensischen Volkes unterstützte, argumentierte die Initiative "Libertad!", dass Zurückhaltung gegenüber der israelischen Politik einer Schonung des Zionismus gleichkomme. Die autonome Szeneschrift "Interim" forderte hingegen Solidarität mit Israel, um den Antisemitismus zu bekämpfen. Es gab eine breite Palette an Positionen, von bedingungsloser Solidarität mit Palästina bis hin zur bedingungslosen Unterstützung Israels. Die Debatte drehte sich um die Frage, ob Kritik an Israel automatisch als Antisemitismus gewertet werden dürfe, und ob ein "linker Antisemitismus" überhaupt existiere. Diese kontroversen Positionen führten zu einer weitgehenden politischen Lähmung der Szene.
6. Internet und Sicherheitsaspekte
Die zunehmende Nutzung des Internets durch Linksextremisten führte zur Diskussion um Sicherheit und Anonymität im Netz. Die gesetzlichen Maßnahmen nach den Anschlägen vom 11. September 2001, insbesondere die Neuregelung des Telekommunikationsgesetzes, erhöhten das Interesse an Verschlüsselung und Steganographie. Auf linksextremistischen Webseiten wurden Sicherheitstipps und Programme zum anonymen Surfen angeboten, zum Beispiel auf der Webseite der Antifa Bruchsal. Die "elektronische Mutter der Porzellankiste" der Roten Hilfe e.V. beschrieb den sicheren Umgang mit E-Mails (PGP), Festplattenverschlüsselung, Passwortwahl und das sichere Löschen von Daten. Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wurde ebenfalls als rassistisch kritisiert und als Ausdruck des "Klassenkampfs von oben" interpretiert.
7. Globalisierungskritik und Zusammenarbeit mit bürgerlichen Bündnissen
Globalisierungskritische Zusammenschlüsse boten Linksextremisten Zugang und Einflussnahme. Diese Gruppen verzichteten bewusst auf eindeutige politische Aussagen und verwendeten auslegungsfähige Formulierungen, um ein breites Spektrum an Interpretationen zuzulassen. Differierende politische Positionen blieben nebeneinander bestehen, wie am Beispiel des "Social Forums Tübingen/Reutlingen" gezeigt wurde. Eine klare Distanzierung erfolgte nur gegenüber Globalisierungskritikern von rechts. Die mangelnde Abgrenzung gegenüber Linksextremisten und das zwiespältige Verhältnis zur Gewaltfrage wurden kritisch betrachtet. Der Slogan "Eine andere Welt ist möglich!" wurde von Linksextremisten, analog der DKP, auch von der VVN-BdA übernommen und als Identifikationsmedium genutzt. Das Engagement in einem Freiburger Aktionsbündnis wurde von Linksextremisten als politischer Erfolg gewertet, da erstmals ein "bürgerliches" Bündnis die Ziele der linken Szene unterstützte.
III.Islamistische Organisationen in Baden Württemberg 2002
Der Bericht beleuchtet die Aktivitäten islamistischer Organisationen in Baden-Württemberg im Jahr 2002. Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD), mit Verbindungen zur Muslimbruderschaft, war eine einflussreiche Gruppe. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) versuchte mit der „Islamischen Charta“ seine Position zur deutschen Verfassung zu klären, wobei die Vereinbarkeit einiger Positionen mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung fraglich bleibt. Die Milli Görüs, mit ihrem Konzept der „Adil Düzen“ (Gerechte Ordnung) und der starken Betonung des Antizionismus, wurde ebenfalls analysiert. Die Rolle von Necmettin ERBAKAN und Mehmet Sabri ERBAKAN innerhalb der Bewegung wurde hervorgehoben. Die Hizb Allah führte durch Zwischenrufe und antisemitische Parolen Störungen bei einer Demonstration durch. Eine Organisation plante die Gründung einer islamischen Schule in den Niederlanden, die auch den späteren Besuch europäischer Universitäten vorsah.
1. Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland IGD und die Muslimbruderschaft
Die einflussreichste sunnitische islamistische Organisation in Deutschland im Jahr 2002 war die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD), die auch in Stuttgart eine Zweigstelle unterhielt. Die IGD ist ideologisch der Muslimbruderschaft (MB) verbunden, einer 1928 gegründeten und international agierenden Organisation. Die Aktivitäten der MB in Ägypten, wo sie trotz staatlicher Unterdrückung an Einfluss gewann, führten im September 2002 zur Verhaftung von über 30 Anhängern, die ein islamisches Kalifat einführen wollten. In Saudi-Arabien wurde die MB als "die Wurzel aller Probleme" bezeichnet. Die MB verfolgt ihre Interessen in Deutschland über den Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) mit Sitz in Köln, der als unabhängiger Dachverband agiert. Dies wurde durch die im Februar 2002 verabschiedete und veröffentlichte "Islamische Charta" deutlich, welche zwar Forderungen nach islamischem Religionsunterricht, Medienbeteiligung und lautsprecherverstärkten Gebetsrufen enthielt, aber auch mehrdeutige Formulierungen aufwies, die die Vereinbarkeit mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage stellen.
2. Die Islamische Charta und die Position des ZMD
Die "Islamische Charta" des ZMD, bestehend aus 21 Thesen, enthielt sowohl theologische Schlagworte als auch politische Bekenntnisse. Sie enthielt jedoch auch bewusst unscharfe und mehrdeutige Formulierungen, was den Verdacht aufkommen ließ, dass einige Positionen nicht mit den Werten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind. Die These 10 der Charta, die die rechtliche Stellung der Muslime erläutert, wurde besonders kritisch gesehen. Ein Mitglied des ZMD betonte zwar, dass kein Gottesstaat angestrebt werde. Jedoch wurde argumentiert, dass die Aussage des Zentralrats, das System der Bundesrepublik zu "begrüßen", von der koranischen Maßgabe abweiche, danach zu streben, dass nach Allahs Wort entschieden werde. Der Kommentar deutete an, dass die Anerkennung der säkularen Gesellschaft in Deutschland als Ansporn gesehen wird, diese Gesellschaft in eine islamgemäße umzuwandeln.
3. Die Milli Görüs und das Konzept der Adil Düzen
Die "Milli Görüs" ist eine ideologische Bewegung, die auf einem religiös fundierten Nationalismus basiert und eine Alternative zum kemalistischen Nationalismus darstellt. Leitfigur war Necmettin Erbakans Konzept der "Adil Düzen" ("Gerechte Ordnung"), das eine Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung mit der islamischen Religion im Zentrum beschreibt. Erbakans Thesen (1991) zeichnen den Westen als System von Sklavenhaltern, gelenkt vom Zionismus, und bezeichnen Juden als Imperialisten, die die Welt mit Hilfe des Kapitalismus erobern wollen. Dieser entschiedene Antizionismus ähnelt der Denkweise europäischer Antisemiten. Die aus diesen Thesen abgeleitete Gesellschaftsordnung weist antipluralistische, undemokratische und totalitäre Tendenzen auf. Erbakans Vorstellung einer "islamischen Ordnung" basiert auf unveränderbaren "wahren" Werten, wobei der Einfluss menschlicher Systeme ausgeschlossen ist. Dies impliziert ein Volk, das nur einen islamischen Herrscher gemäß der Scharia wählen könnte, da ein gläubiger Mensch keine Gesetzgebung von "unwissenden" Menschen akzeptieren würde, die von einem anderen Souverän als Gott abhängen.
4. Die Rolle von Necmettin Erbakan und die IGMG
Necmettin Erbakans Einfluss auf die Milli Görüs-Bewegung und die IGMG zeigte sich am 15. Juni 2002 beim "Tag der Brüderlichkeit und Solidarität" in Arnheim (Niederlande). An der Veranstaltung nahmen ca. 20.000 Muslime teil. Neben Mehmet Sabri Erbakan, dem damaligen Vorsitzenden der IGMG, sprach auch Necmettin Erbakan und gewann die Sympathien der Anwesenden mit Aussagen über eine islamfeindliche NATO und die Opferrolle der Muslime nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Erbakans Rhetorik betonte die Treue zu seiner Ideologie, indem er auf einen ehemaligen Funktionär der IGMG anspielte, der zur AKP gewechselt war. Die Gründung der AKP, die sich von islamistischen Ideologien distanziert, wird als bezeichnend für die türkischen Islamisten in Deutschland interpretiert, die der Ideologie Necmettin Erbakans verhaftet bleiben. Dies verdeutlicht, dass eine reformistische Strömung innerhalb der türkisch-islamistischen Bewegung erst durch die eklatanten demokratischen Defizite der Ursprungspartei entstand.
5. Weitere islamistische Aktivitäten und eine geplante islamische Schule
Erbakan versuchte den Eindruck zu erwecken, der Bundesverfassungsschutzbericht würde nur ein einziges Argument gegen seine Organisation vorbringen. Er erwähnte nicht den Inhalt des Werkes, in dem die Autorin „Halbmuslime“ als schlimmer als Kommunisten, Juden, Freimaurer, Atheisten und Nichtgläubige bezeichnet. Ein Interview mit Frau Senlikoglu in der "Milli Gazete" vor den türkischen Parlamentswahlen betonte diese extremen Ansichten. Ein weiterer Punkt betraf die Ankündigung einer islamischen Schule, deren Anmeldungen für das Studienjahr 2002/03 angenommen wurden. Die Schule sollte Jungen zwischen 10 und 12 Jahren aufnehmen und eine 7-8-jährige Ausbildung mit arabischen Wissenschaften, Arabischunterricht und Koranrezitation anbieten. Auch Mathematik, Naturwissenschaften und Informationstechnik waren geplant. Nach einem einjährigen Folgekurs sollte ein Studium an europäischen Universitäten möglich sein. Die angegebene Kontaktadresse befand sich in den Niederlanden, was auf eine Verwendung der Absolventen in ihren Heimatländern hindeutet.
6. Störung einer Demonstration durch die Hizb Allah
Eine friedliche Demonstration wurde durch die Hizb Allah gestört. Anhänger der Hizb Allah unterbrachen die Veranstaltung mit Zwischenrufen, Parolen und antisemitischen Äußerungen. Sie trugen organisationseigene Fahnen und Fotos ihrer Führer mit sich. Ein Redner musste sich für seine Hizb-Allah-kritische Äußerung entschuldigen, um seine Rede fortsetzen zu können. Die Hizb Allah präsentierte sich als militante Gruppierung, wobei gewaltverherrlichende und antisemitische Parolen („Gestern Hitler, heute Sharon“, „Israel Kindermörder“, „Terrorist USA“, „Weder östlich noch westlich, Palästina ist islamisch“) skandiert und auf Transparenten gezeigt wurden.
IV.PKK KADEK in Baden Württemberg 2002
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten der PKK und ihres Nachfolgers KADEK in Baden-Württemberg im Jahr 2002. Die Umwandlung der PKK in den KADEK im Zusammenhang mit der internationalen Terrorismusbekämpfung nach dem 11. September und dem Ziel, das Image als Terrororganisation abzulegen, wird erläutert. Die Aufnahme der PKK in die EU-Terrorliste löste Proteste aus. Der „Friedenskurs“ von Abdullah Öcalan und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Mobilisierung von Anhängern werden diskutiert. Das „Internationale Kurdistan Kultur Festival“ in Gelsenkirchen mit ca. 45.000 Teilnehmern wird erwähnt. Trotz des „Friedenskurses“ bestanden weiterhin Drohungen mit der Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes.
1. Die PKK und ihre Transformation zum KADEK
Die PKK, deren Vorsitzender Abdullah Öcalan trotz Todesurteils auf Imrali weiterhin als Generalvorsitzender fungierte, vollzog im Jahr 2002 eine Transformation zur "Gemeinschaft von Kurdistan" (KADEK). Dieser Schritt war Teil einer "Friedensstrategie", die insbesondere im Kontext der Ereignisse vom 11. September 2001 und der darauf folgenden internationalen Terrorismusbekämpfung zu sehen ist. Die PKK hoffte, ihr Image als Terrororganisation abzulegen und unter dem neuen Namen den Friedenskurs fortzuführen. Die Umwandlung sollte auch die Akzeptanz als internationaler Gesprächspartner im Zusammenhang mit den Machtverschiebungen im Irak und der Rolle der Kurden fördern und die Chancen auf einen Abbau internationaler Sanktionen verbessern. Für Deutschland bestand die – nicht realisierte – Möglichkeit, das Betätigungsverbot zu umgehen.
2. Reaktion auf die Aufnahme in die EU Terrorliste
Die Aufnahme der PKK in die EU-Terrorliste am 2. Mai 2002 löste bei Anhängern und Führungsfunktionären des KADEK große Empörung aus. Sie sahen die Entscheidung im Widerspruch zum "Friedenskurs" und den Bemühungen um eine Transformation zu einer politischen Organisation. Die Entscheidung führte zu diversen Erklärungen und Aktionen, wobei einige Anhänger die Wiedereinsetzung gewalttätiger Aktionen forderten. Den Funktionären gelang es jedoch, diese zu verhindern, da solche Aktionen als kontraproduktiv angesehen wurden. Die Organisation hätte die Entscheidung anders bewertet, wenn der KADEK als Symbol des Friedenskurses ebenfalls in der Liste erwähnt worden wäre.
3. Aktivitäten und Veranstaltungen des KADEK
Der KADEK nutzte im Jahr 2002 verschiedene Anlässe für friedliche Aktionen zur Mobilisierung von Anhängern und zur Darstellung der eigenen Anliegen. Im Vergleich zu den Vorjahren nahmen jedoch weniger Kurden an den Veranstaltungen teil, was auf Schwierigkeiten bei der Motivation der Mitglieder hindeutet. Viele akzeptierten den Friedenskurs, waren aber nicht mehr bereit, die Aktivitäten der Organisation im gleichen Umfang wie zuvor zu unterstützen. Einige Kurden zogen sich enttäuscht zurück, da sie im Friedenskurs einen Verlust der Werte sahen, für die sie jahrelang gekämpft hatten. Im Falle einer Strategieänderung des KADEK könnte dieser Personenkreis sich aber schnell wieder reaktivieren lassen. Eine ernstzunehmende innerparteiliche Opposition gegen den Friedenskurs gab es nicht. Das Internationale Kurdistan Kultur Festival am 7. September 2002 in Gelsenkirchen, mit ca. 45.000 Teilnehmern, hatte kulturelle und politische Beiträge, wobei die politische Entwicklung in der Türkei und das neue Gesetzespaket des türkischen Parlaments (Anfang August 2002) im Kontext der EU-Beitrittsverhandlungen positiv bewertet wurden.
4. Finanzielle Situation und anhaltende Drohungen
Die finanzielle Unterstützung des KADEK durch Kurden war im Jahr 2002/2003 geringer als in den Vorjahren. Viele Kurden zahlten nur teilweise oder gar nicht, da der bewaffnete Kampf mit dem Friedenskurs beendet sei. Trotzdem wurden weiterhin Bestrafungsaktionen durchgeführt, da viele Kurden sich nur mit dem Argument überzeugen ließen, dass die Guerillakämpfer im Nordirak wegen eines möglichen Irak-Krieges und eines Einmarsches des türkischen Militärs optimal ausgerüstet werden müssten. Trotz des "Friedenskurses" drohte der KADEK weiterhin mit der Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes. Diese Drohungen wurden schon vor dem 11. September 2001 in Erwägung gezogen und nach der Aufnahme der PKK in die EU-Terrorliste erneut geäußert. Ein Mitglied des PKK-Präsidialrates drohte mit einer "neuen Kriegsphase", die das Blut von Hunderttausenden kosten würde. Ein weiteres Mitglied des KADEK-Präsidialrats drohte im Vorfeld der türkischen Parlamentswahlen mit Krieg, falls ein kurdisches Bündnis von der Wahl ausgeschlossen werden sollte, was jedoch nicht geschah.
