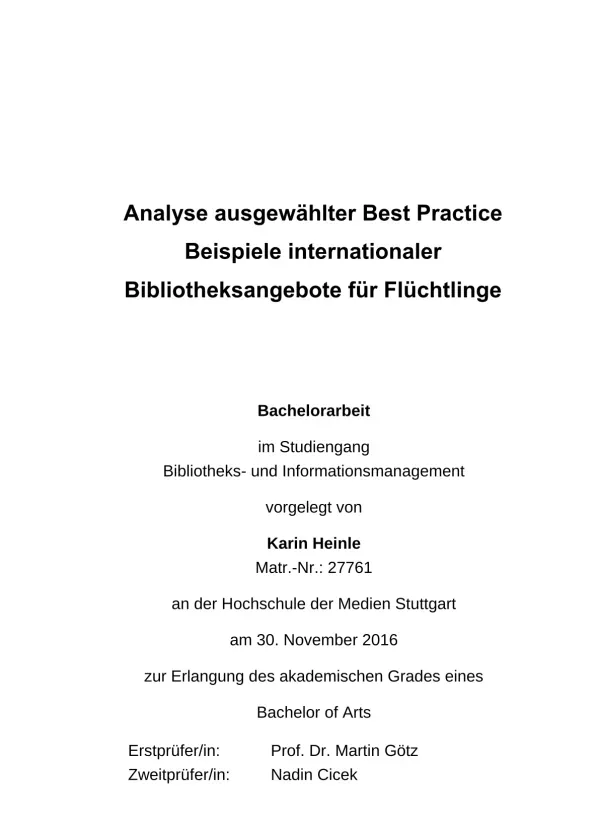
Flüchtlinge & Bibliotheken: Best Practice
Dokumentinformationen
| Autor | Karin Heinle |
| Schule | Hochschule der Medien Stuttgart |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Informationsmanagement |
| Ort | Stuttgart |
| Dokumenttyp | Bachelorarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.77 MB |
Zusammenfassung
I.Die Flüchtlingskrise und die Rolle öffentlicher Bibliotheken
Die europäische Flüchtlingskrise stellte viele Länder vor immense Herausforderungen. Öffentliche Bibliotheken erkennen ihre Chance zur aktiven Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund. Interkulturelle Bibliotheksarbeit wird als Schlüssel zur erfolgreichen Integration gesehen. Schnelle, kreative Lösungen sind gefragt, wobei Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern wichtige Inspiration bieten. Die Studie zeigt, dass finanzielle Mittel zweitrangig sind; Engagement und Kreativität sind entscheidend für erfolgreiche Projekte. Die zentrale Frage ist, wie Bibliotheken ihre Dienste effektiv an die Bedürfnisse von Flüchtlingen anpassen und diese in die Gesellschaft einbinden können.
1. Die unbefriedigende Vorbereitung auf die Flüchtlingskrise
Das Aufkommen der europäischen Flüchtlingskrise traf viele Länder, darunter auch Deutschland, unvorbereitet. Die Notwendigkeit schneller Integrationsmaßnahmen wurde deutlich. Der Text hebt hervor, dass öffentliche Bibliotheken in Deutschland eine Schlüsselrolle bei der sozialen Inklusion von Asylsuchenden und Migranten übernehmen können, indem sie multikulturelle Dienstleistungen anbieten. Die rasche Reaktion erfordert jedoch kreative und innovative Ansätze. Als Vorbild dienen Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, die bereits ähnliche Herausforderungen bewältigten und spezielle Dienstleistungen für Flüchtlinge entwickelten. Die Auswahl der Projekte betont, dass Erfolg nicht von der Finanzierung, sondern von Kreativität und Motivation abhängt. Es ist wichtig, schnell und effizient zu agieren, um die Bedürfnisse der Neuankömmlinge bestmöglich zu erfüllen und ihre Integration zu fördern.
2. Die Chancen und Herausforderungen der interkulturellen Bibliotheksarbeit
Öffentliche Bibliotheken in Deutschland haben die Möglichkeit, Asylsuchende und Migranten durch interkulturelle Bibliotheksarbeit in die Gesellschaft zu integrieren, indem sie Angebote und Dienstleistungen bereitstellen. Die rasche Umsetzung dieser Angebote ist von entscheidender Bedeutung. Best-Practice-Beispiele aus dem Ausland können als Inspirationsquelle dienen, da Bibliotheken anderer Länder ähnliche Herausforderungen gemeistert haben und bewährte Projekte für Flüchtlinge entwickelt haben. Diese Projekte zeigen, dass der Erfolg weniger von der finanziellen Ausstattung als vielmehr von Kreativität und Engagement abhängt. Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Flüchtlingen und Migranten werden hervorgehoben, wobei der Text den Unterschied zwischen den Begriffen nach UNHCR Definition erläutert. Die Bedeutung von Bibliotheken als Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird betont, wobei die zunehmende Wichtigkeit der interkulturellen Bibliotheksarbeit in den letzten Jahren herausgestellt wird.
3. Der historische Kontext und die Notwendigkeit von Integrationsmaßnahmen
Der Text beleuchtet den historischen Kontext der Migration nach Europa, beginnend mit der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die damalige Bezeichnung "Gastarbeiter" deutete auf eine temporäre Situation hin, was zu einem Mangel an Integrationsbemühungen führte. Im Gegenteil, es gab sogar Anreize zur Rückkehr in die Heimatländer. Diese Fehlkalkulation führte zu Parallelgesellschaften und erschwerte die Integration. Die aktuelle Flüchtlingskrise bietet die Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und frühzeitig Integrationsmaßnahmen zu ergreifen. Die Notwendigkeit, Bibliotheken als Kultur- und Bildungseinrichtungen für die gesamte Bevölkerung zu positionieren, wird unterstrichen. Der langfristige Erfolg der Bibliotheken hängt von der Anpassung an die multikulturelle Gesellschaft ab, wobei zukünftig jegliche Bibliotheksarbeit als interkulturelle Arbeit verstanden werden sollte. Dies erfordert auch die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel und Rahmenbedingungen. Es liegt in der Verantwortung der Länder, dies sicherzustellen.
4. Spezifische Herausforderungen und Lösungen für Bibliotheken
Der Text beleuchtet besondere Herausforderungen für Bibliotheken, wie die Benutzerausweisvergabe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die keine Erziehungsberechtigten haben, und die Notwendigkeit mehrsprachiger Informationen, z.B. der Benutzungsordnung. Die aktive Bewerbung der Bibliotheksangebote zur Überwindung von Schwellenängsten wird empfohlen. Es wird betont, dass gute Projekte nicht teuer sein müssen; kleinere, kreative Ideen können einen großen Beitrag leisten und den Trägern den Mehrwert der interkulturellen Bibliotheksarbeit verdeutlichen. Der Blick über nationale Grenzen hinaus, um von innovativen Angeboten anderer Länder zu lernen, wird empfohlen, um zeitliche und personelle Ressourcen zu sparen. Die statistischen Daten beziehen sich vorwiegend auf die Jahre 2014 und 2015, als die Flüchtlingszahlen stark zunahmen. Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 und ihre Bedeutung für die Anerkennung und den Schutz von Flüchtlingen werden kurz erwähnt. Es wird hervorgehoben, dass schnellere Integrationsmaßnahmen wichtig sind, um Probleme bei den Flüchtlingen zu vermeiden, insbesondere die während der Wartezeit auf Asylentscheidungen auftretenden Frustrationen und die damit verbundenen Risiken.
5. Die Bedeutung von Bildung und die positiven Effekte der Willkommenskultur
Die deutsche Willkommenskultur und Angela Merkels Aussage "Wir schaffen das" dienten als Vorbild für andere EU-Länder, wenngleich nicht alle Staaten diesem Beispiel folgten. Europäische Bibliotheken bekunden geschlossen Solidarität und werben auf der EBLIDA-Website für positive Beispiele interkultureller Bibliotheksarbeit. Der Flüchtlingszustrom hat zu notwendigen Investitionen in verschiedenen Bereichen geführt, von denen auch die Kommunen profitieren. Bibliotheken können durch Integrations- und Bildungsmaßnahmen eine wichtige unterstützende Rolle spielen, sowohl individuell als auch im Rahmen von Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen. Dies verbessert das Image der Bibliotheken und stärkt ihr Ansehen bei Kommunen und anderen Akteuren. Der Text unterstreicht die Bedeutung von Bildung für junge Flüchtlinge, die oft unter dem Druck stehen, schnell Geld zu verdienen und ihre Familien nachzuholen, um die Verzweiflung zu minimieren und das Selbstwertgefühl zu stärken. Es wird erwähnt, dass neben Bücherspenden auch Sachspenden wie Laptops und LED-Lampen benötigt wurden, bevor die Jungle Books Library in Calais geschlossen wurde. Die positive Resonanz auf dieses Projekt wird hervorgehoben, wobei der Erfolg auf die Initiative von Mary Jones, Freiwilligen und Spendenbereitschaft zurückzuführen ist.
II.Interkulturelle Bibliotheksarbeit in der Praxis
Interkulturelle Bibliotheksarbeit geht über traditionelle Bibliotheksarbeit hinaus. Es braucht ein Umdenken, um alle Nutzergruppen zu erreichen, besonders Flüchtlinge und Migranten. Sprachliche Barrieren und unterschiedliche Informationsbedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Beispiele aus anderen Ländern belegen, wie Bibliotheken erfolgreich sprachliche Unterstützung, kulturelle Angebote und soziale Integration fördern. Australien, Kanada, die USA, die Niederlande und skandinavische Länder gelten als Vorreiter in der interkulturellen Bibliotheksarbeit.
1. Definition und Bedeutung interkultureller Bibliotheksarbeit
Der Abschnitt definiert interkulturelle Bibliotheksarbeit als eine Querschnittsaufgabe, die die gesamte Einrichtung betrifft, nicht nur einzelne Mitarbeiter. Ein Umdenken ist notwendig, um Angebote und Dienstleistungen für alle Nutzergruppen bereitzustellen. Traditionelle Ansätze reichen nicht aus; die Bedürfnisse multikultureller Nutzergruppen, insbesondere von Flüchtlingen und Migranten, müssen berücksichtigt werden. Der Text kritisiert den bisherigen Mangel an Diskussion über den Stellenwert interkultureller Aktivitäten in öffentlichen Bibliotheken, der bis 2008 deutlich war. Es wird betont, dass Bibliotheken, die sich als Kultur- und Bildungseinrichtungen für die gesamte Bevölkerung legitimieren wollen, auch Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge erreichen müssen. Ein Beispiel für ein unzureichendes Angebot ist die Bereitstellung von Sprachlernmaterialien für Flüchtlinge, die jedoch nicht oder nur schlecht lesen können. Die Notwendigkeit einer angepassten, bedürfnisorientierten Herangehensweise wird deutlich.
2. Der historische Kontext und die Entwicklung der interkulturellen Bibliotheksarbeit
Der Abschnitt beleuchtet den historischen Kontext der Migration und Integration in Europa. Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte nach dem Zweiten Weltkrieg, die als "Gastarbeiter" bezeichnet wurden, basierte auf der Annahme ihres kurzfristigen Aufenthalts. Integration spielte daher kaum eine Rolle; es gab sogar Anreize zur Rückkehr. Diese Fehlkalkulation führte zu Parallelgesellschaften und Integrationshemmnissen. Der Text betont, dass diese Fehler bei der aktuellen Flüchtlingskrise vermieden werden sollen. Der Abschnitt verweist auf die Vorbildfunktion anderer Länder wie Australien, Kanada, den USA, den Niederlanden und skandinavischen Ländern in der interkulturellen Bibliotheksarbeit. Deutschland wird als im Vergleich dazu nachhinkend dargestellt, obwohl es in der Flüchtlingskrise durch Best-Practice-Beispiele international Anerkennung erlangt hat. Die Gründung der DBV-Expertengruppe 2006 im Vergleich zur langjährigen Existenz der entsprechenden IFLA-Sektion unterstreicht diese Entwicklung. Der Mangel an gesetzlicher Grundlage für interkulturelle Bibliotheksarbeit in Deutschland wird angesprochen, was die Notwendigkeit von Motivation und Überzeugungsarbeit unterstreicht.
3. Die Notwendigkeit einer veränderten Bibliotheksarbeit
Dieser Abschnitt argumentiert, dass für Bibliotheken, die ihren Auftrag langfristig erfüllen wollen, zukünftig jegliche Bibliotheksarbeit de facto interkulturelle Bibliotheksarbeit sein muss. Dies erfordert ein umfassendes Umdenken und die Anpassung an die Bedürfnisse multikultureller Nutzergruppen. Die Rolle von Bibliotheken als zentrale Orte für Begegnung und Annäherung unterschiedlicher Kulturen wird betont. Die Herausforderung besteht darin, Träger und Verantwortliche von der Notwendigkeit und dem Wert von interkulturellen Programmen zu überzeugen, da oft die notwendige Basis für eine solche Begründung fehlt. Die Richtlinien von DBV und IFLA sind lediglich Empfehlungen, ohne gesetzliche Verbindlichkeit. Die Schwierigkeiten, Bibliotheken zur Übernahme der Verantwortung für multikulturelle Nutzergruppen und zur Bewilligung der entsprechenden finanziellen Mittel zu bewegen, werden deutlich gemacht. Es wird auf die Notwendigkeit von Motivations- und Überzeugungsarbeit hingewiesen, um das Potential von Bibliotheken in diesem Bereich zu nutzen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
III.Internationale Best Practice Beispiele
Die Studie präsentiert diverse Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Ländern. In Frankreich zeigt die "Jungle Books Library" in Calais (geschlossen 2016) die positive Wirkung von Bibliotheken als sichere Orte und Begegnungsstätten. In Großbritannien zeigt die "Welcome Group" in Wigan, in Kooperation mit der Deanery High School, wie Bibliotheken gezielt junge Menschen beim Spracherwerb und der sozialen Integration unterstützen. Die Niederlande, mit ihrem seit 1975 bestehenden Bibliotheksgesetz, und Kanada mit ihrer "Willkommenskultur" und Programmen wie den "Library Settlement Partnerships (LSP)" demonstrieren erfolgreiche Ansätze zur Integration von Neuankömmlingen. Schweden und Skandinavien betonen die Förderung von Zweitsprachen und bieten vielfältige Programme wie Sprachencafés und das "Borrow a Swede"-Projekt (in Gotland adaptiert als "Borrow a Gotlander"). Die Stadtbibliothek Malmö in Schweden, mit 30% ausländischer Bevölkerung und Beteiligung an der "Partnership Skåne", ist ein besonders gelungenes Beispiel für interkulturelle Bibliotheksarbeit.
1. Frankreich Die Jungle Books Library in Calais
Die Jungle Books Library in Calais, Frankreich, wird als Beispiel für erfolgreiche interkulturelle Bibliotheksarbeit vorgestellt. Sie bot Flüchtlingen im „Dschungel“ von Calais einen sicheren Ort, sinnvolle Beschäftigung und Linderung der schwierigen Lebensumstände. Das Projekt war ein großer Erfolg und erhielt durchweg positive Rückmeldungen. Es zeigte sich, dass die Bibliothek als Ort der Begegnung und des sozialen Austauschs fungierte. Die Schließung der Bibliothek nach der Räumung des Calais-Lagers im Oktober 2016 wird erwähnt, wobei das gerettete Material in Flüchtlingslager in Griechenland weiterverwendet wurde. Der Erfolg dieses Projekts wird auf die Initiative von Mary Jones, die Unterstützung vieler Freiwilliger und großzügige Spenden zurückgeführt. Zusätzliche Angebote, wie eine Schreibwerkstatt mit einem Experten für Sprache und Grammatik und die Kooperation mit France terre d'asile, um Flüchtlinge über ihre Rechte und Pflichten zu informieren, werden erwähnt. Die Jungle Books Library verdeutlicht, wie Bibliotheken auch mit begrenzten Ressourcen einen erheblichen positiven Einfluss haben können.
2. Großbritannien Die Welcome Group in Wigan und weitere Initiativen
In der öffentlichen Bibliothek in Wigan, Großbritannien, wurde die Welcome Group in Kooperation mit der Deanery High School ins Leben gerufen. Dieses Projekt richtet sich an junge Menschen, die Englisch als Zweitsprache lernen. Neben Konversationskursen bietet die Welcome Group soziale Aktivitäten wie Brettspiele, kreatives Schreiben und einen Filmclub an. Die Welcome Group wurde 2015 von Better World Books ausgezeichnet. Weitere, ähnliche Initiativen wie die "Chat and Chill" Gruppen werden erwähnt, die sich auf Frauen konzentrieren und neben dem Sprachunterricht auch ein besseres Verständnis des britischen Systems und der Kultur vermitteln. Diese Gruppen fördern nicht nur den Spracherwerb und die Integration, sondern schaffen auch ein Gemeinschaftsgefühl und stärken das Selbstvertrauen der Teilnehmerinnen. Das Beispiel zeigt, wie Bibliotheken auf spezifische Bedürfnisse lokaler Zielgruppen eingehen und mehrere Informationsbedürfnisse gleichzeitig bedienen können. Ein früher initiiertes, aber leider nicht nachhaltiges Programm, WTYL, welches einen Leitfaden für Bibliotheken zur zielgruppenorientierten Arbeit mit Flüchtlingen entwickelte, wird ebenfalls erwähnt.
3. Niederlande Ein starkes nationales Bibliotheksystem
Das niederländische Bibliothekssystem wird als Vorbild für internationale Kollegen gelobt. Seit 1975 gibt es ein Bibliotheksgesetz, das die Rolle öffentlicher Bibliotheken im nationalen Netzwerk definiert. Die öffentlichen Bibliotheken sind Stiftungen und genießen daher größere Managementfreiheiten. Dadurch können sie schneller auf neue Zielgruppen, Arbeitsweisen und Herausforderungen reagieren und lokale Initiativen in nationale Programme umwandeln. Ein Beispiel für erfolgreiche Kooperation ist die Zusammenarbeit mit Studenten der Bereiche Erziehung, Sprache und Kinderpflege als Sprachpaten ("Language Buddies") für Flüchtlingsfamilien. Die Studenten geben informellen Sprachunterricht, wodurch die Kinder einen geringeren Rückstand zu einheimischen Kindern haben, während die Familienmitglieder gleichzeitig die niederländische Sprache üben. Die Studenten gewinnen gleichzeitig Praxiserfahrung.
4. Kanada Integration als gesellschaftlicher Grundsatz und die Toronto Public Library TPL
In Kanada wird Immigration von der Mehrheit positiv gesehen, Multikulturalismus ist ein gesellschaftlicher Grundsatz. Die liberale Regierung, die 2015 gewählt wurde, erklärte sich bereit, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Die Toronto Public Library (TPL) dient als Beispiel für die hohe Qualität der Arbeit kanadischer Bibliotheken. Die TPL zeichnet sich durch eine landesweite Vernetzung und ähnliche, bewährte Angebote aus. Die hohe Anzahl an Benutzern und der hohe Anteil von Bürgern mit einem Bibliotheksausweis werden erwähnt. Die Library Settlement Partnerships (LSP) unterstützen Neuankömmlinge mit individueller Hilfe in ihrer Muttersprache durch "settlement workers". Das ganzjährig angebotene Programm umfasst auch Workshops zu relevanten Themen und die Newcomer Orientation Week. Die TPL bietet zudem Sprachkurse in Kooperation mit Schulen, einen Telefon-Dolmetscher-Service in über 170 Sprachen und pflegt durch Bereitstellung von Medien und Geschichten in der Muttersprache der Flüchtlinge den Kontakt zu deren Herkunftssprachen.
5. Skandinavien Schweden das Borrow a Swede Projekt und Malmö
Skandinavische Länder gelten als Vorreiter in der interkulturellen Bibliotheksarbeit. In Schweden wird die große Nachfrage nach arabischsprachigen Hörbüchern erwähnt, was zu einer Kooperation mit anderen nordischen Ländern führte, um eigene Werke übersetzen und produzieren zu lassen. Das schwedische Bibliotheksgesetz schreibt die gleichberechtigte Förderung aller Zweitsprachen neben Schwedisch vor. Sprachencafés, multilinguale Veranstaltungen und Lesestunden sind Standardangebote schwedischer Bibliotheken. Weitere Maßnahmen umfassen die Einrichtung von Computern und Büchern in Flüchtlingsunterkünften, angepasste Routen von Bücherbussen und die Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen. Das "Borrow a Swede"-Projekt (auf Gotland als "Borrow a Gotlander" adaptiert) vermittelt Freiwillige an Flüchtlinge zum Üben der schwedischen Sprache. Die Stadtbibliothek Malmö, mit 30% ausländischer Bevölkerung und 178 vertretenen Nationalitäten, ist ein Beispiel für erfolgreiche, langjährige Angebote für Migranten. Die Bibliothek bietet Bibliotheksausweise auch ohne Personalausweis und an nicht registrierte Flüchtlinge an. Die Beteiligung an der Partnership Skåne, einem regionalen Pilotprojekt, wird ebenfalls genannt, das unter anderem die verpflichtende Bibliotheksnutzung für Flüchtlinge und Migranten zur Integration vorsieht. Die Kooperation mit Drivhuset unterstützt Flüchtlinge beim Aufbau eigener Unternehmen.
IV.Schlussfolgerung und Handlungsempfehlungen
Die untersuchten Best-Practice-Beispiele zeigen, dass erfolgreiche Integration von Flüchtlingen durch Bibliotheken von proaktivem Handeln und Kooperationen abhängt. Finanzielle Mittel sind wichtig, aber nicht entscheidend; Engagement, Kreativität und die Nutzung von Freiwilligen sind zentral. Bibliotheken agieren als Vermittler zwischen Flüchtlingen und relevanten Experten. Programme wie "New Amigos" (Norwegen) fördern spielerisches Sprachenlernen. Die Förderung der Zweitsprachen sowie die Bereitstellung von multilingualen Ressourcen sind unerlässlich für eine erfolgreiche interkulturelle Bibliotheksarbeit. Die aktive Ansprache der Zielgruppe und der Aufbau von Netzwerken sind Schlüssel zum Erfolg. Die Studie plädiert für verstärkte Partizipation in kommunalpolitischen Prozessen und den Nutzen von internationalen Projekten zur effizienten Integration von Flüchtlingen.
1. Zusammenfassung der Best Practice Beispiele
Die vorgestellten Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Ländern zeigen, dass Bibliotheken, die aktiv auf ihre Zielgruppen zugehen und diese ansprechen, am erfolgreichsten sind. Auch gut ausgestattete Bibliotheken benötigen Unterstützung, sei es finanziell oder personell. Diese Unterstützung wird durch Kooperationen, Engagement von Freiwilligen und die Nutzung vorhandener Fähigkeiten gewonnen. Die Bibliotheken übernehmen dabei oft die Rolle des Managers, der Experten und Ressourcen findet und diese den Nutzern vermittelt. Beispiele hierfür sind die Jungle Books Library in Calais, die Welcome Group in Wigan und verschiedene Initiativen in Schweden, Kanada und den Niederlanden. Diese Beispiele verdeutlichen unterschiedliche, erfolgreiche Ansätze zur Integration von Flüchtlingen durch Bibliotheken. Die verschiedenen Ansätze zeigen die Vielfältigkeit und Anpassungsfähigkeit von Bibliotheksarbeit an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Flüchtlinge.
2. Schlüssel zum Erfolg Proaktives Handeln und Kooperationen
Erfolgreiche Projekte zur Integration von Flüchtlingen in Bibliotheken zeichnen sich durch proaktives Handeln und den Aufbau von Kooperationen aus. Die Bibliotheken warten nicht passiv auf die Nutzer, sondern gehen aktiv auf sie zu und werben für ihre Angebote. Finanzielle und personelle Ressourcen sind wichtig, aber nicht der ausschlaggebende Faktor. Engagement, Kreativität und der Einsatz von Freiwilligen sind ebenso entscheidend. Durch Kooperationen können Bibliotheken auf das Fachwissen von Experten zurückgreifen, ohne eigene Mitarbeiter schulen zu müssen. Dies ermöglicht es, das Angebot der Bibliothek über die reine Bereitstellung von Medien hinaus zu erweitern und ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten. Die Beispiele der Konversationskurse, die Schreibwerkstätten und die Vermittlung von Kontakten zu anderen Fachleuten unterstreichen diese These.
3. Sprachförderung und spielerisches Lernen
Die Bedeutung der Sprachförderung für die Integration von Flüchtlingen wird hervorgehoben. Dabei wird betont, dass das Erlernen der neuen Sprache die Muttersprache nicht ersetzen sollte, sondern beide Sprachen gleichermaßen gefördert werden sollten. Beispiele wie der telefonische Vorlesedienst „Wähl-dir-eine-Geschichte“ in verschiedenen Sprachen oder das „Borrow a Swede“-Projekt verdeutlichen kreative Ansätze zur Sprachförderung. Das Brettspiel „New Amigos“ wird als Beispiel für spielerisches Sprachenlernen vorgestellt. Es fördert den Austausch zwischen Muttersprachlern und Lernenden und soll den Spracherwerb auf unterhaltsame Weise unterstützen. Das Spiel wird in verschiedenen Sprachkombinationen angeboten, die neueste ist Norwegisch-Arabisch. Das Prinzip des Tandem-Lernens und die wachsende Online-Community unterstreichen das Potenzial des Spiels für den weltweiten Spracherwerb.
4. Handlungsempfehlungen und Zukunftsperspektiven
Die Schlussfolgerung betont die Notwendigkeit einer aktiven Ansprache der Zielgruppen und den Aufbau von Netzwerken für eine erfolgreiche interkulturelle Bibliotheksarbeit. Die Bibliotheken sollten nicht passiv auf die Nutzer warten, sondern diese aktiv ansprechen und für die Angebote werben. Auch die besten Projekte benötigen Unterstützung – finanziell und personell. Diese Unterstützung sollte durch Kooperationen, Engagement und den Einsatz von Freiwilligen gewonnen werden. Die Bibliothek fungiert als Manager, der Experten und Fähigkeiten sucht, diese für sich gewinnt und den Nutzern vermittelt. Der Text empfiehlt, von internationalen Projekten zu lernen und diese als Inspiration für die eigene Arbeit zu nutzen. Die Überwindung von Barrieren beim Zugang zu fremdsprachigen Medien wird als wichtige Aufgabe hervorgehoben, wobei der Nutzen von internationalen Projekten und Datenbanken wie dem SBCI (wahrscheinlich eine Abkürzung) für kleinere Bibliotheken betont wird. Stärkere Partizipation in kommunalpolitischen Prozessen wird als Weg zu langfristigen positiven Effekten gesehen.
Dokumentreferenz
- The first Ideas Box for refugees in Europe implemented (Bibliotèques Sans Frontières)
