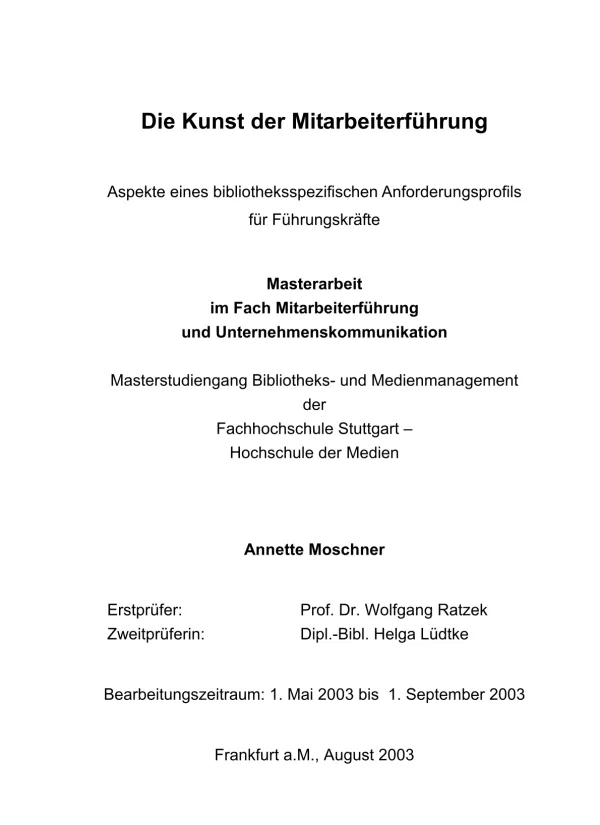
Mitarbeiterführung in Bibliotheken
Dokumentinformationen
| Autor | Annette Moschner |
| school/university | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| subject/major | Mitarbeiterführung und Unternehmenskommunikation |
| Dokumenttyp | Masterarbeit |
| Ort | Stuttgart |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 688.57 KB |
Zusammenfassung
I.Mitarbeiterführung im Wandel Herausforderungen für Bibliotheken
Diese Masterarbeit untersucht die Mitarbeiterführung in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken im Kontext des globalen Wandels. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit eines veränderten Führungsverhaltens und -stils, basierend auf hoher sozialer und persönlicher Kompetenz. Die Arbeit zeigt auf, wie Lernprozesse, insbesondere im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation, ein positives Betriebsklima und gesteigerte Leistungsbereitschaft fördern können. G. Paul (2000b) hebt den Zusammenhang zwischen Leitungsqualität, Betriebsklima und Mitarbeitermotivation hervor, wobei soziale Kompetenz der Führungskräfte als entscheidend angesehen wird. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss des Menschenbilds der Führungskraft auf die Mitarbeiter.
1. Der Bedarf an veränderter Mitarbeiterführung in Bibliotheken
Die Masterarbeit untersucht die Mitarbeiterführung in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken vor dem Hintergrund des rasanten technologischen und wirtschaftlichen Wandels. Es wird argumentiert, dass diese Veränderungsprozesse ein verändertes Führungsverhalten und einen neuen Führungsstil erfordern, die auf sozialen und persönlichen Kompetenzen basieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation als Schlüssel für ein positives Arbeitsklima und die Steigerung der Mitarbeitermotivation und -leistungsbereitschaft im Sinne der Personalentwicklung. Die Arbeit verweist auf die zunehmende Bedeutung von Sozialkompetenz, die in der Literatur und in aktuellen Werken wie Golemans "Emotionale Führung" (2002) hervorgehoben wird. Diese Kompetenz gilt als Indikator für eine menschlichere Führungskultur, die in Bibliotheken, Unternehmen und allen Organisationen gleichermaßen wichtig ist. Ein zentrales Kapitel widmet sich den Auswirkungen des Menschenbildes der Führungskraft auf die Mitarbeiter.
2. Die Bedeutung sozialer und persönlicher Kompetenz für Führungskräfte
Eine empirische Studie von G. Paul (2000b) unterstreicht den Zusammenhang zwischen Leitungsqualität, Betriebsklima und der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Paul beschreibt die Bibliothek als soziales Gebilde, dessen Erfolg maßgeblich von der sozialen Kompetenz der Führungskräfte abhängt, neben der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz. Die Arbeit hebt die zunehmende Bedeutung von Sozialkompetenz und persönlicher Kompetenz hervor und verweist auf die Fülle an Fachliteratur zu diesem Thema. Die Kernaussagen von Daniel Golemans Buch "Emotionale Führung" (2002) werden vorgestellt, wobei emotionale Intelligenz als ein wichtiger Indikator für eine positive Führungskultur genannt wird. Diese Aspekte werden im Kontext der Herausforderungen des Wandels und der damit verbundenen Anforderungen an ein zeitgemäßes Führungsverhalten in Bibliotheken diskutiert.
3. Mitarbeiterführung im Wandel Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis
Das Kapitel "Mitarbeiterführung im Wandel" beleuchtet die bestehenden Herausforderungen in Bibliotheken. Trotz der weitreichenden Veränderungen in der globalen Wirtschaft und Technologie, bleiben Führungskräfte in Bibliotheken oft alten Strukturen verhaftet. Als Teil der öffentlichen Verwaltung sind sie zwar in Verwaltungsreformen und -modernisierungen eingebunden, doch die Umsetzung neuer Führungsverständnisse hinkt hinterher. Die Arbeit zeigt auf, dass die Diskrepanz zwischen traditionellem und zeitgemäßem Führungsverhalten dazu führt, dass Mitarbeiterpotenzial ungenutzt bleibt und entgegen der Ziele der Personalentwicklung sogar zerstört wird. Es wird die Frage gestellt, inwieweit die Anforderungen an Führungskräfte in Bibliotheken tatsächlich erfüllt werden. Die Arbeit verweist auf den Vortrag von Helmut Klages (2002) "Führung als Erfolgsfaktor der Personalentwicklung", der den Wandel in der Mitarbeiterführung und die weiterhin bestehende Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis in der öffentlichen Verwaltung und damit auch in Bibliotheken anschaulich darstellt. Klages zeigt auf, dass die dezentralisierte Ressourcenverantwortung im Rahmen neuer Steuerungsmodelle neue Anforderungen an Führungskräfte stellt, die als Personalentwickler agieren und die Ressource "Personal" optimal einsetzen müssen. Die erörterten Ergebnisse zeigen eine weiterhin bestehende, inkompetente Führung in der Praxis.
II.Kompetenzen erfolgreicher Führungskräfte in Bibliotheken
Die Studie analysiert die notwendigen Kompetenzen von Führungskräften in Bibliotheken. Neben fachlicher Expertise wird die Bedeutung von emotionaler Intelligenz und Sozialkompetenz betont, wie von Goleman (2002) in "Emotionale Führung" beschrieben. Die Arbeit unterstreicht den Bedarf an Selbstmanagement und effektivem Umgang mit Mitarbeitern. Ein beziehungsorientierter Ansatz, angelehnt an Maslows Bedürfnispyramide, wird als förderlich für die Mitarbeitermotivation dargestellt. Die "Y-Einstellung" nach McGregor, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, wird ebenfalls diskutiert. Schließlich wird die Notwendigkeit einer professionellen Ausbildung und Weiterentwicklung von bibliothekarischen Führungskräften betont, wie von Paul (2000a) gefordert.
1. Die Bedeutung von Sozialkompetenz und Emotionaler Intelligenz
Der Abschnitt betont die entscheidende Rolle von Sozialkompetenz und Emotionaler Intelligenz für erfolgreiche Führungskräfte in Bibliotheken. G. Pauls Studie (2000b) unterstreicht den Zusammenhang zwischen guter Führung, positivem Betriebsklima und der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Dabei wird die soziale Kompetenz der Führungskraft als zentraler Faktor für das Gelingen der Organisation "Bibliothek" hervorgehoben. Die Arbeit verweist auf die wachsende Bedeutung dieses Themas in der Fachliteratur und präsentiert die Kernaussagen von Daniel Golemans Buch "Emotionale Führung" (2002), das die emotionale Dimension von Führung als entscheidend für den Erfolg einer Organisation beschreibt. Soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz werden als Indikatoren für eine menschlichere und effektivere Führungskultur dargestellt, die über den Bibliothekskontext hinaus für Unternehmen und Organisationen aller Art relevant ist. Der Einfluss des Menschenbildes einer Führungskraft auf die Mitarbeiter wird als weiterer wichtiger Aspekt behandelt.
2. Beziehungsorientierter Ansatz und Bedürfnispyramide nach Maslow
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der sogenannte "beziehungsorientierte Ansatz", der den Menschen als soziales Wesen mit dem Bedürfnis nach Anerkennung betrachtet. In diesem Zusammenhang wird A. Maslow und seine Bedürfnispyramide (1954) erwähnt, die den Zusammenhang zwischen dem Leistungsverhalten von Mitarbeitern und der Art und Weise, wie Führungskräfte auf deren innere Bedürfnisse eingehen, aufzeigt. Die "Y-Einstellung" nach McGregor wird als Gegenstück zu einem eher negativ besetzten Menschenbild vorgestellt. Diese Einstellung stellt den Menschen in den Mittelpunkt und betont, dass verantwortungsbewusste Mitarbeiter die Möglichkeit benötigen, ihre Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Arbeit wird hier als Quelle der Zufriedenheit gesehen, wobei die Befriedigung von Ich-Bedürfnissen und das Streben nach Selbstverwirklichung als wichtigste Arbeitsanreize gelten. Im Gegensatz dazu wird eine negative Einstellung mit Vorurteilen und Fokus auf Schwächen beschrieben, die zu Flucht, Auflehnung oder Anpassung bei den Mitarbeitern führen kann. Die Notwendigkeit, auf die Stärken und Anlagen der Mitarbeiter einzugehen und Vertrauen aufzubauen, wird betont.
3. Kompetenzen und professionelle Qualifizierung von Führungskräften
Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Qualifizierung bibliothekarischer Führungskräfte. Paul (2000a) fordert die Einübung von Leitungsfunktionen als regulären Bestandteil der Ausbildung. Die Arbeit thematisiert, dass der gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Wandel die Arbeitsorganisation "Bibliothek" und die Anforderungen an Führungskräfte stark beeinflusst. Trotzdem bleiben viele Führungskräfte in Bibliotheken alten Strukturen verhaftet, was als wichtiges Hemmnis für Veränderungsprozesse angesehen wird (Lux, 1998). Der Text beleuchtet den Prozess des Wandels in der Mitarbeiterführung der öffentlichen Verwaltung und damit auch in Bibliotheken. Klages (2002) betont in seinem Vortrag "Führung als Erfolgsfaktor der Personalentwicklung" die Bedeutung eines modernen Führungsverhaltens. Er beschreibt die neue aktive Rolle von Führungskräften im Kontext dezentralisierter Ressourcenverantwortung und betont deren Verantwortung als Personalentwickler, um das Personal optimal einzusetzen. Die Arbeit zeigt jedoch, dass diese modernen Ansätze in der Praxis oft noch nicht umgesetzt sind und durch inkompetentes Führungsverhalten Mitarbeiterpotenzial zerstört wird.
4. Selbstmanagement und der Umgang mit sich selbst
Die Bedeutung persönlicher Kompetenzen wird im Zusammenhang mit Golemans Ausführungen (1999b) hervorgehoben. Die Fähigkeit zur Selbstführung, also zum Selbstmanagement, basiert auf Selbstwahrnehmung, die das Kennen der eigenen Emotionen und ihrer Auswirkungen, sowie die Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen einschließt. Selbstkontrolle und die Motivation, trotz Hindernissen Ziele zu verfolgen, werden als weitere wichtige Aspekte des Selbstmanagements genannt. Diese Kompetenzen sind essentiell für eine effektive Mitarbeiterführung, da sie die Basis für einen authentischen und vertrauensvollen Umgang mit anderen bilden. Nur wer sich selbst gut kennt und steuern kann, kann auch andere effektiv führen und ein positives Arbeitsklima schaffen. Die Arbeit unterstreicht damit, dass die Entwicklung persönlicher Kompetenzen ein wichtiger Bestandteil der professionellen Qualifizierung von Führungskräften sein muss.
III.Führungsstile und deren Auswirkungen auf das Bibliothekswesen
Die Arbeit untersucht verschiedene Führungsstile, unter anderem den laissez-faire-Stil, den autoritären Stil und einen situations- und personenbezogenen Ansatz. Der affiliative Führungsstil wird als besonders positiv für die Öffentlichkeitsarbeit und die Teamfindung in Bibliotheken bewertet. Coaching als Führungsstil gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Kontext der Personalentwicklung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Die Herausforderungen des Wandels von traditionellen zu modernen Führungsverständnissen werden anhand von Studien und Beispielen aus der öffentlichen Verwaltung (z.B. Arbeiten von Klages) verdeutlicht.
1. Traditionelle vs. Moderne Führungsstile in Bibliotheken
Dieser Abschnitt analysiert verschiedene Führungsstile und deren Eignung für Bibliotheken. Er beschreibt die Herausforderungen des Wandels von traditionellen zu modernen Führungsverständnissen. Während in vielen Bereichen ein Wandel hin zu modernen, flexibleren Führungsstilen stattfindet, haften Führungskräfte in Bibliotheken, als Teil der öffentlichen Verwaltung, oft noch an alten Strukturen fest. Die Arbeit vergleicht die Situation mit der in Unternehmen und Betrieben, wo Mitarbeitergespräche ein viel genutztes Führungsinstrument sind, während sie in Bibliotheken eine eher marginale Rolle spielen. Dies wird als Hinweis auf eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis gesehen, die zu einem Verlust von Mitarbeiterpotenzial führt, entgegen den Zielen der Personalentwicklung. Der Abschnitt zeigt auf, dass der Wandel hin zu zeitgemäßem Führungsverhalten zwar theoretisch bekannt ist, aber in der Praxis noch nicht ausreichend umgesetzt wird, obwohl es Bemühungen wie Führungskräfte-Nachwuchs-Entwicklungsprogramme gibt (z.B. Personalentwicklung 2001c). Die Arbeit von Helmut Klages (2002) wird als Beispiel für die Darlegung dieser Diskrepanz herangezogen.
2. Beschreibung verschiedener Führungsstile und deren Relevanz für Bibliotheken
Der Abschnitt beschreibt verschiedene Führungsstile und deren Anwendbarkeit im Bibliothekskontext. Es werden der laissez-faire-Stil, der autoritäre Stil und ein situations- und personenbezogener Führungsstil vorgestellt. Der laissez-faire-Stil wird als ineffektiv beschrieben, da er weder dem Betriebsklima noch der Eigeninitiative der Mitarbeiter förderlich ist. Der autoritäre Führungsstil wird als ebenfalls wenig effektiv bewertet, kann aber in bestimmten Situationen, z.B. bei kundenunfreundlichem Verhalten, notwendig sein. Ein flexibler, situations- und personenbezogener Führungsstil, der sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter orientiert, wird als zeitgemäßer Ansatz empfohlen. Eine Studie mit 4000 Managern weltweit zeigt sechs Führungsstile auf, die von erfolgreichen Managern flexibel eingesetzt werden und mit emotionaler Intelligenz in Verbindung stehen. Der affiliative oder gefühlsorientierte Führungsstil wird als positiv für die Kommunikation und die Ideenfindung, besonders im Bereich der Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit, bewertet. Coaching wird als ein weiterer wichtiger Führungsstil hervorgehoben, der in wissenschaftlichen Bibliotheken zunehmend an Bedeutung gewinnt, wobei auch die Möglichkeit des Coachings für Führungskräfte selbst angesprochen wird.
3. Coaching als moderner Führungsansatz in Bibliotheken
Der Abschnitt konzentriert sich auf den coachenden Führungsstil und seine Bedeutung für die Personalentwicklung in Bibliotheken. Eine coachende Führungskraft unterstützt Mitarbeiter dabei, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und sich auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Dieser Stil erfordert von der Führungskraft Kompetenz und setzt beiderseitige Lernbereitschaft voraus. Der coachende Führungsstil wird als Beispiel für den Wandel der Ansprüche an den Führungsstil in Bibliotheken dargestellt. Der Bibliotheksmanager wird heute oft in der Rolle des Trainers, Helfers oder Coachs gesehen, der die Entwicklung der Mitarbeiterpotenziale unterstützt. Dieser Ansatz ist vor allem in wissenschaftlichen Bibliotheken verbreitet. In öffentlichen Bibliotheken ist es aber auch denkbar, dass Führungskräfte selbst Coaching in Anspruch nehmen, um Probleme im Kommunikations- und Führungsverhalten zu lösen. Dies ist besonders in größeren Bibliotheken relevant.
IV.Die Kunst der Kommunikation Schlüssel zur effektiven Mitarbeiterführung
Effektive Kommunikation ist ein zentrales Thema der Arbeit. Die Axiome von Watzlawick (1974b) – "Man kann nicht nicht kommunizieren" und der Zusammenhang von Inhalts- und Beziehungsaspekt – werden zur Analyse der zwischenmenschlichen Kommunikation in Bibliotheken herangezogen. Das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun wird vorgestellt. Aktives Zuhören und der Umgang mit Konflikten spielen eine wichtige Rolle. Die Transaktionsanalyse (TA) wird als Methode zur Analyse von Kommunikationsstörungen und zur Verbesserung des Umgang mit Mitarbeitern erläutert. Mitarbeitergespräche, deren Mangel in Bibliotheken im Vergleich zu Unternehmen beklagt wird, werden als wichtiges Instrument der Personalführung analysiert. Die Studie betrachtet die Situation in Frankfurt a.M. im Kontext des MAVG (Mitarbeiterentwicklungsgespräch).
1. Kommunikation als zentraler Aspekt effektiver Mitarbeiterführung
Der Abschnitt betont die fundamentale Bedeutung von Kommunikation für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung in Bibliotheken. Es wird hervorgehoben, dass effektive Kommunikation ein Schlüsselfaktor für ein positives Arbeitsklima, gesteigerte Motivation und verbesserte Leistungen der Mitarbeiter ist. Die Arbeit verweist auf die Notwendigkeit von Lernprozessen im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation, um diese Ziele zu erreichen. Das Axiom von Watzlawick (1974b) "Man kann nicht nicht kommunizieren" wird als Ausgangspunkt der Betrachtung herangezogen. Es wird deutlich gemacht, dass Kommunikation immer stattfindet, auch wenn keine Worte gewechselt werden. Dieses Verständnis soll Führungskräften helfen, die vielfältigen Kommunikationsaspekte im Arbeitsalltag zu erkennen und zu berücksichtigen. Der Abschnitt betont die Bedeutung eines bewussten Umgangs mit Kommunikation, ihren Grundlagen und Modellen, sowie das praktische Üben und Anwenden der Kenntnisse in der täglichen Arbeit. Albrecht Hatzius (1996) wird als Beispiel für einen Erfahrungsbericht zu Qualifizierungsangeboten im Bereich der Mitarbeiterführung in Bibliotheken genannt.
2. Axiome der Kommunikation nach Watzlawick und das Vier Ohren Modell
Dieser Abschnitt beschreibt die Axiome der Kommunikation nach Watzlawick, Beavin und Jackson (1967). Das erste Axiom, "Man kann nicht nicht kommunizieren", wird näher erläutert und auf die Situation in Bibliotheken angewendet (z.B. das Schweigen zwischen zerstrittenen Kollegen). Das zweite Axiom, wonach jeder Kommunikation ein Inhalts- und ein Beziehungsaspekt innewohnt, wobei der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt bestimmt, wird diskutiert. Die Bedeutung des Beziehungsaspekts für die Effektivität der Kommunikation wird hervorgehoben, wobei Probleme auf der Beziehungsebene häufig zu zeitintensiven und uneffektiven Diskussionen auf der Sachebene führen. Das Eisberg-Modell wird als Metapher für die Bedeutung von sozialer Kompetenz dargestellt, die sowohl die emotionale als auch die Sachebene umfasst. Der Abschnitt erläutert das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun (2003a) und die verschiedenen Botschaften, die in jeder Kommunikation enthalten sind. Die "ausgewogene Vierohrigkeit" wird als wichtige Voraussetzung für einen effektiven Kommunikationsaustausch dargestellt. Die Bedeutung von Feedback für die Verbesserung der Kommunikation wird betont.
3. Transaktionsanalyse TA und Mitarbeitergespräche
Dieser Abschnitt stellt die Transaktionsanalyse (TA) als Methode zur Analyse von Kommunikationsstörungen und zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation vor. Es wird erklärt, dass unser Denken, Fühlen und Verhalten von verschiedenen Ich-Zuständen beeinflusst wird und wie diese die Kommunikation prägen. Der Abschnitt thematisiert "psychologische Spiele" im Kontext der TA, die zu unguten Gefühlen führen und oft unbewusst ablaufen. Die Wichtigkeit von Mitarbeitergesprächen als Führungsinstrument wird hervorgehoben, wobei der deutliche Unterschied zwischen Unternehmen und Bibliotheken in der Nutzung dieser Gesprächsform betont wird. In Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Mitarbeitergesprächsarten, während sie in Bibliotheken eine marginale Rolle spielen. Der Leitfaden zum MAVG (Mitarbeiterentwicklungsgespräch) des Personal- und Organisationsamts der Stadt Frankfurt a.M. (Personalentwicklung 2001b) wird als Beispiel für eine Initiative zur Verbesserung von Mitarbeitergesprächen genannt. Die im Kontext der MAVG-Einführung aufgeworfenen Fragen der Mitarbeiter zeigen eine bestehende Misstrauenskultur und die noch nicht vollzogene Transformation hin zu einer Vertrauenskultur auf. Soziale und persönliche Kompetenzen werden als essentiell für effektive Mitarbeitergespräche hervorgehoben, wobei auch die Kundenorientierung im Bibliothekskontext miteinbezogen wird.
V.Methoden zur Verbesserung der Teamarbeit und Führungskompetenz
Die Arbeit stellt das TZI-Modell (Themenzentrierte Interaktion) als Methode zur Verbesserung der Gruppen- und Teamarbeit vor. Shackletons Führungskunst in Extremsituationen (Morrell & Caparell, 2003) dient als Beispiel für erfolgreiches Führungsverhalten. Das "management-by-Shakespeare" Programm wird als innovativer Ansatz zur Führungskräfteentwicklung präsentiert. Schließlich wird "Open Space" als unkonventionelle Konferenzmethode diskutiert, die auf freiwilliger Teilnahme und dem Vertrauen in die Teilnehmer basiert.
1. Grundlagen der Kommunikation und deren Bedeutung für Führungskräfte
Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Prinzipien effektiver Kommunikation im Kontext der Mitarbeiterführung in Bibliotheken. Er betont die Wichtigkeit eines bewussten Umgangs mit Kommunikation und deren Einfluss auf die Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Die Arbeit unterstreicht, dass theoretisches Wissen allein nicht ausreicht und die praktische Anwendung und das Training der Kommunikationsfähigkeiten essentiell sind. Die Axiome von Watzlawick (1974b), insbesondere "Man kann nicht nicht kommunizieren", werden eingeführt und deren Relevanz für den Umgang mit Mitarbeitern, auch in Konfliktsituationen, erläutert. Das Konzept des "aktiven Zuhörens" wird als wichtige Fähigkeit für Führungskräfte hervorgehoben, die das Eintauchen in die Gefühls- und Gedankenwelt des Gesprächspartners beinhaltet. Es wird der Unterschied zwischen oberflächlichem Zuhören und dem Versuch, den Gesprächspartner wirklich zu verstehen, hervorgehoben. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit, Kommunikationsmodelle und -grundlagen zu verstehen und in der täglichen Praxis anzuwenden, um einen motivierenden und leistungssteigernden Einfluss auszuüben. Der Erfahrungsbericht von Albrecht Hatzius (1996) über Qualifizierungsangebote für Führungsaufgaben in Bibliotheken wird erwähnt.
2. Inhalts und Beziehungsaspekt der Kommunikation und das Vier Ohren Modell
Dieser Abschnitt vertieft das Verständnis von Kommunikation anhand des zweiten Axioms von Watzlawick (1974b): Die Unterscheidung zwischen Inhalts- und Beziehungsaspekt wird erläutert, wobei der Beziehungsaspekt als bestimmend für den Inhaltsaspekt beschrieben wird. Konflikte zwischen Führungskraft und Mitarbeiter werden als Beispiel für die Verlagerung von Beziehungsproblemen auf die Sachebene angeführt, was zu zeitintensiven und oft uneffektiven Diskussionen führt. Das Eisberg-Modell wird als Metapher verwendet, um die unabdingbare Berücksichtigung der emotionalen Ebene bei der Kommunikation zu veranschaulichen. Nur durch das Akzeptieren der emotionalen Kräfte auf der Gefühlsebene kann ein gelungener Austausch auf der Sachebene stattfinden. Das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun (2003a) wird vorgestellt, das die Komplexität von Kommunikation verdeutlicht, indem es auf die verschiedenen Ebenen der Botschaft (Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell) hinweist. Die "ausgewogene Vierohrigkeit" wird als wichtige kommunikative Kompetenz genannt, und die Bedeutung von Feedback für die Überprüfung der Sendeabsicht und die Verbesserung des Kommunikationsflusses wird betont.
3. Transaktionsanalyse TA und Mitarbeitergespräche in Bibliotheken
Dieser Teil des Abschnitts befasst sich mit der Transaktionsanalyse (TA) und deren Anwendung auf Kommunikation im Bibliothekskontext. Die TA betrachtet unser Denken, Fühlen und Handeln als von verschiedenen Ich-Zuständen bestimmt und analysiert deren Einfluss auf das Kommunikationsverhalten. "Spiele der Erwachsenen" nach Berne (2002a) werden als komplizierte Kommunikationsmuster beschrieben, die zu negativen Gefühlen führen, aber oft unbewusst ablaufen. Der Abschnitt unterstreicht die Bedeutung von Mitarbeitergesprächen als Führungsinstrument, wobei der Mangel an systematischen Mitarbeitergesprächen in Bibliotheken im Vergleich zu Unternehmen kritisiert wird. Es wird ein breites Spektrum an Gesprächsarten im Unternehmensbereich erwähnt, von Anerkennungs- bis zu Zielvereinbarungsgesprächen. Der Leitfaden des Personal- und Organisationsamts Frankfurt a.M. zur Vorbereitung von Mitarbeiterentwicklungsgesprächen (MAVG, Personalentwicklung 2001b) wird als Beispiel genannt. Fragen von Mitarbeitern zur MAVG-Einführung verdeutlichen die bestehende Kluft zwischen den Zielen des MAVG und der Realität, die von Misstrauen geprägt ist. Soziale und persönliche Kompetenzen werden als grundlegend für effektive Mitarbeitergespräche, auch im Sinne der Kundenorientierung, hervorgehoben.
