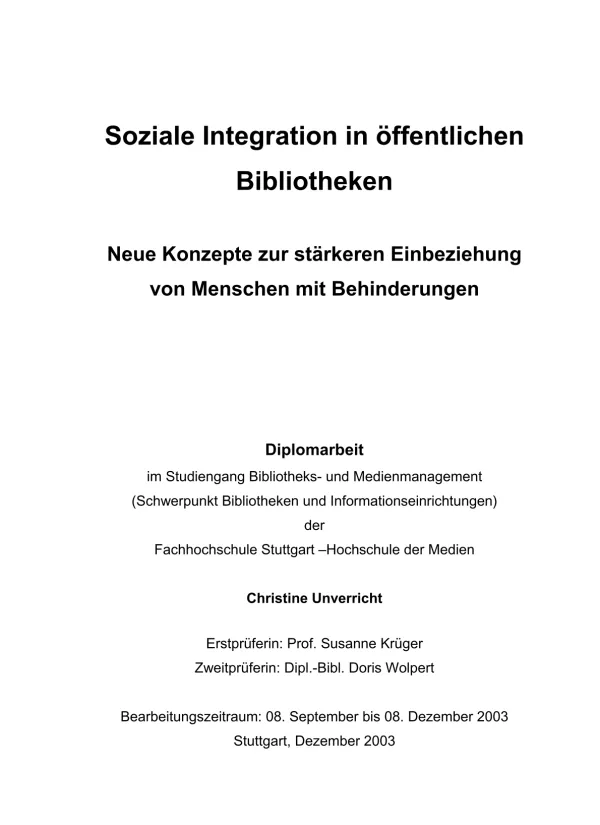
Soziale Integration: Bibliotheken & Behinderung
Dokumentinformationen
| Autor | Christine Unverricht |
| instructor | Prof. Susanne Krüger |
| Schule | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| Fachrichtung | Bibliotheks- und Medienmanagement (Schwerpunkt Bibliotheken und Informationseinrichtungen) |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.34 MB |
Zusammenfassung
I.Der Beitrag Öffentlicher Bibliotheken zur sozialen Integration von Menschen mit Behinderung
Diese Arbeit untersucht, wie öffentliche Bibliotheken einen Beitrag zur sozialen Integration von Menschen mit Behinderungen leisten können. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der sozialen Bibliotheksarbeit, zeigt die Notwendigkeit aktiver Zielgruppenarbeit auf und analysiert anhand des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung (EJMB), wie Bibliotheken aktuelle Anlässe für die Inklusion nutzen können. Die Studie stellt fest, dass die Integration von Menschen mit Behinderung in Deutschland stark vernachlässigt wird und plädiert für eine Stärkung der barrierefreien Angebote und der aufsuchenden Bibliotheksarbeit.
1. Ausgangssituation Benachteiligung von Menschen mit Behinderung in Deutschland
Die Arbeit beginnt mit der Feststellung, dass die soziale Integration von Menschen mit Behinderung in Deutschland stark vernachlässigt wird, obwohl soziale Teilhabe ein Grundrecht darstellt. Die Ausgrenzung wird anhand von Beispielen wie Sonderschulen und Sonderarbeitsstellen verdeutlicht, die zwar organisatorische Erleichterungen bieten, aber gleichzeitig eine Ghettosituation schaffen. Der Mangel an persönlichem Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung führt zu einem unzureichenden Verständnis der Herausforderungen und Diskriminierungen, denen Betroffene ausgesetzt sind. Die Autorin beschreibt ihre eigene Motivation für die Arbeit, die aus einem Projekt zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen (EJMB) resultiert und die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und Behindertenverbänden aufzeigt. Der Mangel an Inklusion wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Beitrags öffentlicher Bibliotheken zur Verbesserung der Situation definiert. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu schärfen und für mehr Teilhabe zu sorgen.
2. Historische Entwicklung der sozialen Bibliotheksarbeit und internationale Vergleiche
Es wird ein kurzer Überblick über die Entstehungsgeschichte der sozialen Bibliotheksarbeit gegeben, wobei die ursprünglichen sozialen Intentionen der Bibliotheksgründung hervorgehoben werden. Ein Vergleich mit internationalen Entwicklungen, insbesondere in Skandinavien, England und den USA, zeigt, dass soziale Integration in öffentlichen Bibliotheken in anderen Ländern bereits erfolgreich etabliert ist und nicht nur eine Wunschvorstellung darstellt. Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Konzepte und Entwicklungen im öffentlichen Bibliothekswesen, z.B. den Gegensatz zwischen Bildungsbüchereien mit pädagogisch ausgewählten Beständen und dem angelsächsischen Modell der Public Library mit Freihandausleihe. Die NS-Zeit wird als einschneidende Unterbrechung der positiven Entwicklung erwähnt, in der die Bestände nach ideologischen Kriterien aussortiert und Bücher vernichtet wurden. Die Herausforderungen bei der Entwicklung der sozialen Bibliotheksarbeit werden durch fehlende Bibliotheksgesetze verdeutlicht, die die praktische Umsetzung notwendiger Maßnahmen behindern. Die Studie hebt hervor, dass soziale Bibliotheksarbeit nicht nur Angebote bereitstellt, sondern auch die Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken durch potentielle Benutzergruppen erforscht und aktiv angeht, um neue Zielgruppen zu gewinnen. Das Beispiel der 'services to the disadvantaged' in den USA in den 1960er Jahren wird als Beispiel für die Reaktion auf soziale Veränderungen und die Notwendigkeit neuer Bibliotheksdienste genannt.
3. Der Ist Zustand in deutschen Bibliotheken Analyse und Herausforderungen
Ein gemeinsames Projekt von BDB und Bertelsmann Stiftung (Bibliothek 2007) wird zitiert, welches die Rolle der Bibliotheken in Bildung und Kultur untersucht hat. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis öffentlicher Bibliotheken als Institutionen für alle Bevölkerungsschichten und der Realität: Studien belegen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung Bibliotheken nicht nutzt. Menschen mit Behinderungen werden in der Aufzählung potentieller Zielgruppen oft gar nicht berücksichtigt. Die Studie kritisiert die Tendenz, Angebote an bereits bestehende Benutzergruppen anzupassen, anstatt aktiv neue Zielgruppen wie Menschen mit Behinderung zu erreichen. Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Überwindung von Nutzungshindernissen (Mobilität, Barrierefreiheit, Schwellenängste) auch die aktive Ansprache und die Entwicklung passgenauer Angebote für Menschen mit Behinderungen notwendig sind. Die Arbeit betont, dass die Integration von Menschen mit Behinderung nicht nur durch aufsuchende Bibliotheksarbeit, sondern auch durch inklusive Angebote in den Bibliotheken selbst erreicht werden muss, um soziale Teilhabe im eigentlichen Bibliotheksumfeld zu ermöglichen. Der Vergleich mit dem dänischen Modell zeigt, dass selbst in Ländern mit etablierten aufsuchenden Diensten erhebliche Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Bibliothekaren und Menschen mit Behinderung bestehen und Verbesserungspotenzial besteht.
II.Soziale Bibliotheksarbeit Historischer Überblick und Herausforderungen
Die Arbeit verdeutlicht, dass die ersten Bibliotheken oft aus sozialen Intentionen entstanden sind. Ein internationaler Vergleich (Skandinavien, England, USA) zeigt, dass erfolgreiche soziale Bibliotheksarbeit und mobile Bibliotheksdienste in anderen Ländern bereits etabliert sind. In Deutschland hingegen mangelt es an Bibliotheksgesetzen, die die Umsetzung notwendiger barrierefreier Angebote und Zielgruppenarbeit unterstützen. Die Studie betont die Wichtigkeit neuer bibliothekarischer Arbeitsformen und -inhalte, um alle Bevölkerungsschichten, inklusive Menschen mit Behinderung, zu erreichen. Fehlende finanzielle Mittel und die Konzentration auf die „breite Masse“ stellen große Hürden dar.
1. Die Anfänge und Entwicklung sozialer Bibliotheksarbeit
Der Text betont, dass die Ursprünge öffentlicher Bibliotheken oft in sozialen Anliegen begründet lagen – ein Aspekt, der heute häufig vergessen wird. Die Entwicklung der sozialen Bibliotheksarbeit wird kurz skizziert, wobei unterschiedliche Konzepte beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich mit angelsächsischen Modellen (Public Libraries in den USA und Großbritannien), die mit Freihandausleihe und einem stärker nutzerorientierten Ansatz einen Kontrast zu den eher pädagogisch geprägten Bildungsbüchereien bildeten. Dieser Gegensatz führte zu Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung des Bibliothekswesens, die mit dem Beginn des NS-Regimes unterbrochen und durch die ideologisch motivierte Aussonderung und Vernichtung von Büchern nachhaltig beeinträchtigt wurde. Spätere Forderungen nach einer Neuorientierung, wie sie z.B. von Joseph Höck formuliert wurden, betonen die Notwendigkeit, sich stärker an den Bedürfnissen der Öffentlichkeit zu orientieren und von ausländischen Vorbildern zu lernen, fanden aber zunächst nur begrenzten Anklang. Die Wiederbelebung des früheren Konzepts der Volksbibliothek blieb wenig erfolgreich.
2. Herausforderungen und Probleme der sozialen Bibliotheksarbeit in Deutschland
Ein zentrales Problem ist das Fehlen von Bibliotheksgesetzen, die die Entwicklung und Finanzierung der sozialen Bibliotheksarbeit in Deutschland behindern. Obwohl die Notwendigkeit, neue Bibliotheksnutzer zu gewinnen, anerkannt ist, mangelt es an der praktischen Umsetzung. Gesetze könnten zwar keine finanzielle Garantie darstellen, aber verbindliche Normen könnten einen einheitlichen Entwicklungsstandard ermöglichen. Czudnochowski und Lüdtke betonen die Notwendigkeit, die Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken zu erforschen und aktiv zu bekämpfen. Soziale Bibliotheksarbeit sollte neue Arbeitsformen, -methoden und -inhalte entwickeln und laufend überprüfen, um alle Bevölkerungsschichten zu erreichen, insbesondere benachteiligte Gruppen. Das Beispiel der „services to the disadvantaged“ in den USA ab den 1960er Jahren wird angeführt, die als Reaktion auf soziale Veränderungen und den Vorwurf der ausschließlichen Orientierung an der „weißen Mittelschicht“ entstanden sind. Die Studie analysiert, dass öffentliche Bibliotheken in Deutschland trotz des sozialen Auftrags oft nicht in der Lage sind, alle Bevölkerungsschichten, insbesondere benachteiligte Gruppen, zu erreichen.
3. Internationaler Vergleich und die Rolle aufsuchender Dienste
Der Text vergleicht die Situation in Deutschland mit dem Ausland, insbesondere mit Skandinavien, England und den USA. In Skandinavien ist die aufsuchende Bibliotheksarbeit (mobile Bibliotheksdienste) ein fester Bestandteil des Bibliothekswesens, z.B. der 'boken kommer'-Dienst in Schweden seit 1955. Diese Dienste zeichnen sich durch individuelle Betreuung, regelmäßige Besuche bei den Nutzern und die Zusammenstellung persönlicher Bücherpakete aus. Eine wichtige Rolle spielt die Kooperation mit Kommunen und Behindertenorganisationen. Im Gegensatz dazu hat sich der mobile Bücherdienst in Deutschland nicht durchgesetzt, wird oft als Luxus angesehen und nur von wenigen Bibliotheken angeboten. Die Arbeit betont, dass die aufsuchende Bibliotheksarbeit ein wichtiger Bestandteil der sozialen Integration ist, jedoch auch die Bibliotheksangebote für diejenigen verbessert werden müssen, die die Bibliothek selbst aufsuchen können. Soziale Integration darf nicht nur „hinter verschlossenen Türen“ stattfinden. Die Notwendigkeit von Kooperation mit anderen Institutionen, um Ressourcen zu sparen und neue Zielgruppen zu erreichen wird ebenfalls betont. Die erfolgreiche Umsetzung von Programmen hängt stark vom Engagement der Mitarbeiter ab, die Empathie, Flexibilität und interdisziplinäre Zusammenarbeit benötigen.
III.Bedarfsanalyse und Praxisbeispiele Barrierefreiheit und Inklusion in der Realität
Die Analyse zeigt, dass öffentliche Bibliotheken ihr Kundenpotenzial bei Menschen mit Behinderung weitgehend ungenutzt lassen. Auch wenn Bibliotheken von sich behaupten, für alle da zu sein, fehlen oft konkrete Angebote und die Zielgruppenarbeit ist unzureichend. Der Vergleich mit internationalen Beispielen, insbesondere Skandinavien, unterstreicht die Notwendigkeit von aufsuchenden Bibliotheksdiensten (z.B. der 'boken kommer'-Dienst in Schweden) und einer intensiveren Kooperation mit Behindertenverbänden. Beispiele wie die Stadtbücherei Augsburg mit ihren Angeboten für Seh- und Hörbehinderte zeigen positive Ansätze, bleiben aber Ausnahmen. Die Studie betont die Notwendigkeit von Empathie, Flexibilität und Zusammenarbeit mit Fachkräften aus anderen Bereichen für eine erfolgreiche soziale Integration.
1. Analyse des Ist Zustands Ungenutzte Potenziale und fehlende Barrierefreiheit
Die Arbeit analysiert den aktuellen Zustand der Barrierefreiheit und Inklusion in deutschen öffentlichen Bibliotheken. Ergebnisse des Projekts „Bibliothek 2007“ zeigen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung (25-45%) Bibliotheken nicht nutzt. Öffentliche Bibliotheken selbst überschätzen oft ihren Erfolg bei der Erreichung aller Bevölkerungsschichten. Die Studie kritisiert, dass Menschen mit Behinderungen in der Auflistung potentieller Zielgruppen oft gar nicht erwähnt werden, obwohl sie einen erheblichen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Die Fokussierung auf die Anpassung des Angebots an bereits bestehende Benutzergruppen anstatt auf die aktive Gewinnung neuer Zielgruppen wird als Problematik hervorgehoben. Der Text zeigt auf, dass die Überwindung von Nutzungshindernissen, wie Mobilitätseinschränkungen oder Schwellenängste, durch Maßnahmen wie Bringdienste oder benutzerfreundliche Kataloge zwar wichtig sind, aber nicht ausreichen, um Menschen mit Behinderungen effektiv zu erreichen. Die Notwendigkeit, die Angebote gezielt an die Bedürfnisse dieser Zielgruppe anzupassen, wird unterstrichen.
2. Internationale Best Practice Beispiele Aufsuchende Bibliotheksarbeit und inklusive Angebote
Im Gegensatz zum deutschen Ist-Zustand werden internationale Beispiele erfolgreicher sozialer Bibliotheksarbeit vorgestellt. In Skandinavien, insbesondere Schweden, ist der mobile Bücherdienst („boken kommer“) ein etablierter Bestandteil des Bibliothekswesens. Der Dienst beinhaltet regelmäßige Besuche bei den Nutzern, die individuelle Zusammenstellung von Bücherpaketen und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Modells wird auf die Kooperation mit Kommunen, Behindertenorganisationen und Sozialdiensten zurückgeführt. Das Beispiel verdeutlicht die Bedeutung von persönlicher Betreuung, Einfühlungsvermögen und Kenntnis der Lebensumstände der Zielgruppe. Auch die Stadtbücherei Augsburg wird als positives Beispiel für inklusive Angebote genannt, die eine Medienecke für Hörbehinderte neben bereits bestehenden Angeboten für Sehbehinderte bietet. Der Vergleich mit dem dänischen System zeigt, dass selbst bei flächendeckendem Angebot aufsuchender Dienste Missverständnisse in der Kommunikation und ein Mangel an wahrgenommener Gleichberechtigung bestehen können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe besser zu verstehen und die Angebote entsprechend anzupassen.
3. Fazit und Handlungsempfehlungen Verbesserung der Barrierefreiheit und Inklusion
Die Analyse zeigt deutlich den Handlungsbedarf für deutsche Bibliotheken, um die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Es wird die Notwendigkeit von aufsuchender Bibliotheksarbeit betont, die in Deutschland trotz einzelner Beispiele noch nicht zum Standard gehört. Auch die Verbesserung der Angebote innerhalb der Bibliotheken ist unerlässlich, um Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Nutzer zu gewinnen. Die Arbeit betont, dass soziale Integration nicht nur durch aufsuchende Dienste, sondern auch durch die Schaffung barrierefreier und inklusiver Umgebungen in den Bibliotheken selbst erreicht werden kann. Erfolgreiche Integration benötigt eine aktive Zielgruppenarbeit, die über die reine Bereitstellung von Hilfsmitteln hinausgeht. Die Notwendigkeit von Empathie, Flexibilität und der Zusammenarbeit mit Fachkräften aus anderen Bereichen wird hervorgehoben. Zusammenfassend plädiert der Text für einen bewussteren Umgang mit der Thematik der Inklusion und für die Umsetzung konkreter Maßnahmen, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Bibliotheksleben zu gewährleisten.
IV.Konzepte zur Verbesserung der Inklusion in öffentlichen Bibliotheken
Die Arbeit präsentiert Konzepte zur Verbesserung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in öffentlichen Bibliotheken. Ein Jugend-Workshop („Beethoven war taub!“) und Klassenführungen („Anders sehen, anders hören, anders bewegen“) sollen Berührungsängste abbauen und Vorurteile reduzieren. Die Arbeit hebt die Bedeutung von barrierefreier Gestaltung, der Bereitstellung spezifischer Medien (z.B. Großdruck, Hörbücher, Braille) und einer aktiven Ansprache der Zielgruppe hervor. Kooperationen mit anderen Institutionen sind essentiell, um die Reichweite der Bibliotheksangebote zu erweitern und die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu fördern. Die Deklaration von Madrid wird als relevantes Dokument für die Umsetzung der Inklusion erwähnt.
1. Die Notwendigkeit aktiver Zielgruppenarbeit
Um Menschen mit Behinderungen erfolgreich in das Bibliotheksgeschehen einzubinden, reicht es nicht aus, auf deren Eigeninitiative zu warten. Aktive Zielgruppenarbeit ist unerlässlich. Da die Anzahl der behinderten Bibliotheksnutzer meist gering ist und der Zugang zu Adressen aus Datenschutzgründen eingeschränkt ist, stellt das Erreichen der Zielgruppe eine Herausforderung dar. Die Bibliothek kann sich als Forum für Behindertengruppen anbieten, um Vertrauen und Identifikation aufzubauen. Die Verbreitung von Informationsmaterial über verschiedene Kanäle wie Sozialämter, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Arztpraxen, Selbsthilfegruppen und Zeitungen wird als wichtig angesehen. Der Text betont, dass Bibliotheken ihre Angebote nicht nur an bereits bestehende Nutzergruppen anpassen, sondern aktiv neue Zielgruppen ansprechen müssen, um ihre gesellschaftliche Aufgabe der sozialen Integration zu erfüllen. Die aktive Ansprache und die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten sind entscheidend für den Erfolg.
2. Konkrete Konzepte zur Inklusion Workshops und Klassenführungen
Der Text präsentiert verschiedene Konzepte zur Inklusion in öffentlichen Bibliotheken, die über die reine Bereitstellung von barrierefreien Angeboten hinausgehen. Ein Beispiel ist ein Jugend-Workshop mit dem Titel „Beethoven war taub!“, der behinderte und nichtbehinderte Jugendliche zusammenbringen soll, um Berührungsängste abzubauen und positive Beispiele für das Leben mit Behinderung aufzuzeigen. Die Methode beinhaltet die Auseinandersetzung mit Biografien bekannter Persönlichkeiten mit Behinderungen, um Vorbilder zu präsentieren und ein positives Bild von Inklusion zu vermitteln. Ein weiteres Beispiel ist eine Klassenführung mit dem Titel „Anders sehen, anders hören, anders bewegen“ oder „Es ist normal, verschieden zu sein!“, die auf die Sensibilisierung für verschiedene Arten von Behinderungen abzielt und durch die Vermittlung von Literatur und Filmen Verständnis und Akzeptanz fördern soll. Die Auswahl von Büchern und Filmen wie z.B. „Freak – The Mighty“ und „Die Reise zum Meer“ illustriert die Möglichkeit, die Themen Behinderung und Inklusion auf unterschiedliche Weise und für verschiedene Altersgruppen aufzubereiten.
3. Weitere Konzepte und Schlussfolgerungen Barrierefreiheit und gesellschaftliche Akzeptanz
Zusätzlich zu den Workshops und Klassenführungen werden weitere Konzepte vorgeschlagen, um die Interessen und Belange von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. Die Deklaration von Madrid wird als relevantes Dokument für Inklusion erwähnt. Ein Beispiel ist die Veranstaltung „Blind sein? Drin sein!“, die blinde und sehende Menschen zusammenbringt, um Vorurteile abzubauen und die Fähigkeiten blinder Menschen im Umgang mit Computern und anderen Technologien zu zeigen. Die Bedeutung von barrierefreier Gestaltung wird hervorgehoben. Die Arbeit betont, dass die meisten Menschen die Aufgabenbereiche öffentlicher Bibliotheken nicht kennen, weshalb die Notwendigkeit einer aktiven Vermittlung der Angebote an die Zielgruppe unterstrichen wird. Die vorgestellten Konzepte dienen als Anregung für Bibliotheken, eigene Ideen zur Inklusion zu entwickeln und aktiv auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen. Die Autorin plädiert für ein Bewusstmachen des Rechts auf bibliothekarische Angebote für alle und die Umsetzung dieses Anspruchs durch Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
