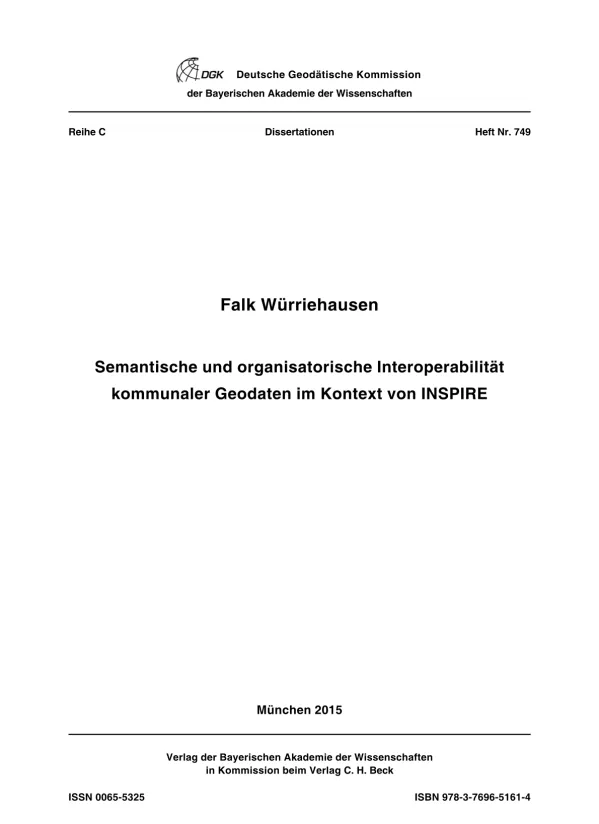
Geodaten-Interoperabilität: INSPIRE
Dokumentinformationen
| Autor | Falk Würriehausen |
| Schule | Universität Rostock |
| Fachrichtung | Ingenieurwissenschaften |
| Ort | München |
| Dokumenttyp | Dissertation |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 14.23 MB |
Zusammenfassung
I.INSPIRE und die Herausforderungen der Geodateninfrastruktur in Rheinland Pfalz
Die Arbeit untersucht die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie zur Geodateninfrastruktur in der kommunalen Verwaltung von Rheinland-Pfalz. Ein zentrales Problem ist die Heterogenität der vorhandenen Geodaten (Shapefiles, DXF, GeoTIFF, PDF etc.) und Geoinformationssysteme (GIS). Dies erschwert die Interoperabilität und den Datenaustausch zwischen Kommunen und auf europäischer Ebene. Die Studie analysiert, wie semantische und organisatorische Interoperabilität erreicht werden kann, um umweltrelevante Geodaten für eine nachhaltige europäische Umweltpolitik und die Bürger zugänglich zu machen. Besondere Beachtung findet dabei die Integration von Standards wie XPlanung und ALKIS.
1. Die INSPIRE Richtlinie und ihre Herausforderungen in Rheinland Pfalz
Die europäische INSPIRE-Richtlinie zielt auf die Schaffung einer harmonisierten Geodateninfrastruktur ab, um umweltrelevante Daten für eine nachhaltige europäische Umweltpolitik und die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Umsetzung dieser Richtlinie in Rheinland-Pfalz (GDI-RP) stellt jedoch erhebliche Herausforderungen dar, die im Kern in der Heterogenität der bestehenden Geodaten und der unterschiedlichen Geoinformationssysteme (GIS) der kommunalen Verwaltungen liegen. Es besteht eine Vielzahl an Datenformaten (Shapefiles, DXF, GeoTIFF, PDF etc.), die von verschiedenen Fachprogrammen verarbeitet werden. Diese Heterogenität behindert die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Ebenen und Systemen, was eine reibungslose Zusammenarbeit, insbesondere auf operativer Ebene, stark einschränkt. Die Studie untersucht daher, wie trotz heterogener Organisations- und Datenstrukturen eine effiziente Zusammenarbeit sichergestellt werden kann, und wie die bereits vorhandenen Geodaten der Mitgliedsstaaten schrittweise interoperabel bereitgestellt werden können, um die Entscheidungsfindung in umweltpolitischen Fragen zu unterstützen. Das Hauptproblem ist die mangelnde Interoperabilität aufgrund der heterogenen Datenbestände und die daraus resultierende Schwierigkeit des interkommunalen Datenaustauschs.
2. Der aktuelle Stand des Geodatenmanagements in rheinland pfälzischen Kommunen
Die Untersuchung analysiert die Praxis der kommunalen Anwendung von Geoinformationssystemen (GIS) in Rheinland-Pfalz. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bewältigung der Datenheterogenität, sowohl auf der Ebene der Datenformate als auch der Speicherung und Verwaltung der Geoinformationen. Die Studie berücksichtigt dabei das gesamte Spektrum des Datenaufkommens, von analogen Akten und Plänen bis hin zu digitalen Formaten (Microsoft-Office, Postscript) und Datenbanken. Ein wichtiges Thema ist die Überführung von Bezugsdaten (Adressen) und die oft fehlende elektronische Georeferenzierung von PDF-Dokumenten und anderen Dateien. Die Arbeit untersucht, wie kommunale Geodaten in den verschiedenen GIS-Systemen verarbeitet und verwaltet werden und welche Herausforderungen sich daraus für die Interoperabilität ergeben. Die Heterogenität der Systeme und Formate (z.B. Shape-Format, DXF, GeoTIFF, PDF) sowie die gewachsenen Verwaltungsstrukturen führen zu Problemen im interkommunalen Datenaustausch. Die Studie sucht daher nach einem semantischen und organisatorischen Konzept für eine reibungslose Zusammenarbeit, auch in einer heterogenen Datenlandschaft. Die Integration kommunaler Daten auf semantischer Ebene und die Überführung auf syntaktischer Ebene ohne Informationsverlust werden als wesentliche Herausforderungen identifiziert.
3. Förderung der Interoperabilität durch Technologie und Standardisierung
Ein wichtiger Aspekt der Studie ist die Erforschung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Interoperabilität durch den Einsatz von Technologien und Standards. Die Spezifikationen des Open Geospatial Consortium (OGC), wie WebMapService (WMS) und WebFeatureService (WFS), werden als technologische Grundlage für den Datenaustausch genannt. Der Austausch von semantischen Datenmodellen mithilfe von XPlanung oder ALKIS wird diskutiert. Die Arbeit analysiert, wie die Heterogenität der Daten durch den Einsatz von Standards des Semantic Web und Ontologien (RDF, OWL) gelöst werden kann. Der Fokus liegt darauf, bestehende Datensätze zu nutzen und Mehrfacherfassungen zu vermeiden. Die Entwicklungen von europäischen Geoportalen mit INSPIRE-Metadaten, View- und Download-Services werden als Beispiel für den Nutzen von heterogenen und verteilten Daten angeführt. Die Studie zeigt auf, wie bereits vorhandenes Wissen über kommunale Geodaten auf europäischer Ebene genutzt werden kann. Die Untersuchung zielt darauf ab, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu identifizieren, die für eine erfolgreiche Implementierung der INSPIRE-Richtlinie in den rheinland-pfälzischen Kommunen notwendig sind. Hierbei spielt die Bereitstellung von Geodaten über einen kommunalen Server eine wichtige Rolle.
4. Die Rolle von GeoPortal.rlp und die Zusammenarbeit mit Kommunen
Die Arbeit hebt die Bedeutung des GeoPortals.rlp (www.GeoPortal.rlp.de) für die Bereitstellung kommunaler Geofachdaten hervor. Dieser Server soll die Bereitstellung von Daten durch Landkreise, Verbandsgemeinden, Städte und Ortsgemeinden vereinfachen und einen breiten Nutzerkreis ansprechen. Die Plattform bietet die Möglichkeit, digitale Geofachdaten und Satzungen mit Raumbezug (z.B. Bebauungspläne) sicher, schnell und standardkonform bereitzustellen. Für die Kommunen ist der Server attraktiv, da er den Austausch von Geofachdaten außerhalb interner Netzwerke ermöglicht. Um die semantische Harmonisierung von Darstellungen und Sachattributen zu gewährleisten, wird die Erstellung eines Leitfadens zur Bereitstellung INSPIRE-konformer kommunaler Geodaten in der GDI-RP vorgeschlagen. Dieser Leitfaden soll sicherstellen, dass die Datenqualität (Darstellung, Grunddatenbestand, Metadaten) unabhängig vom Erfassungsort einheitlich ist. Die Zusammenarbeit zwischen Landkreistag Rheinland-Pfalz, Städtetag Rheinland-Pfalz, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und der Hochschule Mainz wird als Beispiel für erfolgreiche GIS-Aktivitäten zur Einbindung der Kommunen in den Aufbau der GDI-RP genannt. Die Arbeit betont die große Bedeutung der kommunalen Geofachdaten für staatliche Stellen und die Öffentlichkeit.
II.Modelltransformation und Semantische Interoperabilität für INSPIRE
Die Studie evaluiert verschiedene Ansätze der Modelltransformation um INSPIRE-konforme Geodaten bereitzustellen. Untersucht werden Transformationen auf Datenebene (ETL-Prozesse) und auf Service-Ebene (z.B. mit CST-WPS). Die Nutzung von Ontologien (RDF, OWL) und semantischen Web-Technologien zur Lösung von Heterogenitätsproblemen spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Ziel ist die Entwicklung eines semantischen GIS, das die Interoperabilität von Geodaten verschiedener Formate und Quellen ermöglicht. Die Arbeit vergleicht modellbasierte Transformationen mit syntaktischen Strukturumbauten auf Formatebene (z.B. DXF nach XPlanGML).
1. Ansätze der Modelltransformation für INSPIRE konforme Daten
Die Arbeit untersucht verschiedene Ansätze zur Transformation von Geodaten, um die Anforderungen der INSPIRE-Richtlinie zu erfüllen. Ein zentrales Thema ist die Überführung heterogener Datenformate in das INSPIRE-Datenmodell. Es werden dabei verschiedene Ebenen der Transformation betrachtet: Transformationen auf Datenebene, bei denen datennahe Lösungen wie ETL (Extract-Transform-Load)-Prozesse zum Einsatz kommen, und Transformationen auf Service-Ebene, welche die Integration in bestehende Geodateninfrastrukturen ermöglichen. Dabei wird die Herausforderung der Datenheterogenität (Shapefiles, DXF, GML, Datenbanktabellen etc.) und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Interoperabilität betont. Für die Transformation auf Datenebene wird gezeigt, wie Geodaten proprietärer Formate in INSPIRE-GML umgewandelt werden können. Die Grenzen dieser datennahen Methode werden aber auch deutlich gemacht, besonders in Bezug auf die nicht standardkonforme Exportfähigkeit der Transformationsregeln und die daraus resultierenden hohen Kosten für die Anwendung in den Kommunen von Rheinland-Pfalz. Trotzdem wird bestätigt, dass diese Tools eine Datentransformation nach INSPIRE ermöglichen. Der Einsatz von semantischen Web-Technologien und Ontologien (RDF, OWL) wird als wichtiger Ansatz zur Lösung von Heterogenitätsproblemen im Datenmanagement hervorgehoben. Die Studie argumentiert, dass die gemeinsame Nutzung bestehender Datensätze effizienter ist als die separate Erfassung neuer Daten für jede Anwendung.
2. Semantische Interoperabilität und der Einsatz von Standards
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der semantischen Interoperabilität. Die Studie untersucht, wie semantische Modelle und Ontologien eine verbesserte Bereitstellung von Geodaten für INSPIRE ermöglichen können. Die Verwendung von Standards wie XPlanung und ALKIS zur Erleichterung des Datenaustauschs wird diskutiert. Es werden die Vorteile eines eindeutigen Transformationsmodells und die IT-Steuerung der Interoperabilität durch konsolidierte Modelle und XSD-Schemata betont. Die Arbeit analysiert, wie die unterschiedlichen kartografischen Darstellungsmodelle (INSPIRE vs. deutsches Planungsrecht) die Transformation erschweren und verweist auf zukünftige Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Die Bedeutung von vereinbarten Regeln für die Bereitstellung kommunaler Daten und für Dienste, die umfangreiche räumliche Daten verarbeiten können, wird hervorgehoben. Es wird untersucht, wie die INSPIRE-Anforderungen bezüglich der semantischen und organisatorischen Interoperabilität erfüllt werden können. Die Herausforderung besteht darin, ein gemeinsames Klassen- und Beziehungsmodell für heterogene Datensätze zu erstellen, wobei die Nutzung der RDF-Sprache (Resource Description Framework) als entscheidend angesehen wird. Der aktuelle Stand der Technik im Bereich der semantischen Transformation wird ebenfalls referenziert.
3. Transformation auf Service Ebene mit CST WPS und OGC Standards
Die Arbeit beschreibt die Implementierung eines INSPIRE-konformen Transformationsdienstes auf Service-Ebene. Als Technologie wird der CST-WPS (Conceptual Schema Transformator - Web Processing Service) mit dem Humboldt-Alignment Editor verwendet. Dabei werden Transformationsregeln zwischen Quell- und Zielschema definiert, wobei GML als weit verbreiteter Standard für geografische Daten dient. Für die Kodierung der Transformationsregeln wird die Ontologie Mapping Language (OML) eingesetzt. Der Prozess wird im Detail erläutert, inklusive der Verwendung der OGC WPS-Parameter describeProcess und Execute. Die Arbeit zeigt, wie durch Modifikation dieser Parameter ein INSPIRE-konformer Transformationsdienst implementiert werden kann, der automatische und halbautomatische Funktionen zur Datenqualitätssicherung beinhaltet. Die automatisierten Funktionen konzentrieren sich auf die Prüfung auf logische Konsistenz, während der halbautomatische Service menschliche Eingriffe für Aufgaben wie die Daten-Generalisierung ermöglicht. Die Implementierung von Wissensmanagement in Schema-Mapping-Anwendungsfeldern wird als ein weiterer Ansatz zur Unterstützung der Interoperabilität auf lokaler Ebene vorgestellt. Die Nutzung eines Referenzmodells für INSPIRE-Geodateninfrastrukturen wird empfohlen, um die Interoperabilität über die Grenzen der EU-Mitgliedsstaaten hinweg zu gewährleisten.
III.Geo Government und die Rolle der Kommunen in der GDI RP
Die Arbeit definiert ein Modell für Geo-Government in Kommunen, das die Interoperabilität von E-Government-Prozessen mit Raumbezug fördert. GIS-Systeme bilden den Kern dieses Modells. Es werden verschiedene Ausbaustufen von GIS (Desktop, Web, Mobil) und die Rolle der Geo-Partizipation betrachtet. Die Studie untersucht den Status quo der GIS-Landschaft in Rheinland-Pfalz anhand von Pilotkommunen (Mainz, Ludwigshafen, Idar-Oberstein, Landau, Bingen am Rhein, Gau-Algesheim, Arzfeld, Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen). Es werden Handlungsempfehlungen für ein strategisches GIS-Management abgeleitet. Die Nutzung von Webdiensten (WMS, WFS, CSW) für die Bereitstellung von Geodaten im GeoPortal.rlp.de wird analysiert.
1. Konzeption eines Geo Government Modells für Kommunen
Die Arbeit entwickelt ein Modell für Geo-Government in rheinland-pfälzischen Kommunen, welches die Integration von raumbezogenen Daten und Prozessen in die E-Government-Strategie des Landes einbezieht. Dieses Modell basiert auf der Definition von Interoperabilität und dem in Abbildung 22 dargestellten Modell. Geo-Informationssysteme (GIS) bilden dabei den zentralen Baustein, um Geodaten zu erfassen, zu verwalten, zu analysieren und zu präsentieren. Durch IT-Steuerung werden Ressourcen, Prozesse und Standards für Geodaten, Metadaten, Datenkommunikation und semantische Modelle eingeführt, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Die Einbindung der Politik, eine produkt- und dienstleistungsorientierte Verwaltung sowie die Berücksichtigung organisatorischer und rechtlicher Regelungen ermöglichen die Bürgerbeteiligung an raumbezogenen Prozessen. Konkrete Anwendungsfälle umfassen Prozesse im Bauwesen und der Planung, im Umweltbereich, in Kultur und Demografie sowie in der Daseinsvorsorge (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.). Diese Prozesse werden über den Raumbezug verwaltet, analysiert und mit Geoinformationen präsentiert. Das Modell zielt darauf ab, die Effizienz und Transparenz der Verwaltung zu erhöhen und gleichzeitig die Bürgerbeteiligung zu fördern. Es geht über die reine Bereitstellung von Informationen auf Gemeinde-Websites hinaus und integriert Geodaten aktiv in administrative Prozesse.
2. Analyse der GIS Landschaft in Rheinland Pfalz und Pilotkommunen
Die Studie analysiert den Status quo der GIS-Landschaft in Rheinland-Pfalz, um die Anforderungen des kommunalen Geodatenmanagements zu beschreiben und technisch im Rahmen der GDI-RP umzusetzen. Hierfür wurden verschiedene kommunale Geodateninfrastrukturen (GDI) im Untersuchungsgebiet ausgewählt und hinsichtlich ihrer Komponenten und der INSPIRE-Relevanz der umweltrelevanten Geofachdaten bewertet. Die Analyse umfasst die vorhandenen GIS-Software und -Daten in den Pilotverwaltungen Mainz, Ludwigshafen, Idar-Oberstein, Landau, Bingen am Rhein, Gau-Algesheim, Arzfeld sowie die Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen. Ziel ist es, die Anforderungen des kommunalen Geodatenmanagements zu beschreiben und auf Basis einer Modalwertberechnung eine strategische Bewertung des GIS-Potenzials abzuleiten. Es wird untersucht, welche Komponenten vollständig eingeführt sind und wo kommunenübergreifende Potentiale für gesteuerte Maßnahmen bestehen. Die Ergebnisse liefern eine Grundlage für strategische Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Geodatenmanagements in den Kommunen. Die Integration von E-Government-Prozessen der Bauleitplanung unter Nutzung von INSPIRE zum Datenaustausch sowie die Konzeption einer Online-Komponente für heterogene Daten werden als noch nicht ganzheitlich untersuchte Forschungsfelder identifiziert.
3. Bewertung des GIS Potentials und Ableitung von Handlungsempfehlungen
Die Auswertung der Daten aus den Pilotkommunen erfolgt mithilfe einer Modalwertberechnung, um das GIS-Potential strategisch zu bewerten. Die Analyse zeigt, welche Komponenten in den sechs Pilotkommunen vollständig eingeführt sind und wo Potentiale für Maßnahmen bestehen (nicht vorhanden oder geplant). Die Häufigkeit der Nennungen und die Berechnung des Modalwertes dienen als Grundlage für wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Es wird empfohlen, die Themen Metadaten, den Standard XPlanung, die Anbindung der Politik und Fachprozesse sowie die Bereitstellung von Webdiensten für INSPIRE durch einen wissenschaftlichen Beitrag zu unterstützen. Die Semantik, die Geo-Partizipation und das Geo-Government werden als konkrete Entwicklungsansätze für Kommunen beschrieben. Die Studie untersucht den Einführungsgrad verschiedener Komponenten in den Pilotkommunen anhand einer Punktebewertung (0 = nicht vorhanden, 1 = geplant, 2 = teilweise vorhanden, 3 = vollständig eingeführt). Aus der Auswertung lassen sich Aussagen über den Stand der digitalen Geofachdaten im GIS der Verwaltungen ableiten und Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen der Größe der Gemeindeverwaltung und der GIS-Nutzung ziehen.
IV.INSPIRE konforme Datenbereitstellung und der Aufbau des GeoPortals Rheinland Pfalz
Die Arbeit beschreibt die Implementierung von INSPIRE-konformen Metadaten, Darstellungs- und Downloaddiensten im GeoPortal.rlp.de. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von kommunalen Geofachdaten für INSPIRE. Das GeoPortal Rheinland-Pfalz wird als zentrale Plattform für den Datenaustausch und das INSPIRE-Monitoring vorgestellt. Zum Stichtag der Arbeit waren 5.918 Einträge im Katalog verzeichnet, was Rheinland-Pfalz zu einem der größten Datenanbieter in der Europäischen Gemeinschaft macht. Die Arbeit untersucht, wie die INSPIRE-Anforderungen technisch und organisatorisch auf kommunaler Ebene erreicht werden können, unter Berücksichtigung der Subsidiarität.
1. INSPIRE konforme Bereitstellung von Metadaten Darstellungs und Downloaddiensten
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Beschreibung der Implementierung von INSPIRE-konformen Diensten im GeoPortal.rlp. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von Metadaten, Darstellungs- und Downloaddiensten für kommunale Geofachdaten. Das GeoPortal.rlp fungiert als zentrale Plattform für die Bereitstellung von INSPIRE-relevanten Geodaten und -diensten. Es wird betont, dass die Dienste im Geodatenkatalog als "INSPIRE-identifiziert" eingetragen sein müssen, um im INSPIRE-Monitoring und Reporting berücksichtigt zu werden. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit enthielt der Katalog 5.918 Einträge, was die GDI Rheinland-Pfalz zu einem der größten Datenanbieter in der EU macht (Retterath, 2014). Die Implementierung der INSPIRE-Bereitstellung für alle kommunalen Dienste in Rheinland-Pfalz wurde erfolgreich demonstriert. Eine Daten-Service-Kopplung ermöglicht die Recherche nach Geodiensten über Metadatensätze zu Geodatensätzen oder Geodiensten. Rheinland-pfälzische INSPIRE-relevante Geodienste und Metadatensätze sind über das Keyword "inspireidentifiziert" im GeoPortal.rlp selektierbar. Die XML-Schema der ISO19139 bildet die Grundlage für einen einheitlichen Austausch von Metadatensätzen zwischen verschiedenen Systemen innerhalb der GDI-RP.
2. Der INSPIRE Katalog Rheinland Pfalz und das INSPIRE Monitoring
Der INSPIRE-Katalog im GeoPortal.rlp dient als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform mit Diensteregistrierung. Umweltrelevante Geodaten von Kommunen, Ministerien und Landesämtern werden hier gebündelt und für das INSPIRE-Monitoring und Reporting gemeldet. Die Arbeit beschreibt die Daten-Service-Kopplung im GeoPortal.rlp, die eine Recherche nach Geodiensten über Metadatensätze ermöglicht. Das Keyword "inspireidentifiziert" dient zur Selektion von INSPIRE-relevanten Geodaten und -diensten. Die notwendigen Kennzahlen für den Monitoring-Bericht werden aus der Benutzerverwaltung des GeoPortals, den Metadatensätzen und den Geodiensten selbst extrahiert. Die Verwendung des XML-Schemas der ISO19139 sichert einen einheitlichen Austausch von Metadatensätzen zwischen verschiedenen Systemen. Die Arbeit hebt hervor, dass die Bereitstellung von INSPIRE-konformen Diensten für alle kommunalen Dienste in Rheinland-Pfalz erreicht werden konnte und dass die GDI Rheinland-Pfalz mit den registrierten kommunalen Geodaten EU-weit zu den größten Datenanbietern gehört. Es wird auch der technische Leitfaden zur Bereitstellung von INSPIRE-konformen kommunalen Geodaten erwähnt, der eine einheitliche Datenqualität unabhängig vom Erfassungsort gewährleistet.
V.Bewertung des Aufwands und des Nutzens der INSPIRE Umsetzung
Die Studie bewertet den Aufwand und den Nutzen der INSPIRE-Umsetzung für Kommunen in Rheinland-Pfalz. Es wird ein kriterienorientierter Ansatz verwendet, der strategische, politische und operationale Ziele berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen einen potenziellen operativen Vorteil von 33% gegenüber dem Aufwand, unter der Bedingung einer vollständigen Implementierung der IT-Governance-Komponenten. Die Arbeit identifiziert auch Grenzen der Europäischen Geodateninfrastruktur und die Herausforderungen der Datenbereitstellung für Kommunen, insbesondere bezüglich der Datenpolitik, des Datenschutzes und der Berücksichtigung nationaler Gesetzgebungen.
1. Aufbau und Funktionsweise des GeoPortals.rlp
Die Arbeit beschreibt das GeoPortal.rlp (www.GeoPortal.rlp.de) als zentrale Plattform für die Bereitstellung von INSPIRE-konformen Geodaten in Rheinland-Pfalz. Es dient als Informations- und Kommunikationsplattform mit Diensteregistrierung und einem INSPIRE-Katalog. Über diesen Katalog werden umweltrelevante Geodaten von Kommunen, Ministerien und Landesämtern gebündelt und für das INSPIRE-Monitoring und Reporting bereitgestellt. Die Dienste müssen als "INSPIRE-identifiziert" eingetragen sein. Bis zum Abschluss der Arbeit waren 5.918 Einträge im Katalog verzeichnet (GDI-RP, 2015), was die GDI Rheinland-Pfalz zum größten Datenanbieter in der EU macht (Retterath, 2014). Das GeoPortal ermöglicht eine Daten-Service-Kopplung, welche die Recherche nach Geodiensten über Metadatensätze erleichtert. Rheinland-pfälzische INSPIRE-relevante Geodienste und Metadatensätze sind über das Keyword "inspireidentifiziert" selektierbar. Der INSPIRE-Katalog unterstützt den Datenaustausch durch die Verwendung des XML-Schemas der ISO19139, wodurch ein einheitlicher Austausch von Metadaten zwischen verschiedenen Systemen gewährleistet wird. Der Aufbau und Betrieb des GeoPortals werden durch einen Lenkungsausschuss koordiniert (Landtag Rheinland-Pfalz, 2010).
2. INSPIRE konforme Datenbereitstellung auf kommunaler Ebene
Die Arbeit erläutert die Implementierung von INSPIRE-konformen Metadaten, Darstellungs- und Downloaddiensten im GeoPortal.rlp, um die INSPIRE-Anforderungen auf kommunaler Ebene zu erfüllen. Ein wichtiger Aspekt ist die Bereitstellung von Geofachdaten der Kommunen, die sowohl für andere staatliche Stellen als auch für die Öffentlichkeit von großem Interesse sind. Die Arbeit hebt hervor, dass die INSPIRE-Bereitstellung für alle kommunalen Dienste in Rheinland-Pfalz durch das GeoPortal erreicht werden konnte. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Datenqualität, unabhängig vom Erfassungsort, wird die Entwicklung eines technischen Leitfadens empfohlen. Dieser Leitfaden soll die einheitliche Qualität in Darstellung, Grunddatenbestand und Metadaten gewährleisten und die relevanten GDI-Prinzipien sowie strategische und operative Zielstellungen berücksichtigen. Die Nutzung von WebMapService (WMS), WebFeatureService (WFS), und WebCatalogueService (CSW) wird im Kontext der kommunalen Geodateninfrastruktur betont. Der Datenaustausch zwischen Kommunen, Landes- und Kreisverwaltungen sollte standardisierte Datenformate verwenden. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von INSPIRE-relevanten Geodaten und der Sicherstellung der Interoperabilität.
3. Rechtliche Aspekte und Herausforderungen der INSPIRE Umsetzung
Die Arbeit thematisiert die rechtlichen Verpflichtungen der Kommunen im Rahmen der INSPIRE-Umsetzung, insbesondere die Bereitstellungspflicht von Geodaten gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 LGDIG. Es wird dargelegt, dass die Bereitstellung von INSPIRE-konformen Daten und Diensten rechtlich begründet ist, z.B. für Ausgleichs- oder Kompensationsflächen (ALKIS-Objektart AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht gemäß § 12 Abs. 3 LNatSchG), sowie für öffentlich-rechtliche Festsetzungen im Liegenschaftskataster (LGVerm). Die Übermittlungspflicht an die Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz besteht auch für hochauflösende Luftbilder (§ 4 LGVerm). Ähnliche Meldepflichten bestehen im Bereich der Umweltüberwachung (z.B. Messstellen auf Deponien, Lärmkartierungen). Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer klaren Definition der Verantwortlichkeiten und der Bereitstellungspflichten auf kommunaler Ebene. Die Komplexität der INSPIRE-Anforderungen und die teilweise fehlenden Herstellerlösungen stellen erhebliche Herausforderungen für den Aufbau einer kommunalen GDI dar. Trotzdem wird die Notwendigkeit und der Nutzen einer transparenteren Handhabung von Geodaten für Bürgerdienste über das Internet betont, wobei in den Kommunen in Rheinland-Pfalz weitgehend Einigkeit in diesem Punkt besteht.
VI.Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Arbeit zeigt, dass eine interoperable Bereitstellung von umweltrelevanten Geodaten auf semantischer und organisatorischer Ebene erreichbar ist. Sie liefert Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des kommunalen Geodatenmanagements im Kontext von INSPIRE. Die Entwicklung von standardbasierten Referenzmodellen (z.B. XPlanung, AFIS-ALKIS-ATKIS) und die Nutzung von Schema-Transformationen (XSLT) sind wichtige Aspekte. Die Arbeit betont die Bedeutung der Service-Ebene (SOA-Prinzip) für die Modelltransformation und die Implementierung eines INSPIRE-Transformationsdienstes (z.B. mit CST-WPS). Die Arbeit liefert ein wissenschaftliches Fundament für die Weiterentwicklung interoperabler Geoinformationsdienste der nächsten Generation.
1. Zusammenfassende Bewertung der INSPIRE Umsetzung
Die Arbeit bewertet den Aufwand und den Nutzen der INSPIRE-Umsetzung für Kommunen in Rheinland-Pfalz. Eine kriterienorientierte Bewertung, die strategische, politische und operationale Ziele berücksichtigt, zeigt einen potenziellen operativen Vorteil von 33% gegenüber dem Gesamtaufwand (personell, finanziell, organisatorisch). Dieser Vorteil ist jedoch nur bei einer vollständigen Implementierung der IT-Governance-Komponenten realisierbar. Eine unzureichende Implementierung, z.B. durch Kürzung des Personaleinsatzes, kann den Nutzen der Zeitersparnis bei der Suche und Nutzung digitaler Daten zunichtemachen. Die Arbeit betont die Interdependenz der Bewertungskriterien: Technologie beeinflusst die Verfügbarkeit, Rahmenbedingungen die Organisation, und Interoperabilität die Datenverschneidung. Der Nutzen der Adaption vorhandener Rahmenbedingungen (Datenspezifikation) wird hervorgehoben, im Gegensatz zum Aufwand für die Erstellung eigener Rahmenbedingungen. Transparenz, Datenpolitik und Organisation verursachen einen geringen Aufwand, erzielen aber einen hohen Nutzen. Die Arbeit stellt fest, dass die bisher fehlende Wahrnehmung einer kommunalen Geodateninfrastruktur durch die Implementierung von INSPIRE behoben werden kann. Ein kriterienorientierter Ansatz mit Kennziffern (3 = hoch, 2 = mittel, 1 = gering) wurde verwendet, um Aufwand und Nutzen in den Bereichen Technologie, Organisation und Zeit zu bewerten.
2. Grenzen der INSPIRE Umsetzung und Herausforderungen für Kommunen
Die Arbeit identifiziert Grenzen der Europäischen Geodateninfrastruktur, die einer fristgerechten INSPIRE-Implementierung bis 2020 entgegenstehen. Eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und technischer Umsetzung wird aus den ersten Berichten des INSPIRE-Monitorings und Reportings deutlich. Besonders für Kommunen in Deutschland herrscht aufgrund der unterschiedlichen Auslegung der föderalen Landesgesetzgebungen eine große Unklarheit bezüglich der Betroffenheit. Ein hoher Anteil der Daten unterliegt internen Nutzungsbeschränkungen und Datenschutzbestimmungen. Der Zugang zu Geodaten und -diensten kann durch Landesgesetzgebungen eingeschränkt sein (z.B. Schutzgebiete, Biotope). Ein berechtigter Zugang zu Darstellungs- und Downloaddiensten im Geoportal der Europäischen Union muss elektronisch abgebildet werden. Die Komplexität der INSPIRE-Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Interoperabilität, und die teilweise fehlenden Herstellerlösungen erschweren den Aufbau einer kommunalen GDI mit INSPIRE. Die Arbeit weist auf den erheblichen Aufwand für Kommunen hin und betont gleichzeitig die Bemühungen um einen transparenteren Umgang mit Geodaten und die zunehmende Bedeutung von Bürgerdiensten im Internet.
3. Schlussfolgerungen und zukünftige Forschungsrichtungen
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Implementierung eines semantischen und organisatorischen Modells zur interoperablen Bereitstellung umweltrelevanter Geodatensätze von der lokalen bis zur europäischen Ebene (INSPIRE) erfolgreich umgesetzt werden konnte. INSPIRE-relevante Geodaten wurden im Untersuchungsgebiet Rheinland-Pfalz identifiziert und verfügbar gemacht. Die Ziele von INSPIRE, den Datenaustausch in Europa über die Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten aufzubauen, sind erreichbar. Die Bereitstellung interoperabler Geodatensätze auf semantischer und organisatorischer Ebene ist umsetzbar. Ein wichtiger Aspekt zukünftiger Forschung ist die Beschreibung und Strukturierung räumlicher Analysen und der verwendeten GIS-Operationen für Web-gestützte Geoinformationssysteme. Dies ist relevant für alle geographischen Fragestellungen mit explizitem Raumbezug. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer eindeutigen syntaktischen und semantischen Beschreibung von GIS-Analysen, um die Interoperabilität zu verbessern, insbesondere im Kontext modularisierter Webdienste. Die Arbeit dient als Grundlage für zukünftige Standardisierungsbestrebungen und zielt darauf ab, den Zugang zu Geoanalysen zu erleichtern.
