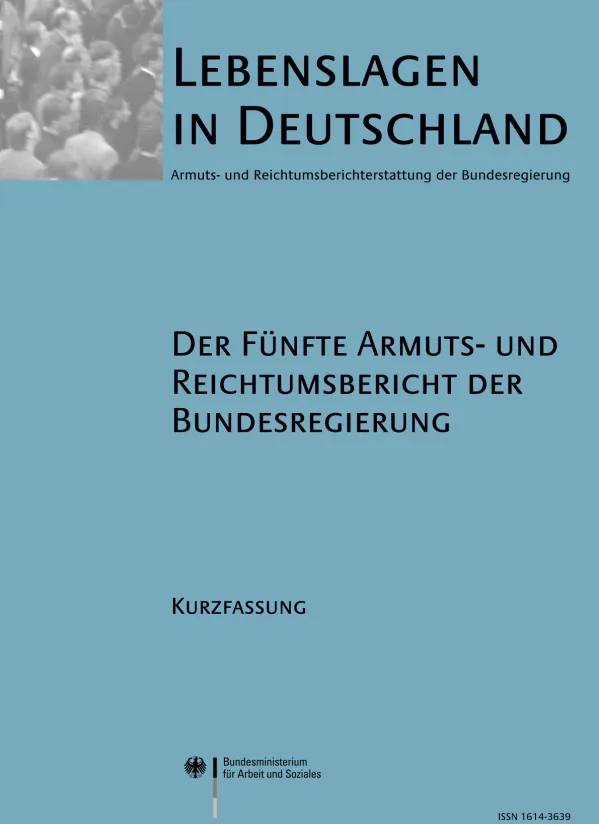
Armutsbericht Deutschland: Lebenslagen
Dokumentinformationen
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 522.79 KB |
| Autor | Bundesregierung |
| Dokumenttyp | Armuts- und Reichtumsbericht |
Zusammenfassung
I.Entwicklung am Arbeitsmarkt und Einkommensverteilung
Der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht zeigt eine seit über zehn Jahren kontinuierlich steigende Erwerbstätigkeit in Deutschland, die im Jahr 2017 mit ca. 43,6 Millionen Personen ihren höchsten Stand seit 1990 erreicht hat. Die Erwerbstätigenquote für 20- bis 64-Jährige stieg von 71,1% (2006) auf 78% (2016). Trotzdem bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit ein Problem; die Zahl der Betroffenen sank zwar unter eine Million, aber der Anteil an allen Arbeitslosen blieb bei ca. 37%. Die Einkommensverteilung blieb im Berichtszeitraum stabil, mit einem Verhältnis von etwa 70:30 zwischen oberer und unterer Hälfte der Einkommensbezieher. Indikatoren wie der Gini-Koeffizient (ca. 0,3) und die Palma-Ratio (1,0-1,1) zeigen eine gewisse, aber seit 2005 stabile soziale Ungleichheit. Der Mindestlohn trug zur Verbesserung der Entlohnung im unteren Bereich bei, ohne negative Beschäftigungsauswirkungen zu zeigen. Die Lohnentwicklung im Dienstleistungssektor hinkt jedoch hinterher, was auf geringe Tarifbindung und tradierte Lohnstrukturen zurückzuführen ist.
1. Entwicklung der Erwerbstätigkeit
Der Bericht konstatiert ein kontinuierliches Wachstum der Erwerbstätigkeit über mehr als zehn Jahre, welches im Januar 2017 mit rund 43,6 Millionen Erwerbstätigen den höchsten Stand seit 1990 erreichte. Ein signifikanter Anstieg der Erwerbstätigenquote im Zeitraum von 2006 bis 2016 ist festzustellen: bei den 20- bis 64-Jährigen von 71,1% auf 78%, und bei den 55- bis 64-Jährigen von 48,1% auf 66,2%. Dieser positive Trend wird durch die Zunahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 26,5 Millionen (Juni 2006) auf 31,4 Millionen (Juni 2016) unterstrichen. Die steigende Erwerbstätigkeit zeigt sich auch im Vergleich Januar 2016 zu Januar 2017 mit einem Zuwachs von 600.000 Personen. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Minijobs seit Einführung des Mindestlohns zu beobachten. Der Bericht hebt die deutlich stärkere Partizipation von Frauen und Älteren am Arbeitsmarkt hervor, was als Ausdruck der ökonomischen Stabilität Deutschlands interpretiert wird.
2. Langzeitarbeitslosigkeit und ihre Herausforderungen
Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Langzeitarbeitslosigkeit zu senken. Erfreulicherweise ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen (definiert als Personen, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos sind) im Jahresdurchschnitt 2016 erstmals seit 1993 unter die Millionenmarke gesunken (von 1,07 Millionen im Jahr 2013). Allerdings stagniert der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen weiterhin bei ca. 37%. Der Bericht betont, dass Langzeitarbeitslose nicht proportional vom allgemeinen Beschäftigungsaufbau profitierten. Dies wird auf schwerwiegende Hemmnisse bei der Arbeitsaufnahme zurückgeführt, wie gesundheitliche Probleme, höheres Alter, mangelnde Sprachkenntnisse oder Qualifikationen, sowie fehlende Kinderbetreuung oder Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen. Diese Faktoren tragen zur Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit bei und stellen eine besondere Herausforderung für die arbeitsmarktpolitischen Akteure dar.
3. Analyse der Einkommensverteilung
Der Bericht beschreibt die Einkommensverteilung in Deutschland als im Berichtszeitraum stabil. Der Anteil der oberen und unteren Hälfte der Einkommensbezieher blieb seit 2005 konstant bei etwa 70:30. Der Gini-Koeffizient, ein Maß für die Einkommensungleichheit, liegt seit langem bei etwa 0,3, und die Palma-Ratio bewegt sich in einem engen Korridor zwischen 1,0 und 1,1. Obwohl die Einkommensverteilung zu Beginn der 2000er Jahre ausgeglichener war, zeigt sich seit 2005 ein stabileres, aber ungleicheres Niveau. Der Bericht deutet an, dass die genannten Indikatoren bis 2005 deutlich anstiegen, um dann auf dem höheren Niveau zu verharren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Entwicklung der Einkommensverteilung weiter zu beobachten und zu analysieren, um die soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten.
II.Armutsgefährdung und materielle Entbehrung
Der Bericht beleuchtet das Armutsrisiko, insbesondere für Kinder und junge Erwachsene bis 24 Jahre, Alleinerziehende und Arbeitslose. Sozialtransfers reduzieren das Risiko erheblich, teilweise um die Hälfte. Für die Gesamtbevölkerung beträgt die Reduktion etwa ein Drittel. Das Konzept der materiellen Entbehrung zeigt, dass 4,4% der Bevölkerung (2015) auf wichtige Güter und Aktivitäten verzichten mussten, wobei Alleinerziehende, Personen mit niedrigem Bildungsgrad und Arbeitslose überproportional betroffen sind. Überschuldung stellt eine weitere Facette der Armutsgefährdung dar.
1. Armutsrisiko und die Wirkung von Sozialtransfers
Der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht (5. ARB) analysiert die Armutsgefährdung in Deutschland. Er stellt fest, dass Steuer- und Sozialtransfers das Armutsrisiko signifikant reduzieren, insbesondere für vulnerable Gruppen wie Kinder und junge Erwachsene bis 24 Jahre, Alleinerziehende und Arbeitslose. Die Reduktion beträgt in diesen Gruppen teilweise bis zur Hälfte. Betrachtet man die Gesamtbevölkerung, reduziert sich das Armutsrisiko um etwa ein Drittel. Diese Daten unterstreichen die Bedeutung sozialer Sicherungssysteme und deren Einfluss auf die Armutsbekämpfung in Deutschland. Der Bericht verdeutlicht, dass die breite Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft auf dem Versprechen gründet, Teilhabe am Wohlstand durch eigene Leistung zu ermöglichen, und gleichzeitig diejenigen abzusichern, die das Existenzminimum nicht aus eigener Kraft erreichen können. Die Wirksamkeit von Sozialtransfers bei der Armutsreduzierung wird als zentraler Punkt hervorgehoben.
2. Materielle Entbehrung als Indikator für Armut
Neben der Betrachtung des Einkommens als Maßstab für Armut, wird im 5. ARB das Konzept der „materiellen Entbehrung“ eingeführt. Dieser Ansatz fokussiert auf individuelle Mangelsituationen und nicht nur auf die finanzielle Ausstattung. Ein Katalog von Gütern und Aktivitäten, die den durchschnittlichen Lebensstandard repräsentieren, dient als Referenz. Der Anteil der Personen, die sich diese Güter und Aktivitäten nicht leisten können, wird gemessen. Im Jahr 2015 waren 4,4% der Bevölkerung von erheblichen materiellen Entbehrungen betroffen, ein Rückgang von 5,4% im Jahr 2013. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Haushaltstypen: Alleinerziehende (ca. 11%), Personen mit niedrigem Bildungsgrad (ca. 9%), Arbeitslose (ca. 30%) und Alleinlebende (ca. 10%) sind überdurchschnittlich betroffen, während Erwerbstätige mit 2,2% deutlich weniger betroffen sind. Materielle Entbehrungen stellen somit einen wichtigen Aspekt der Armutsgefährdung dar und verdeutlichen die Ungleichheit in der Lebenswirklichkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen.
3. Überschuldung als zusätzliche Armutsgefährdung
Der Bericht identifiziert Überschuldung als eine weitere wichtige Facette der Armutsgefährdung. Unabhängig vom Markteinkommen kann hohe Verschuldung die finanziellen Spielräume stark einschränken und zu ökonomischem Druck sowie sozialer und psychischer Belastung führen. Der Bericht bezieht sich auf einen Indikator, der hohe Überschuldungsintensität misst, welche durch Merkmale wie dauerhafte Zahlungsstörungen oder die Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen gekennzeichnet ist. Die Kombination von niedrigem Einkommen und hoher Verschuldung stellt eine besonders prekäre Situation dar, welche die Armutsgefährdung zusätzlich verstärkt. Die Berücksichtigung von Überschuldung im Kontext der Armutsanalyse ist essentiell, um ein umfassendes Bild der Lebenslagen betroffener Haushalte zu erhalten. Dieser Aspekt betont, dass Armut nicht nur durch niedriges Einkommen, sondern auch durch finanzielle Instabilität und die damit verbundenen psychosozialen Folgen definiert werden kann.
III.Bildung und soziale Mobilität
Der Bericht unterstreicht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Trotz Verbesserungen bei den Schulabschlüssen und der Studienanfängerquote (58% im Jahr 2015) besteht weiterhin ein enger Zusammenhang zwischen Einkommen, Bildungshintergrund und Bildungsteilnahme. Kinder aus einkommensschwächeren Haushalten besuchen Kindertageseinrichtungen unterdurchschnittlich oft. Initiativen wie die "Bildungsketten" zielen auf die Verringerung des Anteils von Jugendlichen ohne Schulabschluss ab. Die berufliche Bildung spielt eine zentrale Rolle für die Arbeitsmarktintegration junger Menschen. Die Wahrscheinlichkeit des sozialen Aufstiegs ist für jüngere Generationen gesunken.
1. Bildungsstand und beteiligung der Bevölkerung
Der Bericht zeigt eine kontinuierliche Verbesserung des Bildungsstands und der Bildungsbeteiligung in den vergangenen Jahrzehnten. Der Trend zu höheren Schulabschlüssen setzt sich fort, mit deutlichen Zuwächsen bei der allgemeinen Hochschulreife. Die Studienanfängerquote lag 2015 bei 58%. Trotz dieser positiven Entwicklung besteht weiterhin ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Dieser Zusammenhang zieht sich über alle Altersgruppen hinweg und zeigt sich in der starken Korrelation zwischen Einkommen, eigenem und familiärem Bildungshintergrund und der weiteren Bildungsbeteiligung bzw. dem erfolgreichen Abschluss von Bildungsgängen. Die unterschiedliche Inanspruchnahme öffentlicher Kindertagesbetreuung verdeutlicht diese Ungleichheit: Kinder aus Elternhäusern mit höherem Bildungsabschluss nutzen diese Angebote häufiger. Dies hängt mit der Erwerbsintensität der Eltern und der Anerkennung frühkindlicher Bildung zusammen. Gute Kindertagesbetreuung unterstützt nicht nur die Erwerbstätigkeit der Eltern, sondern fördert auch das kindliche Lernen und kann so einen wichtigen Beitrag zu Chancengleichheit leisten und einen Weg aus der Armut ebnen.
2. Soziale Herkunft und Bildungserfolg Herausforderungen und Initiativen
Der enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg wird im Bericht als ein zentrales Problem hervorgehoben. Auch in der frühen Kindheit zeigt sich dieser Einfluss: Kinder aus Haushalten mit geringem Einkommen und formaler Bildung besuchen Kindertageseinrichtungen seltener. Diese Benachteiligung betrifft auch Kinder mit Migrationshintergrund. Im fünften Jahr nach Ende der Schulpflicht ist ein erheblicher Anteil von Jugendlichen ohne Ausbildung oder Beschäftigung zu verzeichnen – ein größerer Anteil als in Vergleichsgruppen. Abiturienten mit hochgebildetem Elternteil haben eine deutlich höhere Studienneigung. Die Initiative „Bildungsketten“ zielt darauf ab, den Anteil von Jugendlichen ohne Schulabschluss zu verringern. Jährlich werden etwa 250.000 Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Berufsorientierungsprogramms unterstützt. Das ESF-Bundesprogramm Berufseinstiegsbegleitung unterstützt ca. 113.000 leistungsschwächere Jugendliche. Der Bund stellt hierfür 500.000 Potenzialanalysen bereit. Die Förderung von individualisiertem Lernen und die Verbesserung der Unterrichtsqualität sind weitere Maßnahmen zur Verringerung von Bildungsungleichheiten.
3. Berufliche Bildung und soziale Mobilität
Der Bericht unterstreicht die zentrale Rolle der beruflichen Bildung für die Bildungs- und Arbeitsmarktintegration junger Menschen und deren qualifizierte Beschäftigung. Das Leitziel „Vorfahrt für betriebliche Ausbildung“ und die Verbesserung der Durchlässigkeit zum Hochschulbereich sind wichtige Handlungsfelder. Die zunehmende Bedeutung von Weiterbildung und beruflicher Neuorientierung wird hervorgehoben, da das lineare Karriere-Modell hinterfragt wird. Lebenslange Lernprozesse werden als notwendig erachtet, besonders für gering qualifizierte Beschäftigte und Arbeitsuchende. Es wird darauf hingewiesen, dass Bildungsangebote als Chance wahrgenommen werden müssen, und Ängste vor Überforderung ernst genommen werden sollten. Die Vermittlung von Grundkompetenzen (Schreiben, Mathematik, IT) für Geringqualifizierte wird als essentiell angesehen, um Nachteile auszugleichen und zukunftsfähige Kompetenzen zu erwerben. Digitale und interaktive Lernprogramme werden als Möglichkeit erwähnt, die Lernhürden zu senken.
IV.Alterssicherung und Gesundheit
Die Alterssicherungssysteme (gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge) sollen den Lebensstandard im Alter erhalten. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz zielt auf eine verbesserte betriebliche Altersvorsorge, insbesondere für Klein- und mittelständische Unternehmen und Geringverdienende. Die Gesundheitsversorgung ist mit der gesetzlichen Krankenversicherung gesichert, aber Bildungsunterschiede beeinflussen die subjektiv empfundene Gesundheit. Das Präventionsgesetz sieht Investitionen in Prävention und Gesundheitsförderung vor. Die hohe Wohnkostenbelastung, insbesondere in städtischen Gebieten, stellt ein Problem dar, das zu sozialräumlicher Segregation führen kann.
1. Alterssicherungssysteme und Lebensstandard im Alter
Der Bericht betont, dass Alterssicherungssysteme – gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge – nicht nur der Armutsvermeidung dienen, sondern darauf abzielen, den bisherigen Lebensstandard auch im Alter aufrechtzuerhalten. Die gesetzliche Rentenversicherung spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie den Großteil der Bevölkerung absichert. Ein wichtiges Prinzip ist die Anpassung der Renten an die Lohnentwicklung der erwerbstätigen Generation, um Teilhabe am Einkommensfortschritt zu gewährleisten. Zusätzlich zur Altersabsicherung bietet die Rentenversicherung Schutz bei Erwerbsminderung und Hinterbliebenenversorgung. Der Bericht erwähnt das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das die betriebliche Altersvorsorge, besonders in kleinen und mittleren Unternehmen und bei Geringverdienenden, stärken soll. Ein Freibetrag für zusätzliche Altersvorsorge bei Leistungen der Grundsicherung im Alter soll Anreize schaffen. Die Erhöhung der Grundzulage der Riester-Rente von 154 auf 165 Euro pro Jahr wird ebenfalls erwähnt.
2. Gesundheit und ihre Determinanten
Der individuelle Gesundheitszustand wird im Bericht im Zusammenhang mit den materiellen Möglichkeiten des jeweiligen Haushalts betrachtet. Bildungsunterschiede spielen dabei eine entscheidende Rolle, da höhere Bildung bessere Einkommens- und Aufstiegschancen und somit einen positiven Einfluss auf die subjektiv empfundene Gesundheit hat. Weitere Faktoren wie Alter, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, Persönlichkeitsmerkmale, Beruf und Branche beeinflussen den Gesundheitszustand. Die gesetzliche Krankenversicherung gewährleistet einen umfassenden sozialen Schutz im Krankheitsfall, unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Zielgruppenspezifische Angebote in Prävention und Gesundheitsförderung sollen Menschen in besonderen Bedarfslagen besser erreichen. Das Präventionsgesetz verpflichtet Kranken- und Pflegekassen ab 2016 zu Investitionen von mindestens 300 Millionen Euro in Prävention und Gesundheitsförderung, um alle Menschen in ihren Lebenswelten (Betrieb, Kita, Schule etc.) zu erreichen. Angebote der Früherkennung von Krankheiten werden ausgebaut.
3. Pflegeversicherung und Wohnkostenbelastung
Die Pflegeversicherung wird als ein System beschrieben, das Pflegebedürftige und ihre Familien entlastet und die Versorgung sicherstellt. Sie reduziert die pflegebedingte Sozialhilfeabhängigkeit und unterstützt pflegende Angehörige. Die Kosten für Wohnen und Nebenkosten stellen einen großen Ausgabenblock im Haushalt dar. Die mittlere Wohnkostenbelastung liegt bei ca. 22% des verfügbaren Haushaltseinkommens. 16% der Haushalte gaben 2015 mehr als 40% ihres Einkommens für Wohnkosten aus, wobei einkommensschwächere Haushalte überproportional betroffen sind. Diese Entwicklung ist regional unterschiedlich, mit starken Mietanstiegen in wirtschaftsstarken Regionen und Großstädten. Die Folge ist eine drohende sozialräumliche Segregation, da sich einkommensschwache Haushalte in bestimmten Stadtteilen konzentrieren. Die Wohnkostenbelastung stellt somit eine erhebliche Herausforderung dar, besonders für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.
V.Integration von Geflüchteten und Öffentliche Finanzen
Der Bericht betont die Bedeutung der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Maßnahmen zum Spracherwerb und zur beruflichen Bildung sind entscheidend. Die öffentlichen Finanzen müssen langfristig tragfähig sein, um die soziale Sicherung zu gewährleisten. Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung sind wichtig. Die Bundesregierung setzt sich für eine Finanztransaktionssteuer ein, wobei negative Auswirkungen auf die Altersvorsorge und die Realwirtschaft vermieden werden sollen. Der demografische Wandel stellt eine Herausforderung für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme dar.
1. Integration von Geflüchteten Maßnahmen und Herausforderungen
Der Bericht adressiert die Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt als wichtigen Aspekt der Armutsbekämpfung. Die Integration wird als ganzheitlicher Prozess beschrieben, der die Abstimmung von Maßnahmen und Instrumenten verschiedener Akteure erfordert. Die Bundesregierung hat mit dem Integrationsgesetz (in Kraft getreten am 6. August 2016) bereits bestehende Gesetze erweitert, um Asylverfahren zu beschleunigen und die Integration von Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive zu fördern. Die Wartezeit für die Arbeitsaufnahme wurde auf drei Monate verkürzt und die Vorrangprüfung in vielen Agenturbezirken der Bundesagentur für Arbeit ausgesetzt (befristet auf drei Jahre). Integrationspolitische Maßnahmen konzentrieren sich auf Spracherwerb, Bildung, Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit. Da die Schutzsuchenden mehrheitlich jung sind, besteht großes Potential, durch frühkindliche, schulische und berufliche Bildungsmaßnahmen die Integration zu unterstützen und Armutsrisiken zu vermeiden. Der Erwerb von Sprachkenntnissen und Bildungsabschlüssen verbessert die Arbeitsmarktperspektiven deutlich. Ausbildungsfördernde Leistungen wurden für bestimmte Gruppen von Geflüchteten befristet geöffnet.
2. Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen und Steuergerechtigkeit
Der Bericht betont die Notwendigkeit einer langfristig tragfähigen Finanzpolitik als Grundlage für eine verlässliche soziale Sicherung. Solide Staatsfinanzen sind unerlässlich, um Verteilungsspielräume zu erhalten, Bildungschancen zu sichern und Krisen zu bekämpfen. Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, zusätzliche Investitionen und soziale Teilhabe werden als miteinander vereinbare Ziele dargestellt. Umsatz- und Verbrauchsteuern bilden die größte Steuerbasis (knapp die Hälfte des Steueraufkommens), wobei einkommensschwächere und jüngere Haushalte überproportional beitragen. Einkommensteuern berücksichtigen die Leistungsfähigkeit durch Steuerprogression. Kapitalerträge unterliegen der Abgeltungsteuer und nicht dem progressiven Einkommensteuertarif. Die Anhebung des Grund- und Kinderfreibetrags und Anpassungen im Steuertarif mildern die kalte Progression. Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sollen die Steuereinnahmen verbessern. Internationale Zusammenarbeit zielt auf Steuergerechtigkeit und Steuerfairness. Eine zukünftige Herausforderung besteht in der generationengerechten Finanzierung öffentlicher Hand und der Sicherung der sozialen Sicherungssysteme im Kontext des demografischen Wandels und des technischen Fortschritts.
3. Finanztransaktionssteuer und Bürgerdialog
Die Bundesregierung strebt die Einführung einer Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage und niedrigem Steuersatz im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit auf europäischer Ebene an. Dabei sollen negative Auswirkungen auf Altersvorsorge, Kleinanleger und die Realwirtschaft vermieden werden. Ein gemeinsames Grundverständnis unter den beteiligten EU-Mitgliedstaaten besteht, jedoch nicht in allen Fragen. Die Bundesregierung will die politische Beteiligung der Bürger fördern und führt dazu den Bürgerdialog „Gut Leben in Deutschland“ und den Dialogprozess „Arbeiten 4.0“ durch. Diese Dialoge zielen darauf ab, gesellschaftliche Trends zu diskutieren, Ängste (z.B. vor Jobverlusten durch Automatisierung) zu adressieren und die Erwartungen an notwendige Regelungen zu erörtern. Auch bei der Erstellung des 5. Armuts- und Reichtumsberichts fand ein intensiver Dialog mit Wissenschaft, Verbänden und Armutsbetroffenen statt.
VI.Demokratische Teilhabe
Die politische Beteiligung von Menschen mit geringem Einkommen ist geringer als die der Mittelschicht. Die Bundesregierung fördert den Bürgerdialog um die Gestaltung der Lebensverhältnisse in Deutschland zu verbessern und Ängsten z.B. vor Jobverlusten durch Automatisierung und Digitalisierung entgegenzutreten.
1. Politische Beteiligung und Einkommensniveau
Der Bericht zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der politischen Beteiligung auf. Die politische Beteiligung, einschließlich der Wahlbeteiligung, ist bei Menschen mit geringem Einkommen deutlich geringer und hat in den letzten Jahrzehnten stärker abgenommen als bei Personen mit höherem Einkommen und der Mittelschicht. Dies bedeutet, dass einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen vergleichsweise weniger Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen können. Die internationale Politikwissenschaft diskutiert zudem die zunehmende Homogenität der Positionen politischer Akteure, wodurch sich Personen aus unteren Einkommensschichten in politischen Entscheidungen häufig nicht repräsentiert fühlen. Diese Diskrepanz zwischen der Beteiligung und dem Einfluss verschiedener Einkommensgruppen auf politische Entscheidungen wird als ein wichtiges Thema im Kontext demokratischer Teilhabe hervorgehoben.
2. Förderung der politischen Teilhabe und des Bürgerdialogs
Die Bundesregierung bemüht sich, die politische Betätigung in der gesamten Gesellschaft anzuregen und den Dialog mit den Bürgern zu fördern. Ein Beispiel hierfür ist der Bürgerdialog „Gut Leben in Deutschland“. Der Dialogprozess „Arbeiten 4.0“ dient als weiteres Beispiel für den frühzeitigen Austausch mit Bürgern über gesellschaftliche Trends, deren Konsequenzen und die Erwartungen an politische Regelungen. Dieser Dialogprozess soll dazu beitragen, Ängste vor möglichen Jobverlusten durch Automatisierung und Digitalisierung zu adressieren und ein gemeinsames Verständnis für notwendige Anpassungen zu schaffen. Auch bei der Erstellung des 5. Armuts- und Reichtumsberichts wurde ein intensiver Dialog mit Wissenschaft, Verbänden und Armutsbetroffenen geführt, um verschiedene Perspektiven und Erfahrungen in die Berichterstattung zu integrieren und ein breites Verständnis für die komplexen Herausforderungen zu fördern.
