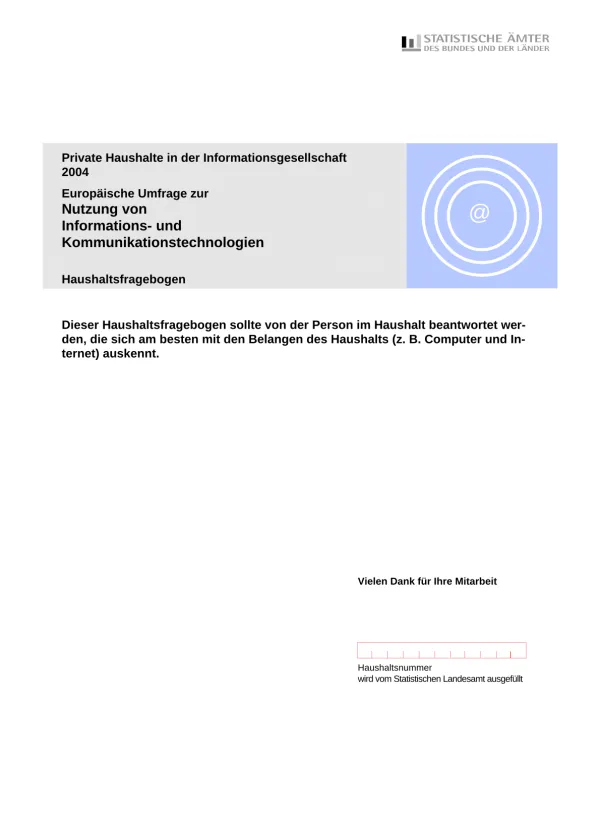
Haushaltsfragebogen 2004: ICT-Nutzung
Dokumentinformationen
| Fachrichtung | Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Medienwissenschaften |
| Dokumenttyp | Fragebogen |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 878.39 KB |
Zusammenfassung
I.Haushaltsstruktur und Internetnutzung
Diese Studie untersucht die Internetnutzung in deutschen Haushalten. Es werden Daten zur Haushaltsgröße, den Beziehungen der Haushaltsmitglieder (Ehepartner, Kinder, Verwandte, etc.), Demografie (Geschlecht, Alter, Familienstand, Nationalität) und der Art des Internetzugangs (DSL, Kabel, etc.) erhoben. Ein Schwerpunkt liegt auf der durchschnittlichen Internetnutzungsdauer pro Woche und der Nutzung des Internets für verschiedene Zwecke, wie z.B. die Suche nach medizinischen Informationen. Die Studie umfasst ca. 4.000 Haushalte in Deutschland und ist Teil einer EU-weiten Erhebung zur Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).
1. Haushaltsdefinition und zusammensetzung
Die Erhebung beginnt mit einer klaren Definition des Haushalts. Ein Haushalt wird gebildet, wenn eine Person alleine wirtschaftet, selbst wenn sie eine Wohnung mit anderen teilt (z.B. Untermieter). Bei Wohngemeinschaften bildet eine Gemeinschaft einen Haushalt, wenn die Mitglieder gemeinsam wirtschaften. Auch vorübergehend abwesende Personen, die wohnberechtigt sind, zählen zum Haushalt. Für jede Person im Haushalt werden detaillierte Angaben erfragt: Vorname, Beziehung zu anderen Haushaltsmitgliedern, Geschlecht, Geburtsdatum und -jahr, Familienstand und Staatsangehörigkeit. Die Reihenfolge der Eintragungen ist vorgegeben: zuerst Ehe-/Lebenspartner, dann Kinder, Verwandte und schließlich nicht verwandte Personen. Ein Beispiel verdeutlicht die Darstellung der Beziehungen im Haushalt: Ein Haushalt mit Ehepaar Heidi und Tom, ihren Kindern Julia und Hannes und Heidis Mutter Käthe. Diese detaillierte Erfassung der Haushaltsstruktur dient als Grundlage für die Analyse des Zusammenhangs zwischen familiärer Situation und Internetnutzung.
2. Internetzugang und nutzung
Ein wichtiger Schwerpunkt der Erhebung liegt auf dem Internetzugang und der Internetnutzung der Haushalte. Es wird abgefragt, ob der Haushalt über eine DSL-Verbindung verfügt, und ob alternative Breitbandverbindungen (z.B. Kabel-TV-Netz) oder sonstige Internetverbindungen genutzt werden. Die Befragten werden gebeten, die Art der sonstigen Internetverbindungen zu spezifizieren. Eine zentrale Frage zielt auf die durchschnittliche Internetnutzungsdauer in den letzten drei Monaten ab, wobei die Nutzung sowohl zu Hause als auch an anderen Orten berücksichtigt wird (z.B. Internetcafés, Wohnungen von Bekannten). Zusätzlich werden Fragen zu negativen Erfahrungen im Internet gestellt, wie z.B. Kreditkartenmissbrauch, Missbrauch persönlicher Daten und unerwünschte E-Mails (Spam). Die detaillierte Erfassung der Internetnutzung soll Aufschluss über das Ausmaß und die Art der Online-Aktivitäten in deutschen Haushalten geben und deren Einfluss auf den Alltag.
3. Internetnutzung für medizinische Zwecke und Hemmnisse
Die Studie untersucht die Nutzung des Internets für medizinische Zwecke. Die Befragten werden explizit danach gefragt, wie häufig sie das Internet nutzen, um sich über medizinische Themen zu informieren, mit Ärzten in Kontakt zu treten oder Medikamente zu bestellen. Falls keine Internetnutzung stattfindet, werden alternative Fragen gestellt. Die Erhebung berücksichtigt auch potenzielle Hemmnisse für die Internetnutzung, indem sie nach Gründen für die Nichtnutzung fragt. Genannt werden der fehlende persönliche Kontakt, die fehlende direkte Beratung, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, zusätzliche Kosten durch Internetverbindungsgebühren und die als zu kompliziert empfundenen Behördengänge im Internet. Diese Fragen sollen ein umfassendes Bild der Internetnutzung im Gesundheitskontext zeichnen und mögliche Barrieren identifizieren.
II.Einkommen und Erwerbstätigkeit
Die Erhebung umfasst detaillierte Fragen zum Haushaltseinkommen, welches die Summe der Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder beinhaltet (inkl. Sonderzahlungen). Zusätzlich werden Angaben zur Erwerbstätigkeit in der Vorwoche erhoben. Die Daten zum Einkommen dienen der Analyse des Zusammenhangs zwischen sozioökonomischem Status und Internetnutzung.
1. Haushaltseinkommen
Ein zentraler Bestandteil der Erhebung ist die Ermittlung des Haushaltseinkommens. Es wird explizit darum gebeten, die Euro-Beträge aller Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder zusammenzuzählen. Das Nettoeinkommen versteht sich als Einkommen abzüglich Lohnsteuer, Kirchensteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Wichtig ist die Berücksichtigung von Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, die anteilig auf das monatliche Nettoeinkommen angerechnet werden sollen. Diese detaillierte Erfassung des Haushaltseinkommens dient der Analyse des sozioökonomischen Kontextes und seiner möglichen Auswirkungen auf die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Die genaue Berechnung des Haushaltseinkommens ist essentiell für die statistische Auswertung und den Vergleich verschiedener Haushaltsgruppen.
2. Erwerbstätigkeit in der Vorwoche
Die Befragten werden nach ihrer Erwerbstätigkeit in der letzten März-Woche 2004 befragt. Die Frage zielt darauf ab, festzustellen, ob die Personen in dieser Woche bezahlte Arbeit ausgeübt haben oder im eigenen oder Familienbetrieb tätig waren. Als bezahlte Arbeit gilt jede Tätigkeit von mindestens einer Stunde pro Woche gegen Entgelt. Zur Definition des Einkommens gehören neben Lohn oder Gehalt auch Unternehmereinkommen, Renten, Pensionen, Arbeitslosengeld, öffentliche Unterstützungen, Kapitaleinkommen (Zinsen, Dividenden), Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Kindergeld und Wohngeld. Das Kindergeld soll dabei dem Einkommen eines Elternteils, nicht des Kindes, zugerechnet werden. Auch hier ist die Berücksichtigung von Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) wichtig, um ein möglichst genaues Bild der Einkommensverhältnisse zu erhalten. Die erhobenen Daten ermöglichen eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Erwerbstätigkeit und den Möglichkeiten der Internetnutzung.
III.Informations und Kommunikationstechnologien IKT in Unternehmen
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Einsatz von IKT in deutschen Unternehmen. Die Studie erfasst den Computergebrauch der Mitarbeiter, den Anteil der mobiles Arbeiten (Zugriff auf IT-Systeme außerhalb des Unternehmens), den Umsatzanteil durch Online-Bestellungen (E-Commerce) und die Nutzung des Internets zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die IT-Sicherheit, inklusive der Häufigkeit von Sicherheitsproblemen (z.B. Computerviren) und der Nutzung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. SSL). Die Daten werden mit der Zielsetzung erhoben, die Bedeutung und den Einfluss von modernen IKT auf Geschäftsabläufe zu analysieren. Die Studie ist eine Kooperation von Eurostat und den nationalen Statistischen Ämtern der EU.
1. Computereinsatz im Geschäftsablauf
Die Erhebung untersucht zunächst den grundlegenden Computereinsatz in Unternehmen. Es wird erfragt, ob Computer überhaupt im Geschäftsablauf eingesetzt werden. Bei bejahender Antwort wird der prozentuale Anteil oder die Anzahl der Mitarbeiter ermittelt, die während der Arbeitszeit mindestens einmal pro Woche einen Computer benutzen. Zusätzlich wird danach gefragt, ob Mitarbeiter regelmäßig mindestens einen halben Arbeitstag pro Woche außerhalb des Unternehmensgebäudes arbeiten und von dort auf die IT-Systeme des Unternehmens zugreifen können. Diese Fragen zielen darauf ab, ein grundlegendes Verständnis für die Verbreitung und den Umfang des Computereinsatzes in deutschen Unternehmen zu gewinnen und den Trend zum mobilen Arbeiten zu erfassen. Die Antworten bilden die Basis für weitere, detailliertere Fragen zur Technologie-Nutzung.
2. Online Bestellungen und E Commerce
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem E-Commerce. Die Unternehmen werden gefragt, ob sie im Jahr 2003 Bestellungen über das Internet (ohne E-Mails) erhalten haben. Bei bejahender Antwort soll der prozentuale Anteil des Gesamtumsatzes angegeben werden, der durch diese Online-Bestellungen erzielt wurde. Diese Fragen sollen den Stellenwert des Online-Handels für verschiedene Unternehmenstypen und Branchen aufzeigen und quantifizieren, wie stark der digitale Vertriebskanal zum Unternehmenserfolg beiträgt. Die Daten liefern wichtige Erkenntnisse über die digitale Transformation und den wachsenden Einfluss des Internets auf den Geschäftsverkehr.
3. Angebot von Produkten und Dienstleistungen über das Internet
Die Erhebung erfasst auch das Angebot von Produkten und Dienstleistungen über das Internet oder andere Netzwerke wie EDI (Electronic Data Interchange). Unternehmen werden gebeten, die im Jahr 2003 online angebotenen Produkte und Dienstleistungen anzugeben. Zusätzlich werden Fragen zu den Gründen für das Online-Angebot gestellt. Weiterhin wird nach einer Anbindung oder einem Verweis auf andere Computernetzwerke (z.B. EDI) im Rahmen des Online-Kundendialogs gefragt. Schließlich wird der prozentuale Anteil der Kunden ermittelt, die über das Internet Käufe oder Verkäufe tätigten, der Anteil der Kundenkontakte über das Internet und der Anteil des über das Internet abgesetzten Produktionswertes im Verhältnis zum Gesamtproduktionswert des Unternehmens. Diese Fragen geben Aufschluss über die Strategien von Unternehmen im Hinblick auf den Vertrieb und die Kundenkommunikation im digitalen Raum und zeigen den Einfluss des Online-Geschäfts auf den Gesamtumsatz auf.
4. IT Sicherheit
Ein wichtiger Aspekt der Erhebung ist die IT-Sicherheit. Die Unternehmen werden befragt, ob sie in den letzten zwölf Monaten Sicherheitsprobleme im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie hatten. Bei bejahender Antwort werden die Gründe dafür erfragt (z.B. Computerviren, Datenverlust). Weiterhin wird abgefragt, ob mindestens eine der verwendeten Sicherheitseinrichtungen in den letzten drei Monaten aktualisiert wurde (inklusive automatischer Aktualisierungen). Die Erhebung dieser Daten dient der Analyse der IT-Sicherheitslage in deutschen Unternehmen und der Wirksamkeit der eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen. Die Ergebnisse sollen Hinweise auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale liefern.
IV.Produktionswert und Umsatz
Der Abschnitt beschreibt die Erhebung des Produktionswertes von Unternehmen, differenziert nach verschiedenen Wirtschaftszweigen (z.B. Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen). Die Definition des Produktionswertes variiert je nach Branche und beinhaltet z.B. Verkäufe von Waren und Dienstleistungen, Bestandsveränderungen und selbsterstellte Anlagen. Zusätzlich werden Daten zum Umsatz erhoben, inklusive Angaben zu Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Die Angaben zur Umsatzsteuer und Online-Umsätze spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
1. Definition des Produktionswertes
Der Produktionswert stellt einen zentralen Bestandteil der Erhebung dar. Seine Definition ist jedoch branchenabhängig. Für Unternehmen im Allgemeinen wird der Produktionswert als der Wert der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen aus eigener Produktion sowie von Handelsware an andere Wirtschaftseinheiten (in- und ausländische) definiert. Hinzu kommen der Wert der Bestandsveränderung an halbfertigen und fertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion und der Wert der selbsterstellten Anlagen. Firmeninterne Lieferungen und Leistungen werden nicht einbezogen. Für Kreditinstitute wird der Produktionswert neben den tatsächlichen Einnahmen aus Gebühren um unterstellte Entgelte für Bankdienstleistungen erweitert, berechnet als Differenz zwischen Ertragszinsen und Aufwandszinsen. Bei Versicherungsunternehmen gilt im Wesentlichen das in den Bruttoprämien enthaltene Entgelt für Dienstleistungen als Produktionswert; ermittelt durch Abzug der fälligen Leistungen von den Beitragseinnahmen und Erträgen aus der Verzinsung der Vermögensanlagen. Der Produktionswert der Versicherungsunternehmen beinhaltet zusätzlich Erlöse aus dem aktiven Rückversicherungsgeschäft und der Vermietung gewerblich genutzter Grundstücke. Die differenzierte Betrachtung des Produktionswertes unterstreicht die Komplexität der wirtschaftlichen Aktivitäten und die Notwendigkeit einer branchen-spezifischen Erfassung.
2. Umsatz und Einnahmen
Die Erhebung erfasst den Umsatz oder die Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit. Dieser wird als Gesamtbetrag (ohne Umsatzsteuer) der abgerechneten Lieferungen und sonstigen Leistungen (inkl. Eigenverbrauch) der im Bundesgebiet ansässigen Unternehmen definiert, unabhängig vom Zahlungseingang. Dies beinhaltet auch Provisionen aus Vermittlungs- und Kommissionsgeschäften. Ausgeschlossen sind Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Leasing betrieblicher Grundstücke, Anlagen und Einrichtungen, Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Auflösung von Rückstellungen sowie Umsätze oder Einnahmen ausländischer Niederlassungen. Die Berücksichtigung von Nebenkosten wie Reisekosten, Spesen, Fracht-, Porto- und Verpackungskosten sowie umsatzsteuerfreier Umsätze nach § 4 UStG wird explizit erwähnt. Für Einnahmen-Überschussrechner nach § 4 Abs. 3 EStG sind nur die im Berichtsjahr zahlungswirksamen Einnahmen anzugeben. Konzernumsätze und umsatzsteuerliche Organschaften werden ebenfalls berücksichtigt. Die klare Definition und Abgrenzung der berücksichtigten Umsatzkomponenten sichert die Vergleichbarkeit und die Genauigkeit der gesammelten Daten.
3. Roh Hilfs und Betriebsstoffe
Die Erhebung umfasst auch die Erfassung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierunter fallen alle Materialien, die im Unternehmen be- oder verarbeitet, verbraucht oder an Dritte zur Be- oder Verarbeitung weitergegeben werden. Beispiele hierfür sind Kraftstoffe, Ersatzteile, Büro- und Werbematerial sowie Verpackungsmaterial. Auch Materialien für die Herstellung von selbsterstellten Anlagen sind einzubeziehen. Die Erfassung dieser Daten dient der detaillierten Beschreibung der Produktionsaktivitäten und der Bestimmung des Materialeinsatzes in den Unternehmen. Diese Informationen sind relevant für die Analyse der Produktionskosten und -prozesse sowie der Wertschöpfungskette. Die Berücksichtigung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ergänzt die Informationen über den Produktionswert und Umsatz zu einem umfassenden Bild der Unternehmensaktivitäten.
