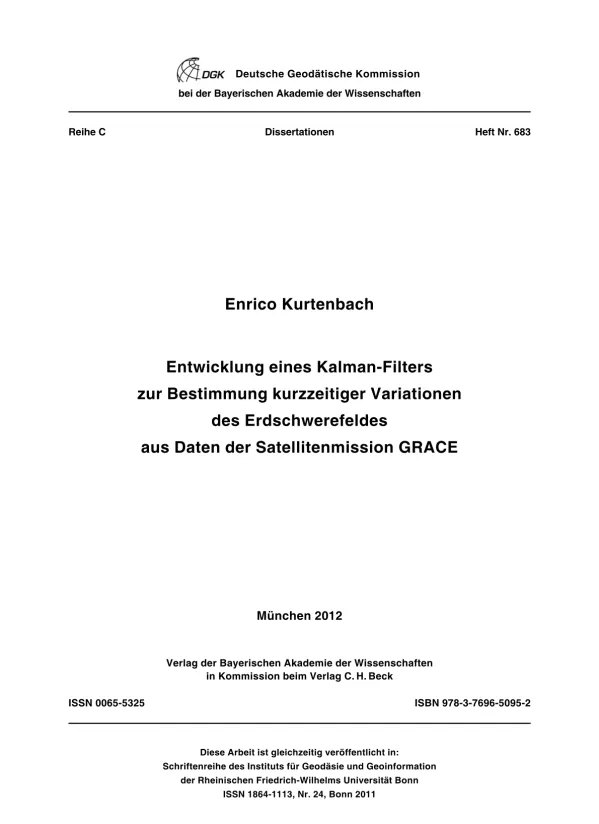
Kalman-Filter & GRACE: Erdschwerefeld
Dokumentinformationen
| Autor | Enrico Kurtenbach |
| instructor | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kusche |
| Schule | Hohe Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn |
| Fachrichtung | Geodäsie |
| Ort | München |
| Dokumenttyp | Inaugural-Dissertation |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 8.59 MB |
Zusammenfassung
I.GRACE Mission und Schwerefeld Bestimmung
Die Satellitenmission GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) misst mit zwei Satelliten im Abstand von ca. 220 km hochgenaue Abstandsänderungen mittels eines Mikrowellen-Distanzmesssystems (K-Band und Ka-Band). Diese Daten ermöglichen die Bestimmung des Erdschwerefeldes und dessen zeitlichen Variationen. Die bisherige Genauigkeit der monatlichen Schwerefeldlösungen ist jedoch durch unzureichende Modellierung der kurzzeitigen Variationen begrenzt. Die Arbeit zielt darauf ab, tägliche GRACE-Schwerefeldlösungen abzuleiten, um das Verständnis geophysikalischer Prozesse zu verbessern und die Genauigkeit der monatlichen Lösungen zu steigern. Die polnahe Bahn von GRACE (Inklination i = 89°) gewährleistet eine gleichmäßige globale Datenabdeckung.
1. Zielsetzung der Arbeit und Limitationen der bisherigen GRACE Auswertung
Die Arbeit befasst sich mit der Verbesserung der Genauigkeit der Erdschwerefeld-Bestimmung mittels der GRACE-Mission. Ein zentrales Problem ist die bisher unzureichende Modellierung der kurzzeitigen Schwerefeldvariationen, die bei der Verwendung monatlicher Mittelwerte zu Informationsverlusten führt. Die vorliegende Arbeit verfolgt daher das Ziel, einen Ansatz zur Ableitung täglicher GRACE-Schwerefeldlösungen zu entwickeln. Dies soll sowohl das Verständnis der zugrundeliegenden geophysikalischen Prozesse verbessern als auch die Genauigkeit der etablierten monatlichen Schwerefeldlösungen erhöhen. Die Verbesserung der Genauigkeit wird als essentiell für eine präzisere Erforschung des Erdsystems betrachtet, da das Gravitationsfeld ein wichtiger Indikator für diverse geophysikalische Prozesse ist. Die höhere zeitliche Auflösung soll ermöglichen, kurzfristige Dynamiken, die bisher durch die monatlichen Mittelwerte verschleiert waren, besser zu erfassen und zu analysieren. Die Arbeit unterstreicht damit die Notwendigkeit einer präziseren Modellierung der zeitlichen Variationen des Erdschwerefelds.
2. Das GRACE System und das Messprinzip
Die GRACE-Mission basiert auf zwei identischen Satelliten, die in einem Abstand von etwa 220 Kilometern auf einer nahezu kreisförmigen, polnahen Bahn (Inklination von 89°) fliegen. Dieses Design ermöglicht eine gleichmäßige globale Abdeckung und Datenbeschaffung. Die Satelliten verwenden ein Mikrowellen-Distanzmesssystem (K-Band und Ka-Band) für die hochgenaue Bestimmung der Abstandsänderungen. Das Prinzip des low-low satellite-to-satellite tracking (low-low SST) ermöglicht die Messung der gravitativen Anziehungskräfte. Variationen in diesen Kräften, verursacht durch Massenanomalien auf der Erde, bewirken entsprechende Änderungen im Abstand der Satelliten und liefern so Informationen über räumliche und zeitliche Variationen des Erdschwerefeldes. Die hohe Genauigkeit des Mikrowellen-Distanzmesssystems ist essentiell für die Qualität der gewonnenen Daten, welche wiederum die Grundlage für die Bestimmung der Schwerefeldlösungen bildet. Die Auswahl einer polnahen Bahn dient der Optimierung der Datenabdeckung und erlaubt die Erfassung von Schwerefeldvariationen über die gesamte Erdoberfläche. Die Verwendung von zwei Satelliten ermöglicht die differentielle Messung der gravitativen Kräfte, wodurch Störungen reduziert und die Genauigkeit erhöht werden.
3. Bestehende Ansätze zur Schwerefeldlösung und das Problem des zeitlichen Aliasings
Neben den drei offiziellen Auswertezentren des SDS (Science Data System) existieren zahlreiche weitere Gruppen, die aus GRACE-Daten Schwerefeldlösungen berechnen. Diese Lösungen umfassen typischerweise ein statisches Schwerefeld und monatliche Lösungen, die die zeitlichen Veränderungen des Erdschwerefeldes repräsentieren. Die Darstellung erfolgt oft mittels Kugelfunktionen, jedoch gibt es auch alternative Ansätze wie die Verwendung radialer Basisfunktionen oder den Mascon-Ansatz. Alle diese Methoden sind von zeitlichen Aliasing-Effekten betroffen, die durch die unzureichende Abtastung der hochfrequenten Schwerefeldvariationen innerhalb eines Monats entstehen. Um diese Effekte zu reduzieren, werden vorhandene geophysikalische Hintergrundmodelle verwendet, um bekannte hochfrequente Variationen wie Gezeiten und atmosphärische/ozeanische Massenvariationen (z.B. im AOD1B-Produkt) vor der eigentlichen Schwerefeldanalyse zu entfernen. Der Mascon-Ansatz und der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz versuchen, zeitliche Korrelationen zwischen den Schwerefeldparametern auszunutzen, um das Problem des zeitlichen Aliasings zu adressieren. Die Arbeit verweist explizit auf relevante Publikationen (Mayer-Gürr et al., 2010b; Liu et al., 2010; Luthcke et al., 2006; Lemoine et al., 2007; Eicker, 2008; Rowlands et al., 2010), die verschiedene Aspekte der Schwerefeldmodellierung und -analyse beleuchten.
II.Herausforderungen bei der Schwerefeld Analyse und der zeitlichen Auflösung
Die Bestimmung von Schwerefeldlösungen aus GRACE-Daten erfordert eine hohe Datenmenge. Monatliche Mittelwerte führen zu zeitlichen Aliasing-Effekten, da hochfrequente Variationen unzureichend abgetastet werden. Um dies zu vermeiden, werden bekannte hochfrequente Variationen (z.B. Gezeiten, atmosphärische und ozeanische Massenvariationen, modelliert im AOD1B-Produkt) vorab aus den Beobachtungen entfernt (Dealiasing). Die Arbeit präsentiert einen Ansatz zur Reduktion dieser Fehler durch die Verwendung eines Kalman-Filters und die Berücksichtigung zeitlicher Korrelationen zwischen aufeinanderfolgenden Tagen.
1. Die Herausforderung des zeitlichen Aliasings bei monatlichen Schwerefeldlösungen
Ein Hauptproblem bei der bisherigen Auswertung von GRACE-Daten ist die Verwendung monatlicher Mittelwerte zur Bestimmung von Schwerefeldlösungen. Diese Vorgehensweise führt zu einem signifikanten Problem: dem zeitlichen Aliasing. Hochfrequente Variationen des Erdschwerefelds, die innerhalb eines Monats auftreten, werden unzureichend abgetastet und somit verfälscht in den monatlichen Mittelwerten dargestellt. Dies führt zu einer Reduktion der Genauigkeit und erschwert das Verständnis der zugrundeliegenden geophysikalischen Prozesse. Um präzisere Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, die zeitliche Auflösung der Schwerefeldmessungen zu erhöhen. Die unzureichende Abtastung der hochfrequenten Variationen innerhalb eines Monats limitiert die Aussagekraft der bisherigen Datenanalyse. Die Arbeit argumentiert, dass eine höhere zeitliche Auflösung, konkret die Bestimmung täglicher Schwerefeldlösungen, unerlässlich ist, um dieses Problem des zeitlichen Aliasings zu minimieren und die Genauigkeit der Ergebnisse deutlich zu verbessern.
2. Strategien zur Vermeidung von Aliasing Effekten Dealiasing und geophysikalische Hintergrundmodelle
Um die Aliasing-Fehler zu reduzieren, werden in der GRACE-Datenverarbeitung gängige Strategien des Dealiasings eingesetzt. Diese basieren auf der Verwendung von geophysikalischen Hintergrundmodellen, welche bekannte hochfrequente Variationen des Erdschwerefelds modellieren. Diese Modelle berücksichtigen unter anderem die Effekte der Erd- und Ozeangezeiten sowie hochfrequente Massenvariationen der Atmosphäre und des Ozeans. Das AOD1B-Produkt (Atmosphären- und Ozean-Dealiasing für GRACE L1B Daten) fasst diese Modelle zusammen und dient als Grundlage für die Vorverarbeitung der GRACE-Daten. Durch die Subtraktion dieser modellierten Variationen vor der eigentlichen Schwerefeldanalyse werden die Aliasing-Effekte reduziert. Die Qualität der Dealiasing-Ergebnisse hängt stark von der Genauigkeit der verwendeten Hintergrundmodelle ab. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, diese Modelle kontinuierlich zu verbessern und zu verfeinern, um die Genauigkeit der Schwerefeldlösungen zu optimieren. Die Anwendung des Dealiasings stellt einen wichtigen Schritt in der Datenverarbeitung dar, um die Auswirkungen des zeitlichen Aliasings zu minimieren. Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Hintergrundmodelle wird im Abschnitt 5.1 versprochen.
3. Der Ansatz der Arbeit Tägliche Schwerefeldlösungen mittels Kalman Filter und Berücksichtigung zeitlicher Korrelationen
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Methoden, die auf monatlichen Mittelwerten basieren, verfolgt diese Arbeit einen innovativen Ansatz zur Bestimmung täglicher GRACE-Schwerefeldlösungen. Dies ermöglicht eine signifikant höhere zeitliche Auflösung und reduziert somit das Problem des zeitlichen Aliasings. Der gewählte Ansatz basiert auf einer stochastischen Modellierung des Erdschwerefelds als dynamisches System und der Anwendung eines Kalman-Filters. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die Berücksichtigung der zeitlichen Korrelationen zwischen den Schwerefelddaten aufeinanderfolgender Tage. Durch diese Berücksichtigung von Vorinformationen wird die Genauigkeit der täglichen Schwerefeldlösungen verbessert, was zu einem verbesserten Dealiasing-Produkt und letztendlich zu präziseren monatlichen Lösungen führt. Die Arbeit präsentiert somit eine Methode, die die Limitationen der bisherigen Ansätze mit monatlicher zeitlicher Auflösung durch eine deutlich verbesserte zeitliche Auflösung umgeht, und so zu genaueren Ergebnissen in der Erdschwerefeldforschung beiträgt. Die Integration des Kalman-Filters und die Berücksichtigung der zeitlichen Korrelationen stellen die Kerninnovation dieses Ansatzes dar.
III.Stochastische Modellierung und Kalman Filter
Die Arbeit modelliert das Erdschwerefeld als dynamisches System. Eine vollständige physikalische Modellierung ist zu komplex, daher wird eine stochastische Modellierung mit einem Kalman-Filter verwendet. Durch die Berücksichtigung der vollständigen Korrelationsstruktur aufeinanderfolgender Tage werden zeitliche Aliasing-Effekte reduziert und eine Zeitreihe täglicher Schwerefeldlösungen berechnet. Dies liefert ein verbessertes Dealiasing-Produkt für die Ableitung monatlicher Lösungen. Der Ansatz basiert auf der Annahme geringer Unterschiede zwischen den Schwerefeldern aufeinanderfolgender Tage, ähnlich dem Mascon-Ansatz. Vergleichbare Ansätze nutzen räumliche und zeitliche Korrelationen, oft modelliert durch Exponentialfunktionen.
1. Die Wahl der stochastischen Modellierung
Die Arbeit verwendet eine stochastische Modellierung des Erdschwerefelds, da eine vollständige physikalische Modellierung der Dynamik des Erdsystems zu komplex ist. Das Erdschwerefeld wird als dynamisches System betrachtet, welches mit GRACE beobachtet wird. Die stochastische Modellierung erlaubt die Berücksichtigung von Unsicherheiten und Modellungenauigkeiten. Die vollständige Korrelationsstruktur aufeinanderfolgender Tage wird in das Modell integriert, was eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Kalman-Filter-Ansatzes ist. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass auch komplexe, nicht vollständig deterministisch modellierbare Prozesse im Erdsystem berücksichtigt werden können, was zu einer robusteren und realistischeren Darstellung des Erdschwerefeldes führt. Die stochastische Modellierung steht im Gegensatz zu deterministischen Ansätzen, bei denen alle Modellparameter direkt messbar sind. Im Kontext der globalen hydrologischen Modellierung sind deterministische Ansätze häufig nicht praktikabel, da die relevanten Parameter nicht direkt messbar sind.
2. Der Kalman Filter Ansatz zur Bestimmung täglicher Schwerefeldlösungen
Die Kernmethode der Arbeit ist die Anwendung eines Kalman-Filters zur Bestimmung einer Zeitreihe täglicher GRACE-Schwerefeldlösungen. Der Kalman-Filter ist ein weit verbreiteter Algorithmus zur Schätzung des Zustands eines dynamischen Systems basierend auf verrauschten Messungen und einem Prozessmodell. Durch die Kombination des Prozessmodells, welches die zeitlichen Korrelationen zwischen aufeinanderfolgenden Tagen berücksichtigt, und des Beobachtungsmodells (GRACE-Daten) ermöglicht der Kalman-Filter eine optimale Schätzung des täglichen Schwerefelds. Zeitliche Aliasing-Effekte werden durch die Berücksichtigung der vollständigen Korrelationsstruktur zweier aufeinanderfolgender Tage reduziert. Neben der Filterung wird auch ein Glättungsalgorithmus (RTS-Smoother) eingesetzt, um die Genauigkeit der Zustandsschätzung weiter zu verbessern. Der RTS-Smoother berücksichtigt auch zukünftige Beobachtungen bei der Schätzung des aktuellen Zustands. Da die GRACE-Daten im Postprocessing ausgewertet werden, ist diese Vorgehensweise optimal, um alle verfügbaren Informationen zu nutzen. Die Anwendung des Kalman-Filters ist ein zentrales Element, das die Arbeit von anderen Ansätzen unterscheidet und zu einer verbesserten Genauigkeit und zeitlichen Auflösung führt.
3. Vergleich mit anderen Ansätzen Einbezug von Vorinformationen und Korrelationsstrukturen
Der Ansatz der Arbeit ähnelt in einigen Aspekten dem Mascon-Ansatz, bei dem ebenfalls räumliche und zeitliche Korrelationen zur Verbesserung der Schwerefeldlösungen genutzt werden. Die Hauptunterschiede liegen in der unterschiedlichen Parametrisierung (Kugelfunktionsreihe vs. Mascons) und in der Art, wie die Vorinformationen eingebracht werden. Die Arbeit betont die Bedeutung der Einführung von Vorinformationen, die es ermöglichen, eine tägliche zeitliche Auflösung zu erreichen. Bei Kurtenbach et al. (2009) wird beispielsweise angenommen, dass die Schwerefelder aufeinanderfolgender Tage bis auf eine Unsicherheit identisch sind. Diese Unsicherheit wird empirisch bestimmt. Im Gegensatz dazu wird in dieser Arbeit die vollständige Korrelationsstruktur zweier aufeinanderfolgender Tage berücksichtigt, um eine präzisere Schätzung zu ermöglichen. Die Arbeit diskutiert den Unterschied zwischen einer analytischen Beschreibung der Korrelationsstruktur (wie z.B. durch Exponentialfunktionen im Mascon-Ansatz) und einer empirischen Beschreibung mittels Matrizen, die aus vorhandenen geophysikalischen Modellen abgeleitet werden. Der Ansatz der Arbeit stellt somit eine Weiterentwicklung bestehender Verfahren dar, indem er die volle Korrelationsstruktur berücksichtigt und einen Kalman-Filter zur optimalen Schätzung einsetzt.
IV.Simulationsstudie und Ergebnisse
Eine Simulationsstudie mit synthetischen GRACE-Daten, generiert mit den Modellen NCEP, MOG2d und GLDAS (Prozesssignal x_AOH_t abgeleitet aus ECMWF, OMCT und WGHM), evaluiert den Kalman-Filter-Ansatz. Das Referenzsignal (x_ref_t) simuliert kurzzeitige Erdschwerefeldvariationen. Die Ergebnisse zeigen eine gute Rekonstruktion des Referenzsignals, insbesondere in höheren Breiten. Die Korrelation zwischen Referenzsignal und gefiltertem Signal liegt im globalen Mittel bei 0.7, mit einer Signalreduktion von ca. 69%. Die Wahl der Startwerte des Kalman-Filters hat nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse. Untersuchungen zu Datenlücken zeigen eine schnelle Konvergenz nach dem Wiederbeginn der Beobachtungen.
1. Simulation des zeitvariablen Schwerefelds und des Referenzsignals
Die Simulationsstudie generiert synthetische GRACE-Beobachtungen basierend auf einem zeitvariablen Schwerefeldsignal. Dieses Signal wird mithilfe der geophysikalischen Modelle NCEP, MOG2d und GLDAS simuliert. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Daten zu gewährleisten, wird für die Ableitung des Prozessmodells auf unabhängige Modelle zurückgegriffen: ECMWF, OMCT und WGHM. Das resultierende Referenzsignal (x_ref_t), bestehend aus 365 Datensätzen von Potentialkoeffizienten (bis Grad und Ordnung 40), repräsentiert die kurzzeitigen Variationen des Erdschwerefelds. Langzeitliche Schwankungen werden in der Simulation nicht berücksichtigt. Die räumliche Verteilung der Variabilität des Referenzsignals zeigt größere atmosphärische Variationen in höheren Breiten, die über den Ozeanen teilweise kompensiert werden. Der Antarktische Zirkumpolarstrom zeigt schnelle und große Massenvariationen. Das hydrologische Signal weist eine geringere Frequenz und Amplitude auf. Äquatornahe Regionen zeigen im Durchschnitt eine geringere Variabilität (unter 2 cm äquivalente Wasserhöhe (ewh)) im Vergleich zu höheren Breiten (durchschnittlich 2.7 cm ewh, maximal bis 12.5 cm ewh).
2. Auswertung der simulierten GRACE Daten mit dem Kalman Filter
Die simulierten GRACE-Beobachtungen werden mit dem entwickelten Kalman-Filter-Ansatz ausgewertet. Hierbei wird ein empirisches Prozessmodell verwendet, welches aus den unabhängigen Modellen ECMWF, OMCT und WGHM abgeleitet wird. Die Auswertung liefert eine Zeitreihe von 365 Zustandsvektoren (ˆx+t), die jeweils 1677 Potentialkoeffizienten enthalten. Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen dem gefilterten Signal und dem Referenzsignal. Die A-priori-Schätzung (Prädiktion) und die A-posteriori-Schätzung (Filterung) rekonstruieren das Referenzsignal gut, wobei die Filterung durch Hinzunahme der GRACE-Beobachtungen eine deutliche Verbesserung der Prädiktion erzielt. Der Einfluss der Wahl der Startwerte des Kalman-Filters auf die Ergebnisse wird untersucht und als gering bewertet. Die Analyse zeigt, dass in höheren Breiten eine nahezu vollständige Rekonstruktion des Referenzsignals möglich ist, während in äquatornahen Gebieten die Übereinstimmung geringer ist, was auf die geringere Datenabdeckung zurückzuführen ist.
3. Quantitative Bewertung der Filterleistung und Analyse von Fehlerquellen
Die Leistungsfähigkeit des Kalman-Filter-Ansatzes wird quantitativ anhand verschiedener Kennzahlen bewertet: Korrelationskoeffizient, Fehler-RMS (eRMS) und Signalreduktion. Die Ergebnisse zeigen im globalen Mittel eine Korrelation von 0,7 zwischen dem Referenzsignal und dem gefilterten Signal und eine durchschnittliche Signalreduktion von etwa 69%. Untersuchungen zu Datenlücken zeigen, dass die Filterung nach einem kurzen Zeitraum der Datenlücke wieder zum Referenzsignal konvergiert. Die Analyse identifiziert Bereiche, in denen die Übereinstimmung zwischen dem Referenzsignal und dem gefilterten Signal geringer ausfällt, z.B. im arktischen Meer oder südlichen Lateinamerika. Dies wird auf Abweichungen zwischen dem verwendeten Prozessmodell und der tatsächlichen Variabilität des simulierten Referenzsignals zurückgeführt. Eine Erhöhung des Prozessrauschens wird als mögliches Mittel zur Verbesserung der Ergebnisse in diesen Gebieten vorgeschlagen. Die Studie liefert somit umfassende Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit des Kalman-Filter-Ansatzes und identifiziert Verbesserungspotenziale.
V.Validierung mit Echt GRACE Daten und Vergleichsdaten
Die entwickelten täglichen Schwerefeldlösungen werden mit unabhängigen Datensätzen validiert: GPS-Messungen von Vertikaldeformationen an IGS-Stationen und Ozeanbodendruck-Daten (OBP). In höheren Breiten zeigen sich hohe Korrelationen zwischen den GRACE- und GPS-Daten, die teilweise besser sind als die Korrelationen zwischen GPS und dem AOD1B-Produkt. Im Nordpolarmeer verbessern die GRACE-Lösungen die Übereinstimmung mit OBP-Messungen. In äquatornahen Regionen ist die Übereinstimmung geringer, was auf die geringere Datenabdeckung und den Einfluss des Prozessmodells zurückzuführen ist. Die Arbeit zeigt das Potential der täglichen Schwerefeldlösungen zur Verbesserung des Dealiasing von monatlichen Lösungen.
1. Vergleich mit GPS Daten Vertikaldeformationen an IGS Stationen
Die Validierung der mit dem Kalman-Filter-Ansatz berechneten täglichen GRACE-Schwerefeldlösungen erfolgt durch einen Vergleich mit GPS-Messungen von Vertikaldeformationen an Stationen des International GNSS Service (IGS). Die Vergleichsdaten stellen unabhängige Beobachtungen von kurzzeitigen Erdsystemvariationen dar. Der Vergleich zeigt, dass in einem Großteil der Stationen, insbesondere in höheren Breiten, hohe Korrelationen zwischen den GRACE- und GPS-Zeitreihen bestehen. Diese Korrelationen sind in vielen Fällen deutlich höher als die Korrelationen zwischen den GPS-Daten und dem AOD1B-Produkt, welches nur atmosphärische und ozeanische Massenvariationen berücksichtigt. Die Verbesserung der Korrelation wird auf die Berücksichtigung von kurzzeitigen hydrologischen Variationen in der GRACE-Zeitreihe zurückgeführt, die im AOD1B-Produkt fehlen. An einigen Stationen, besonders in Äquatornähe, sind die Korrelationen geringer, was auf eine geringere Datenabdeckung und kleinere Signalamplituden in diesen Regionen zurückzuführen ist. Ein Beispiel für eine Station mit geringer Korrelation ist die Station GLPS auf den Galapagos-Inseln, welche sich in Äquatornähe befindet und nur eine geringe Variabilität aufweist.
2. Vergleich mit Ozeanbodendruck Daten OBP Regionale Unterschiede in der Übereinstimmung
Zusätzlich zu den GPS-Daten werden die täglichen GRACE-Schwerefeldlösungen mit Daten von Ozeanbodendruck-Rekordern (OBP) verglichen. Diese Messungen liefern punktuelle Informationen über kurzzeitige Variationen des Erdschwerefelds über den Ozeanen. Der Vergleich zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen den GRACE-Zeitreihen und den OBP-Daten in einigen Regionen, insbesondere im Nordpolarmeer. In dieser Region ist die Übereinstimmung teilweise deutlich besser als die des AOD1B-Produkts, welches zur Reduktion von kurzzeitigen Schwerefeldvariationen in der Verarbeitung der GRACE-Monatslösungen verwendet wird. Die Verbesserung wird auf die Berücksichtigung hydrologischer Variationen in den GRACE-Tageslösungen zurückgeführt. In anderen Regionen, vor allem in äquatornahen Gebieten, führt die Hinzunahme des GRACE-Signals jedoch nicht zu einer Verbesserung der Korrelation zu den OBP-Messungen; in einigen Fällen verschlechtert sich die Übereinstimmung sogar. Dies wird auf den lokalen Charakter der OBP-Beobachtungen im Gegensatz zu der räumlich glättenden Natur der GRACE-Zeitreihen zurückgeführt. Die Arbeit verweist auf Macrander et al. (2010) für die räumliche Verteilung der OBP-Rekorder und auf Morison et al. (2007) für die Bestätigung der guten Übereinstimmung von GRACE mit OBP-Zeitreihen im Nordpolarmeer bei monatlicher Auflösung.
3. Gesamtbewertung der Validierung und Verbesserungspotenzial für monatliche Schwerefeldlösungen
Die Validierung der täglichen GRACE-Schwerefeldlösungen mit GPS- und OBP-Daten zeigt, dass der vorgestellte Ansatz, insbesondere in höheren Breiten, in der Lage ist, kurzzeitige Schwerefeldvariationen zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung der Übereinstimmung mit den GPS-Daten im Vergleich zum AOD1B-Produkt, hauptsächlich aufgrund der Berücksichtigung hydrologischer Variationen. Im Nordpolarmeer bestätigt der Vergleich mit OBP-Daten das Verbesserungspotenzial des AOD1B-Produkts. In Äquatornähe ist die Übereinstimmung geringer, was auf die geringere Datenabdeckung und den Einfluss des Prozessmodells zurückzuführen ist. Die täglichen Schwerefeldlösungen werden als verbessertes Dealiasing-Produkt interpretiert, da sie neben atmosphärischen und ozeanischen auch kurzzeitige hydrologische Variationen mit einer täglichen Auflösung enthalten. Die Arbeit verweist auf Van Dam et al. (2007) bezüglich der Verbesserung von Monatslösungen durch verbesserte Dealiasing-Produkte. Abbildung 5.4 illustriert die Größenordnung der Verbesserungen anhand von Korrelationskoeffizienten, Fehler-RMS und Signalreduktion.
Dokumentreferenz
- Mean annual and seasonal atmospheric tide models based on 3-hourly and 6-hourly ECMWF surface pressure data (Biancale, R., und A. Bode (2006))
