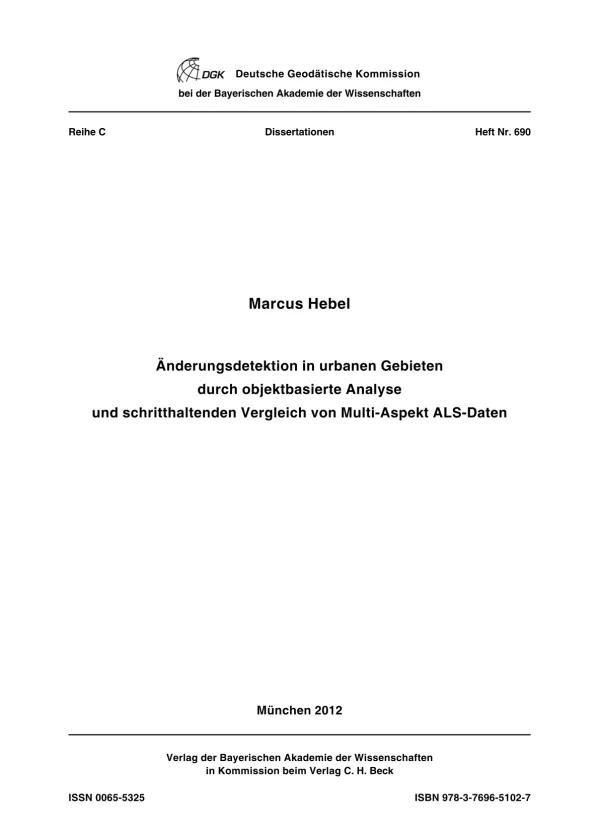
Änderungsdetektion mit ALS-Daten
Dokumentinformationen
| Autor | Marcus Hebel |
| Schule | Technische Universität München |
| Fachrichtung | Bauingenieur- und Vermessungswesen |
| Dokumenttyp | Dissertation |
| Ort | München |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 8.06 MB |
Zusammenfassung
I.Airborne Laser Scanning ALS zur Änderungserkennung in urbanen Gebieten
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von flugzeuggetragenem Laserscanning (ALS), auch bekannt als LiDAR, zur Änderungserkennung in urbanen Gebieten. Die Technologie ermöglicht eine direkte dreidimensionale Georeferenzierung der 3D Punktwolke, unabhängig von der Beleuchtung. ALS ist besonders für die schnelle Erfassung von Fernerkundungsdaten und die Bewertung kurzfristiger Veränderungen geeignet, z.B. nach Naturkatastrophen. Die Verwendung schräg geneigter Scanner erlaubt die gleichzeitige Erfassung von Dachlandschaften und Hausfassaden (Multi-Aspekt Daten). Ein wichtiger Aspekt ist die Punktwolkenregistrierung, insbesondere die Koregistrierung von Daten aus verschiedenen Zeitpunkten (t1 und t2).
1. Airborne Laser Scanning ALS Technologie und Anwendung in urbanen Gebieten
Der Hauptfokus liegt auf der Anwendung von Airborne Laser Scanning (ALS), auch bekannt als LiDAR, für die Änderungserkennung in urbanen Gebieten. ALS bietet gegenüber traditionellen Methoden wie hochauflösenden Luftbildern den Vorteil einer direkten dreidimensionalen Erfassung der Geländeoberfläche, unabhängig von Tages- oder Nachtzeit sowie künstlicher Beleuchtung. Diese Eigenschaft macht ALS besonders geeignet für die schnelle Erfassung von Fernerkundungsdaten und die effiziente Bewertung kurzfristig auftretender Veränderungen. Die Technologie basiert auf der Emission und Detektion von Laserlicht zur Entfernungsmessung, wobei eine flächige Abtastung des Geländes durch steuerbare Ablenkspiegel an einem fliegenden Sensorträger realisiert wird. Die präzise Positionsbestimmung des Sensorträgers erfolgt synchron durch hochgenaue Navigationssensoren. Die Daten werden in Form einer 3D Punktwolke erfasst und liefern eine detaillierte Darstellung des urbanen Raumes. Der Einsatz eines schräg nach vorne geneigten Laserscanners ermöglicht die simultane Erfassung von Dachlandschaften und Hausfassaden, wobei die Kombination verschiedener Ansichten (Multi-Aspekt Daten) Verdeckungen minimiert. Dies ist besonders relevant für die umfassende und genaue Erfassung von komplexen urbanen Strukturen.
2. Einsatzszenarien und Herausforderungen bei der Datenerfassung
Die Anwendung von ALS zur Änderungserkennung wird in zwei Hauptkontexten betrachtet: Erstens, die Erfassung von Veränderungen in einem urbanen Gebiet im Vergleich zu einem vorherigen Zustand (Zeitpunkt t1 vs. t2). Hierbei dient eine bestehende Datenbank als Referenz, und die Zielsetzung ist eine schritthaltende Verarbeitung der aktuellen ALS-Daten, um relevante Änderungen sofort zu erkennen und an eine Bodenstation zu übermitteln. Dies ist beispielsweise bei Rettungseinsätzen nach Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben) wichtig. Herausforderungen in diesem Szenario sind Sichtbehinderungen durch Rauch oder Staub sowie mögliche Ungenauigkeiten oder Ausfälle der satellitengestützten Positionsbestimmung. Zweitens wird der Einsatz von ALS in Fluggeräten betrachtet, die nicht primär für die topografische Erfassung, sondern für andere Aufgaben wie Such- und Rettungseinsätze verwendet werden. In solchen Fällen ist die Flexibilität der Sensoren und die Möglichkeit des Austauschs zwischen verschiedenen Fluggeräten von Vorteil. Die erhöhte mechanische Beanspruchung des Sensorträgers unter diesen Bedingungen führt zu einer veränderten Relativorientierung der Systemkomponenten und erfordert eine in-situ Neukalibrierung des ALS-Systems, idealerweise vor oder während des Einsatzes, und zwar unabhängig vom Scanmuster des Laserscanners.
3. Datenverarbeitung und Fehlerquellen
Die Anpassung parametrisierter Modelle an die 3D-Punkte der erfassten Punktwolke ist ein zentraler Aspekt der Datenverarbeitung. Die Annahme, dass urbane Gebiete überwiegend planare Flächen (Dächer und Fassaden) aufweisen, ermöglicht die Anwendung von Methoden wie der Hough-Transformation zur Schätzung von Ebenenparametern. Weitere Ansätze basieren auf lokalen Merkmalen der Punktwolke, z.B. Hauptkomponentenanalyse. Die Flächensegmentierung erfolgt durch Clusteranalyse im Merkmalsraum. Das Iterative Closest Point (ICP)-Verfahren wird als gängige Methode zur Punktwolkenregistrierung genannt, weist aber den Nachteil auf, oft nur in einem lokalen Minimum der Fehlerfunktion zu konvergieren, besonders bei anfänglich stark unterschiedlicher Position und Orientierung der Punktwolken. Eine gute Anfangsnäherung (Grobregistrierung), die normalerweise durch satellitengestützte Positionsbestimmung gewährleistet wird, ist daher entscheidend. Fehlerquellen bei der Georeferenzierung umfassen u.a. die Genauigkeit der satellitengestützten Positionsbestimmung (GNSS), Synchronisationsfehler zwischen Laserscanner- und Navigationsdaten, sowie die Größe des Laser-Footprints (ausgeleuchtete Fläche). Diese Fehlerquellen führen zu systematischen Verschiebungen und Verzerrungen innerhalb der Punktwolken und erschweren die präzise Registrierung.
II.Methoden zur Punktwolkenregistrierung und Ebenen Segmentierung
Die Arbeit beschreibt Methoden zur präzisen Punktwolkenregistrierung, indem sie sich mit der Koregistrierung von 3D Punktwolken aus verschiedenen ALS-Datenaufnahmen befasst. Hierbei werden Verfahren wie das ICP-Verfahren (Iterative Closest Point) und alternative, robustere Ansätze vorgestellt, die auf der Ebenen Segmentierung basieren. Die Segmentierung ebener Flächen (Fassaden, Dächer) ermöglicht eine zuverlässige Zuordnung von Punkten zwischen verschiedenen Datensätzen. Algorithmen wie RANSAC werden verwendet, um Ausreißer zu filtern und die Genauigkeit der Ebenen Segmentierung zu verbessern. Die Methode ermöglicht eine objektbasierte Koregistrierung, die auch bei großen Versätzen, z.B. durch fehlerhafte GNSS/INS-Kombination, robust funktioniert.
1. Punktwolkenregistrierung mit dem ICP Verfahren und dessen Limitationen
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Punktwolkenregistrierung, wobei das Iterative Closest Point (ICP)-Verfahren als etablierte Methode diskutiert wird. Das ICP-Verfahren iterativ die nächsten Punkte in zwei Punktwolken aufeinander ab und berechnet daraus eine Transformation (Rotation und Translation), um die Punktwolken optimal aufeinander auszurichten. Die Methode konvergiert zwar immer, jedoch oft nur zu einem lokalen Minimum der Fehlerfunktion, insbesondere wenn die Ausgangspositionen und -orientierungen der Punktwolken stark voneinander abweichen. Diese Problematik wird deutlich, wenn Position und Orientierung der Punktwolken zu Beginn der Iteration sehr unterschiedlich sind. Die Erreichung des globalen Optimums erfordert daher eine gute Anfangsnäherung (Grobregistrierung). Während bei ALS-Daten durch die satellitengestützte Positionsbestimmung diese Voraussetzung im Normalfall erfüllt ist, können Probleme auftreten, wenn diese Positionsbestimmung fehlerhaft ist, undokumentierte 3D-Daten aus verschiedenen Quellen verglichen werden oder unterschiedliche Koordinatensysteme vorliegen. Zur Verbesserung der Konvergenz wird in der Literatur der Einsatz von evolutionären Algorithmen vorgeschlagen, die viele verschiedene Startparameter parallel abarbeiten, um einen größeren Konvergenzbereich zu erzielen.
2. Ebenenbasierte Punktwolkenregistrierung und Ebenen Segmentierung
Als Erweiterung des ICP-Verfahrens und zur Verbesserung der Robustheit wird eine ebene-basierte Punktwolkenregistrierung vorgestellt. Diese basiert auf der vorherigen Segmentierung der 3D-Daten in planare Regionen (Ebenen oder Ebenenstücke), welche besonders in urbanen Gebieten, die überwiegend planare Flächen (Fassaden und Dächer) aufweisen, sinnvoll ist. Die Zuordnung homologer Ebenenstücke in verschiedenen Punktwolken erfolgt anhand von Positions-, Lage- und Formmerkmalen. Ein scanzeilenbasiertes Segmentierungsverfahren wird für die schritthaltende Datenverarbeitung (Zeitpunkt t2) vorgeschlagen. Zwei ebenenbasierte Koregistrierungsverfahren werden verglichen: die Verwendung von Schnittpunkten zugeordneter Ebenentripel als virtuelle 3D-Punkte und die direkte Angleichung identisch erkannter Ebenen. Die zweite Methode erweist sich als stabiler und wird bevorzugt. Die RANSAC-Methode wird eingesetzt, um Fehlzuordnungen von Ebenen zu filtern, wodurch die Registrierungsparameter zuverlässig durch einmaliges Lösen eines linearen Gleichungssystems bestimmt werden können. Experimente zeigen, dass durch die Nutzung von Flächenmerkmalen und den RANSAC-Ansatz eine Koregistrierung selbst bei relativ großem Versatz der Punktwolken möglich ist.
3. Vergleichende Analyse und Erweiterung auf mehrere überlappende Datensätze
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze zur Ebenen Segmentierung und deren Anwendung in der Punktwolkenregistrierung. Der Vergleich von ebenenbasierten Verfahren mit dem ICP-Verfahren unterstreicht die Vorteile der ebenenbasierten Methode, insbesondere die Robustheit gegenüber großen Versätzen und die Vermeidung von lokalen Minima. Es wird erwähnt, dass die Zuordnung von Ebenensegmenten weitgehend unabhängig von deren diskreter Repräsentation in den Punktwolken ist. Die Erweiterung des Verfahrens auf mehrere überlappende ALS-Datensätze wird ebenfalls behandelt. Verschiedene Autoren (Skaloud & Schär [2007], Habib et al. [2007], Kager [2004]) und kommerzielle Softwareprodukte (RiProcess, Attune, LMS) werden zitiert, die ähnliche Ansätze zur ALS-Streifenanpassung verfolgen, wobei automatische Dachflächen-Erkennung und die Verwendung von Luftbildern als Referenzflächen diskutiert werden. Der Einfluss von verschiedenen Parametern auf die Qualität der Registrierung und die Auswahl geeigneter Flugpfade werden ebenfalls angesprochen.
III.Kalibrierung des ALS Systems und Georeferenzierung
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Boresight-Kalibrierung des ALS-Systems. Diese Kalibrierung ist essentiell für die Genauigkeit der Georeferenzierung und wird nach der Beseitigung von GNSS-bedingten Fehlern mittels PPK- oder RTK-Korrekturdaten durchgeführt. Die Kalibrierung nutzt homologe Ebenen in überlappenden 3D Punktwolken, um die Relativausrichtung von IMU und Laserscanner zu optimieren. Die Verwendung von Multi-Aspekt Daten und die Berücksichtigung von Flächenmerkmalen verbessern die Robustheit der Kalibrierung. Die Genauigkeit der Georeferenzierung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Genauigkeit der GNSS/INS-Kombination, die Strahldivergenz und Synchronisierungsprobleme.
1. Georeferenzierung und Koordinatensysteme
Die genaue Georeferenzierung der erfassten 3D-Punktwolken ist essentiell für die Genauigkeit der Analyse. Der Text beschreibt die Grundlagen geographischer Koordinaten und verschiedener Koordinatensysteme, die in der Vergangenheit verwendet wurden (z.B. Bessel-Ellipsoid, Gauß-Krüger-Koordinaten, Potsdam-Datum). Die Entwicklung des GPS und die Einführung des World Geodetic System 1984 (WGS84) als globales Referenzsystem wird erläutert, ebenso wie das Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS89) für Deutschland. Die Unterschiede zwischen WGS84 und ETRS89 im Submeterbereich werden erwähnt. Zur Vereinfachung der Berechnungen wird die Verwendung eines kartesischen Koordinatensystems (Universal Transverse Mercator, UTM) vorgeschlagen. Das UTM-System unterteilt die Erde in 6° breite Zonen, wobei in jeder Zone eine Zylinderfläche als Projektionsfläche dient. Deutschland liegt größtenteils in UTM-Zone 32, der östliche Teil in Zone 33. Die Genauigkeit der Georeferenzierung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, unter anderem durch die Genauigkeit der GNSS-Messungen, atmosphärische Einflüsse (Ionosphäre und Troposphäre) und die Genauigkeit der Satellitenuhren. Im GPS-SPS-Modus liegt die Genauigkeit bestenfalls bei ca. 4m horizontal und 8m vertikal.
2. Boresight Kalibrierung des ALS Systems
Die Boresight-Kalibrierung des ALS-Systems, also die präzise Bestimmung der Relativausrichtung zwischen IMU und Laserscanner, ist ein kritischer Schritt zur Verbesserung der Genauigkeit. Diese Kalibrierung kann erst nach der Beseitigung von GNSS-bedingten Fehlern durchgeführt werden, da diese Fehler sonst die Ergebnisse verfälschen würden. Der Einsatz von PPK- oder RTK-Korrekturdaten von GNSS-Referenzstationen (z.B. SAPOS in Deutschland) ist notwendig, um den Einfluss von GNSS-Fehlern auf wenige Zentimeter zu reduzieren. Ein möglicher Ansatz zur Boresight-Kalibrierung besteht in der Identifizierung homologer Punkte in überlappenden Punktwolken. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, homologe Punkte zu finden, gering, da es sich um unterschiedliche Abtastungen des Geländes handelt. Ähnliche Probleme treten bei ICP-artigen Koregistrierungsverfahren auf, wo oft die Distanzen zwischen Punkten und Tangentialebenen betrachtet werden, um das Problem zu umgehen. Die Arbeit impliziert, dass eine alternative Methode, die auf der Zuordnung von ebenen Flächenstücken basiert, präziser und robuster ist, besonders wenn Multi-Aspekt Daten verwendet werden.
3. Einflussfaktoren auf die Genauigkeit der Georeferenzierung und Kalibrierung
Die Genauigkeit der Georeferenzierung und die Qualität der Kalibrierung werden durch verschiedene Fehlerquellen beeinflusst. Die wichtigsten Fehlerquellen beim ALS werden in einem separaten Abschnitt ausführlich behandelt. Nach einer PPK- oder RTK-Korrektur der GNSS-Daten hat insbesondere die Fehlstellung zwischen IMU und Laserscanner (Boresight-Fehler) einen wesentlichen Einfluss auf die Positionsgenauigkeit der Laserpunkte. Andere Fehlerquellen umfassen Messrauschen, Synchronisationsfehler (et), Positionsfehler (ep) und Orientierungsfehler (eo) der Navigationssensoren, sowie der Fehler aufgrund der Größe des Laser-Footprints (ef). Diese Fehler führen zu lokalen Verschiebungen und Verzerrungen der Punktwolken. Die Arbeit betont die Wichtigkeit optimaler Bedingungen für die Kalibrierung, die sich z.B. aus einer geringen Flughöhe, einer präzisen PPK-Korrektur und einer variantenreichen Struktur des zu erfassenden Geländes ergeben. Die Verwendung von mehreren Flugrichtungen und die daraus resultierende Vielfalt an Flächenorientierungen in den ALS-Daten verbessern die Ergebnisse der Systemkalibrierung deutlich. Der Ort Abenberg wird als Beispiel für ein Gelände mit optimalen Bedingungen genannt.
IV.Automatische Änderungserkennung mit ALS Daten
Die Arbeit präsentiert ein Verfahren zur automatischen Änderungserkennung in urbanen Gebieten basierend auf Multi-temporalen ALS-Daten. Der Ansatz nutzt die Vergleichung von Referenzdaten (t1) mit aktuellen Messungen (t2). Eine voxelbasierte Methode identifiziert räumliche Konflikte (hinzugekommene oder verschwundene Volumen) und berücksichtigt dabei Verdeckungen und Abschattungen, im Gegensatz zu einfachen DOM-Differenzbildungen. Die Klassifizierung von Laserpunkten (Boden, Vegetation, Gebäude) hilft, saisonale Veränderungen von relevanten Änderungen zu unterscheiden. Die Effizienz des Verfahrens ermöglicht eine schritthaltende Änderungserkennung.
1. Ansatz der automatischen Änderungserkennung
Die vorgestellte Methode zur automatischen Änderungserkennung basiert auf dem Vergleich von ALS-Daten zweier Zeitpunkte (t1 und t2). Zeitpunkt t1 repräsentiert eine Referenzdatenbank, erstellt unter optimalen Bedingungen mit mehrfacher Erfassung des Gebietes aus verschiedenen Flugrichtungen. Die Daten von t1 werden nachträglich umfassend analysiert und klassifiziert (Boden, Vegetation, glatte Oberflächen). Zeitpunkt t2 repräsentiert aktuelle Messungen, z.B. während einer Mission (Rettungseinsatz). Hierbei steht eine schritthaltende Verarbeitung der Daten im Vordergrund, um zeitnah relevante Änderungen zu identifizieren. Der direkte Vergleich der ALS-Daten von t1 und t2 erfolgt auf der Ebene der Einzelmessungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die auf der Subtraktion von digitalen Oberflächenmodellen (DOM) basieren, berücksichtigt dieser Ansatz implizit Verdeckungen und Schatten, wodurch Fehlinterpretationen vermieden werden. Die Klassifizierung der Laserpunkte in t1 ermöglicht eine Bewertung der detektierten Änderungen in t2; beispielsweise können Veränderungen durch menschliche Aktivitäten von natürlichen Veränderungen (z.B. saisonale Vegetationsveränderungen) unterschieden werden.
2. Voxelbasierte Raumbelegung zur Änderungsdetektion
Zur effizienten Änderungsdetektion wird eine voxelbasierte Methode eingesetzt. Zwei Voxelgitter (VP und VR) mit identischen Abmessungen werden definiert und umfassen das gesamte relevante urbane Gebiet. VP speichert die Indizes der Laserpunkte nach ihrer Position, während VR die Indizes der Laserstrahlen speichert, die die entsprechenden Voxel durchdringen. Jeder Laserpuls wird als 3D-Rasterlinie durch VR verfolgt (z.B. mit einer 3D-Variante des Bresenham-Algorithmus). Dieser Ansatz erlaubt eine schnelle und individuelle Überprüfung jeder Einzelmessung auf mögliche Informationsüberschneidungen mit den Referenzdaten von t1. Die Methode identifiziert Konflikte in der Raumbelegung: gelbe Punkte kennzeichnen hinzugekommenes Volumen (neue Messungen in zuvor leeren Bereichen), rote Punkte kennzeichnen verschwundenes Volumen (neue Messungen in zuvor belegten Bereichen). Die voxelbasierte Methode ermöglicht eine schritthaltende Änderungserkennung, ohne dass zunächst eine vollständige Punktwolke aus den neuen Messungen generiert werden muss. Verdeckungen und Schatten werden implizit berücksichtigt.
3. Behandlung von Vegetation und experimentelle Ergebnisse
Ein wichtiger Aspekt der Änderungserkennung ist die Berücksichtigung von Vegetation. Saisonale Veränderungen der Vegetation können zu Fehlinterpretationen führen. Die Arbeit beschreibt Methoden, um den Einfluss saisonaler Vegetationsänderungen zu reduzieren. Verfahrensmodifikationen, die eine breitere Verteilung von Massenzuordnungen im Umfeld von Vegetation verwenden, ignorieren Volumenschwankungen durch Vegetation eher. Alternativ kann die Klassifikation der Lasermessungen (z.B. durch Pulsformanalyse) verwendet werden, um Vegetation generell nicht als Änderung einzustufen. Dies würde aber auch z.B. gefällte Bäume ignorieren. Experimente mit Daten aus Abenberg (2008 als Referenz, 2009 als Vergleich) zeigen die Funktionalität des Ansatzes. Die Ergebnisse der Änderungserkennung werden visuell dargestellt, wobei hinzugekommenes und verschwundenes Volumen durch gelbe bzw. rote Punkte gekennzeichnet wird, bestätigte planare Oberflächen grün und Bodenpunkte bräunlich. Die Analyse von Abenberg 2008 und 2009 Daten bestätigt die korrekte Erkennung von Vegetationsänderungen. Die Modifikationen reduzieren den Einfluss saisonaler Veränderungen, können aber zu Fehldetektionen führen, wenn Vegetation und Gebäude sehr dicht stehen.
V.Experimente und Ergebnisse
Die entwickelten Verfahren wurden anhand von realen ALS-Daten aus verschiedenen Messkampagnen (z.B. Abenberg 2008 und 2009) getestet. Das verwendete ALS-System am Fraunhofer IOSB in Ettlingen umfasste einen RIEGL LMS-Q560 Laserscanner und ein Applanix POS AV 410 Navigationssystem. Die Daten wurden mit PosPAC MMS nachverarbeitet. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Genauigkeit der Änderungserkennung und der Punktwolkenregistrierung, auch bei suboptimalen Bedingungen. Die erzielte Positionsgenauigkeit bei der gelände-basierten Navigation wurde abgeschätzt (z.B. durchschnittlich 70 cm Abweichung).
1. Eingesetztes Sensorsystem und Datenerfassung
Die Experimente basieren auf Daten, die zwischen 2006 und 2009 mit einem am Fraunhofer IOSB in Ettlingen entwickelten ALS-System erfasst wurden. Das System bestand aus einem RIEGL LMS-Q560 Laserscanner und einem Applanix POS AV 410 Navigationssystem. Die Datenerfassung erfolgte mittels Kreuzbefliegung der jeweiligen Testgebiete, d.h. das Gebiet wurde mehrfach aus verschiedenen Richtungen überflogen (3-6 Überflüge). Die schräge Sichtweise des Laserscanners erzeugte überlappende Datensätze mit verschiedenen Ansichten. Aufgrund des aufwendigen Planungsprozesses und der begrenzten Verfügbarkeit von geeigneten Sensorträgern (Hubschrauber) beschränkte sich der Einsatz auf wenige Tage pro Jahr. Um die Rechnerausstattung und Stromversorgung des Hubschraubers nicht zu überlasten, wurde auf einen Echtzeitzugriff auf die Daten verzichtet. Alle Experimente basieren daher auf einer Nachprozessierung der aufgezeichneten Rohdaten. Die Software PosPAC Mobile Mapping Suite (Version 5.2) von Applanix wurde für die Nachverarbeitung der GPS- und IMU-Daten (PPK) verwendet, wobei auch RINEX-Dateien von SAPOS-Stationen und präzise Ephemeriden der GPS-Satelliten berücksichtigt wurden. Die Positionsgenauigkeit des Systems, abhänging vom Betriebsmodus (RTK, PPK, Echtzeitlösung), wird in einer Tabelle zusammengefasst, wobei eine Driftrate von 0.5° pro Stunde angegeben ist. Das Applanix POS AV 410 liefert Positions- und Winkelwerte mit 200 Hz, der Laserscanner Daten mit 100 kHz.
2. Experimentelle Untersuchung in Abenberg
Als Beispiel für die Anwendung der entwickelten Verfahren werden detaillierte Ergebnisse für die Messkampagnen in Abenberg (2008 und 2009) präsentiert. Der Ort Abenberg wurde aufgrund seiner besonderen Gegebenheiten (verwinkelte Bebauung mit Einzelhäusern und hügeligem Gelände) ausgewählt. Die Befliegungen von Abenberg dienten dazu, die entwickelten Verfahren unter verschiedenen Bedingungen zu testen, insbesondere im Hinblick auf die Genauigkeit der Änderungserkennung und der gelände-basierten Navigation. Im Jahr 2009 wurden bei optimierten Navigationsbedingungen Daten mit einer Flughöhe von 300m (Messentfernungen bis 500m) und 600m (Messentfernungen bis 1km) erfasst. Bei der Befliegung in größerer Höhe traten Lücken in den Datensätzen auf, besonders in Bereichen mit Objekten geringer Reflektivität. Die Ergebnisse der Änderungserkennung basieren auf dem Vergleich von Daten aus Abenberg 2008 (Referenzdatensatz aus vier Überflügen) und Abenberg 2009 (einzelner Überflug). Ein Experiment mit absichtlich verfälschten Sensorpositionen wurde durchgeführt, um die Robustheit der Verfahren zu überprüfen. Die verbleibende Abweichung der berechneten Sensorpositionen lag im Durchschnitt bei 70 cm (Standardabweichung 25 cm) bei ca. 10-20 homologen Ebenen und verbesserte sich auf 45 cm bei bis zu 50 Paaren homologer Ebenen.
3. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
Die Ergebnisse der Experimente werden anhand von Abbildungen visualisiert und diskutiert. Für die Bewertung der Passgenauigkeit der Datensätze wird der Median der minimalen und maximalen lokalen Diskrepanzen verwendet, da das arithmetische Mittel durch Fehlzuordnungen aufgrund von Verdeckungen übermäßig beeinflusst würde. Das Intervall zwischen den beiden Medianwerten charakterisiert die Passgenauigkeit. Ein großes Intervall deutet auf partielle Unterschiede in der Passgenauigkeit hin. Die Ergebnisse bestätigen die Eignung der entwickelten Verfahren für die Änderungserkennung. Die in Abenberg erzielte Genauigkeit wird mit der tatsächlichen Trajektorie verglichen. Die Genauigkeit der gelände-basierten Navigation wird auf ca. 70 cm (Standardabweichung 25 cm) geschätzt, verbessert sich jedoch bei mehr homologen Ebenen. Der Einfluss von verschiedenen Parametern (Flughöhe, Fluggeschwindigkeit, Anzahl und Orientierung detektierbarer Flächen) auf die Genauigkeit wird diskutiert. Die Arbeit betont den Vorteil von Multi-Aspekt Daten und einer vollständigen Erfassung des urbanen Gebiets für die Verbesserung der Kalibrierung und der Änderungserkennung. Die Verwendung von Voxelgittern (VP und VR) zur schnellen Überprüfung von Informationsüberschneidungen wird als effizientes Verfahren zur schritthaltenden Änderungserkennung hervorgehoben.
