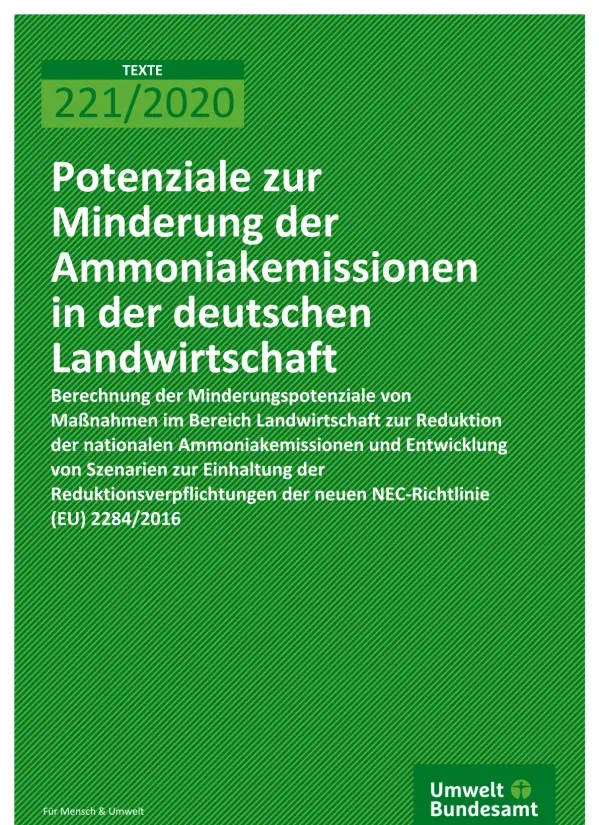
Ammoniak-Emissionen Landwirtschaft
Dokumentinformationen
| Autor | Uwe Häußermann |
| instructor/editor | Susanne Döhler |
| Schule | Justus-Liebig-Universität Gießen |
| subject/major | Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement |
| Dokumenttyp | Abschlussbericht |
| Ort | Dessau-Roßlau |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.79 MB |
Zusammenfassung
I.Ammoniakminderungsziele und die NEC Richtlinie
Der Bericht analysiert Maßnahmen zur Erreichung der deutschen Ammoniakminderungsziele gemäß der NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284. Die Richtlinie setzt prozentuale Reduktionsziele für Luftschadstoffe, darunter Ammoniak (NH3), für die Jahre 2020 (5% Reduktion gegenüber 2005) und 2030 (29% Reduktion gegenüber 2005). Die Landwirtschaft trägt mit 95% zu den nationalen Ammoniakemissionen bei (629 kt NH3 im Jahr 2016). Der Bericht bewertet verschiedene Szenarien und Maßnahmen zur Einhaltung dieser Ziele.
1. Nationale Ammoniakemissionsziele und die NEC Richtlinie
Deutschland hat sich im Rahmen der neuen NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284 verpflichtet, die nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe bis 2020 und 2030 um festgelegte Prozentsätze zu senken. Die Richtlinie ersetzt das Höchstmengenziel der alten NEC-Richtlinie 2001/81/EG durch prozentuale Reduktionsziele ab 2020 und 2030, bezogen auf die Emissionsmengen des Referenzjahres 2005. Für Ammoniak (NH3) sieht die NEC-Richtlinie Minderungsziele von 5% ab 2020 und 29% ab 2030 vor, was nach der Emissions-Berichterstattung 2018 Höchstmengen von 594 kt NH3 im Jahr 2020 und 444 kt NH3 im Jahr 2030 entspricht. Die Reduktionsverpflichtungen für Ammoniak sind für die Landwirtschaft von herausragender Bedeutung, da 95% der nationalen Ammoniakemissionen (629 kt NH3 im Jahr 2016) aus diesem Sektor stammen (UBA 2019). Neben Ammoniak regelt die neue NEC-Richtlinie weitere, teilweise für die Landwirtschaft relevante Stoffe, die im Bericht ebenfalls berücksichtigt werden. Der Bericht beschreibt die Annahmen, Hintergründe und Auswirkungen von Maßnahmen und Szenarien im nationalen Luftreinhalteprogramm (BMU, 2019) auf die Emissionsmengen der gemäß NEC-Richtlinie relevanten Luftschadstoffe, inklusive Szenarien, die im nationalen Programm nicht oder anders berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf den Minderungszielen für Ammoniak, die Auswirkungen auf weitere Luftschadstoffe (NMVOC, TSP, PM10, PM2.5), Lachgasemissionen (N2O) und die Netto-N-Zufuhr in den Boden werden ebenfalls dargestellt. Für die Jahre 2021 bis 2029 wird eine schrittweise lineare Absenkung der Ammoniakemissionen empfohlen, auch wenn dies in der NEC-Richtlinie nicht rechtlich verbindlich gefordert ist. Abweichungen von diesem linearen Reduktionspfad müssen gegenüber der EU-Kommission begründet werden.
2. Das Thünen Baseline Szenario und NEC Compliance Szenarien
Der Bericht verwendet das "Thünen-Baseline-Szenario", um die Emissionen basierend auf der aktuellen Entwicklung in der Landwirtschaft und bereits bestehenden Maßnahmen in Klima- und Luftreinhaltepolitik (Stand 2017) für 2020, 2025 und 2030 zu projizieren. Dieses Basisszenario dient als Vergleichsmaßstab für die Bewertung der Minderungswirkung weiterer Szenarien. Zusätzlich werden fünf NEC-Compliance-Szenarien (NECC1 bis NECC4 und NECC4+TA Luft 50) entwickelt und berechnet, um die NH3-Minderungsziele ab 2030 zu erreichen. Ein weiteres Szenario bündelt die Maßnahmen des TA Luft-Entwurfs (Stand 16. Juli 2018) unter Annahme einer 50%igen Umsetzung. Die im Thünen-Baseline-Szenario projizierten Emissionen für 2020, 2025 und 2030, sowie die Emissionen des Referenzjahres 2005 der NEC-Richtlinie, bilden den Bezugspunkt für die Bewertung der Minderungs-wirkung von Maßnahmen und Szenarien. Die Maßnahmen des Basisszenarios reichen aus, um das NH3-Minderungssziel für 2020 zu erreichen. Für die Folgejahre sind zusätzliche Maßnahmen oder Maßnahmenbündel erforderlich, um die NH3-Minderungssziele zu erfüllen. Die Reduktionsverpflichtung von 5% bis 2020 resultiert in einer relativ geringen absoluten Minderungsverpflichtung von 31 kt NH3 gegenüber 2005, die durch das Basisszenario gedeckt wird. Deutlich höhere Reduktionsverpflichtungen ergeben sich für 2025 (113 kt NH3) und 2030 (181 kt NH3), wobei eine schrittweise lineare Reduktion von 2021 bis 2029 angenommen wird. Diese höheren Verpflichtungen erfordern zusätzliche Maßnahmen, die über das Basisszenario hinausgehen und weitere Minderungen von 62 kt NH3 in 2025 und 126 kt NH3 in 2030 erzielen müssen.
II.Maßnahmen zur Ammoniakemissionsminderung in der Landwirtschaft
Der Bericht präsentiert 40 Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft, die sich auf verschiedene Stufen der Wirtschaftsdünger(Gülle, Festmist)-Ausbringung, -Lagerung und den Einsatz von synthetischen N-Düngern beziehen. Einzelne Maßnahmen erreichen maximal eine Reduktion von -13% gegenüber 2005. Fünf NEC-Compliance-Szenarien (NECC1-NECC4 und NECC4+TA Luft 50) werden modelliert, um die NH3-Minderungssziele ab 2030 zu erreichen. Weitere Szenarien berücksichtigen den Entwurf der TA Luft und ein Basisszenario (Thünen-Baseline-Szenario). Wichtige Maßnahmen umfassen emissionsmindernde Ausbringtechnik (Schleppschlauch, Schleppschuh, Schlitzverfahren), Güllekühlung, Urease-Inhibitoren im Düngemitteleinsatz und N-reduzierte Fütterung.
1. Überblick über Maßnahmen zur Ammoniakemissionsminderung
Der Bericht beschreibt 40 Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniakemissionen (NH3) in der Landwirtschaft. Diese Maßnahmen betreffen alle Stufen der landwirtschaftlichen Produktion, von der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist) bis zur Anwendung synthetischer N-Dünger. Die maximale Minderungswirkung einzelner Maßnahmen liegt bei etwa -13% im Vergleich zum Jahr 2005. Eine einzelne Maßnahme reicht jedoch nicht aus, um die Minderungsziele für 2030 zu erreichen. Deshalb werden im Bericht fünf verschiedene Maßnahmenbündel, sogenannte NEC-Compliance-Szenarien, entwickelt und berechnet, die das Erreichen der Ziele ab 2030 ermöglichen sollen. Zusätzlich wird ein Basisszenario (Thünen-Baseline-Szenario) berechnet, welches die Emissionen unter Annahme der aktuellen Entwicklung und bereits beschlossener Maßnahmen in der Klima- und Luftreinhaltepolitik bis 2030 fortführt. Dieses dient als Grundlage zum Vergleich der Minderungswirkung der anderen Szenarien. Ein weiteres Szenario beinhaltet die Maßnahmen des Entwurfs der TA Luft. Während die Maßnahmen des Basisszenarios ausreichen, um das Minderungssziel für 2020 zu erreichen, sind für die Jahre danach zusätzliche Maßnahmen und Maßnahmenbündel notwendig.
2. Emissionsmindernde Ausbringtechniken für Wirtschaftsdünger
Ein Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf der emissionsmindernden Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Der Bericht erwähnt verschiedene Techniken, darunter die Anwendung mit Schleppschlauch, Schleppschuh und Schlitzverfahren. Diese Verfahren zeigen im Vergleich zur Ausbringung mit Breitverteiler eine deutlich höhere Emissionsminderung. Auf Dauergrünland mindert die Ausbringung mit Schleppschuh die Emissionen um 65%, mit Schlitzverfahren um ca. 80%. Auch Regen und die Verdünnung der Gülle fördern die schnelle Infiltration in den Boden und reduzieren den Luftaustausch, die Emissionsminderung ist jedoch geringer als bei Schleppschuh und Schlitzverfahren. Bei Schlitzverfahren ist eine tiefere Einarbeitung zwar effektiver in Bezug auf die Emissionsminderung, erhöht aber die Gefahr von Narben-schäden auf Dauergrünland. Auch die Maßnahmen zur Lagerung von Festmist werden adressiert, wobei Kompaktierung (61% Reduktion), Lagerung ohne Wenden und Einhausung (77% Reduktion) zu signifikanten Minderungen führen. Diese Verfahren können jedoch zu erhöhten Methanemissionen führen, wobei die Auswirkungen auf Lachgasemissionen inkonsistent und nicht signifikant sind.
3. Systemintegrierte Maßnahmen und Maßnahmen im Stall
Der Bericht behandelt systemintegrierte Maßnahmen, die die Emissionen entlang der gesamten Prozesskette reduzieren. Die Ansäuerung der Gülle im Stall mindert die NH3-Emissionen erheblich und zeigt eine höhere tierplatzbezogene Minderungswirkung als die Ansäuerung erst bei der Ausbringung. Allerdings ist die Ansäuerung im Stall aufgrund technischer Anforderungen und Investitionskosten für kleinere Betriebe weniger geeignet. Ein Abbau des Viehbestands um 5% oder 10% linear über alle Tierkategorien reduziert die NH3-Emissionen um 4% bzw. 8%. Der Abbau der Viehbestände lässt jedoch die Emissionen aus der Anwendung von Mineraldünger (ca. 20% der gesamten landwirtschaftlichen NH3-Emissionen) unverändert. Weitere Maßnahmen im Stall umfassen die Güllekühlung, welche die Ammoniakemissionen um etwa 10% pro 10 W/m² Kühlleistung reduziert. Das Potenzial ist in Ställen mit Vollspaltenböden aufgrund des Tierwohls begrenzt, in Ställen mit Teilspaltenböden sind höhere Minderungen möglich. Die Güllekühlung reduziert auch die Methanemissionen, hat aber keine Auswirkungen auf Lachgasemissionen. Der Einsatz von Urease-Inhibitoren (UI) in Kombination mit Harnstoff wird diskutiert. Die Wirkung hängt von Bodeneigenschaften ab. Auch die Abluftreinigung in geschlossenen Ställen, vorwiegend in der Schweine- und Geflügelhaltung, wird als Maßnahme zur Minderung von Ammoniak, Staub und Geruchsstoffen betrachtet.
III.Modellierung und Methodik der Emissionsberechnung
Zur Berechnung der Ammoniakemissionen und der Wirkung der Maßnahmen wurden Berechnungsinstrumente entwickelt, basierend auf Daten der Agrarstrukturerhebung 2016 und der Landwirtschaftszählung 2010. Die Daten wurden vom Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (FDZ) bezogen. Die Modellierung berücksichtigt den Stickstofffluss entlang der gesamten Prozesskette, von der Tierhaltung bis zur Wirtschaftsdüngerausbringung. Das Jahr 2005 dient als Referenzjahr für die Emissionsberichterstattung und die Zielerreichung. Die Emissionsfaktoren wurden teilweise neu abgeleitet, insbesondere für systemintegrierte Maßnahmen. Die berechneten nationalen Summen der Zielgrößen weichen um weniger als ±3% von den Werten der Emissionsberichterstattung (RMD) ab. Die Modellierung umfasst auch die Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen einzelnen Maßnahmen und deren ökonomischen und ökologischen Auswirkungen.
1. Datengrundlage und Berechnungsinstrumente
Für die Berechnungen im Bericht wurden auf Basis der Arbeit von Haenel et al. (2018) spezielle Berechnungsinstrumente entwickelt. Diese ermöglichen eine detaillierte Darstellung des Stickstoffflusses in der landwirtschaftlichen Prozesskette, die damit verbundenen Emissionen umweltrelevanter Stickstoffverbindungen und die Veränderungen des Stickstoffpools in den einzelnen Prozessabschnitten. Die Entwicklung der Emissionen von 1990 bis 2016 wird dargestellt. Gemäß der NEC-Richtlinie (EU-RL 2016/2284) dient das Jahr 2005 als Bezugswert für die Minderungsziele in 2020, 2025 und 2030. Die Maßnahmen und Szenarien werden anhand ihres Beitrags zur Zielerreichung der NEC-Richtlinie eingeordnet. Das Jahr 2016 dient als Ausgangsjahr für die Häufigkeitsverteilung der maßnahmenrelevanten Verfahren und die Entwicklung der Aktivitäts- und Leistungsdaten in den Folgejahren. Die Datengrundlage für den Vergleich der Maßnahmen und Szenarien basiert auf Daten der Agrarstrukturerhebung 2016 (Tierbestände, Wirtschaftsdüngerausbringverfahren), ergänzt durch Daten zur Häufigkeitsverteilung der Stallhaltungsverfahren, Wirtschaftsdüngerlagerverfahren und Weidezeiten aus der Landwirtschaftszählung 2010. Veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes und des Report zu Methoden und Daten (RMD) für die Berichterstattung 2018 (Haenel et al. 2018) wurden verwendet. Zusätzliche, unveröffentlichte Daten wurden über das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (FDZ) bezogen. Die Daten für 2025 und 2030 wurden durch Interpolation und Extrapolation auf Basis der Daten von 2016, sowie Projektionen für 2020 und 2027, gewonnen. Dabei wurden meist Polynomfunktionen 2. Grades verwendet. Für die meisten anderen Eingangsdaten (z.B. Häufigkeitsverteilung von Verfahren) wird von einer Unveränderlichkeit gegenüber 2016 bis 2027 ausgegangen, lediglich für einige Tierkategorien wird eine Leistungssteigerung angenommen.
2. Berechnung der Wirkung von Maßnahmen und Szenarien
Die Wirkung der Maßnahmen und Szenarien wurde berechnet, indem die Häufigkeitsverteilung der Verfahren und/oder die Emissionsfaktoren bzw. Aktivitätsdaten (z.B. tierplatzspezifische N-Ausscheidungen, Tierbestände) gemäß der Maßnahmenbeschreibung angepasst wurden. Das Ergebnis, das relative Minderungspotenzial, wird immer auf die gesamte NH3-Emission der Quellgruppe Landwirtschaft bezogen, auch wenn Maßnahmen nur in einem Teil der Betriebe umgesetzt werden. Ziel der Berechnungen ist eine Abweichung der nationalen Summen der Zielgrößen von weniger als ±3% zu den Werten der Emissionsberichterstattung (RMD). Höhere Abweichungen auf Ebene der Unterkategorien sind möglich, da bestimmte Datensätze nur auf nationaler Ebene und ganzzahlig gerundet veröffentlicht werden, intern aber detaillierter vorliegen. Die Berechnungen basieren auf den national veröffentlichten, gerundeten Werten. Bei der Bewertung von Maßnahmen müssen die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen im Gesamtkontext und die gesamte Verfahrenskette betrachtet werden. Die isolierte Betrachtung einzelner Maßnahmen kann zu falschen Beurteilungen führen. Die Berechnungen berücksichtigen daher immer die gesamte Verfahrenskette (von tierischen Ausscheidungen bis zur Wirtschaftsdüngerausbringung) und neben der Wirkung auf Ammoniak auch weitere umweltrelevante Parameter. Interaktionen und ökonomische sowie ökologische Auswirkungen werden in den Kapiteln zu den einzelnen Maßnahmen beschrieben.
3. Datenquellen und Datenqualität
Die Datengrundlage für die Berechnungen stammt aus verschiedenen Quellen, darunter die Agrarstrukturerhebung 2016 (Tierbestände und Wirtschaftsdüngerausbringverfahren), die Landwirtschaftszählung 2010 (Stallhaltungsverfahren, Wirtschaftsdüngerlagerverfahren, Weidezeiten) und unveröffentlichte Datensätze, die über das Forschungsdatenzentrum (FDZ) abgefragt wurden. Die jüngsten verfügbaren Daten zur IST-Situation stammen aus dem Jahr 2016 und wurden in Haenel et al. (2018) veröffentlicht. Auf dieser Basis wurden die Daten für 2020, 2025 und 2030 interpoliert bzw. extrapoliert, meist mittels Polynomfunktionen 2. Grades. In der Projektion für 2020 und 2027 werden die meisten Daten (Häufigkeitsverteilung der Verfahren, Tierleistung) als unverändert gegenüber 2016 angenommen. Ausnahmen bilden Milchkühe, Sauen, Mastschweine, Masthähnchen und Puten, für die eine Leistungssteigerung angenommen wird, die sich auf die tierplatzbezogenen Ausscheidungen von Stickstoff auswirkt. Diese Annahme basiert auf den in der Emissionsdatenbank hinterlegten Emissionsfaktoren (IEF) für NH3. Das FDZ ermöglichte anwenderspezifische Abfragen in Mikrodaten verschiedener Erhebungen. Die Ergebnisse der Abfragen wurden auf Geheimhaltungsfälle geprüft und gegebenenfalls geschätzt. Das Ziel der Berechnungen ist eine Abweichung von weniger als ±3% zu den Werten der Emissionsberichterstattung (RMD), wobei auf Ebene der Unterkategorien höhere Abweichungen möglich sind.
IV.Ergebnisse und Kosten der Ammoniakminderung
Die Ergebnisse zeigen, dass die Ammoniakminderungsziele der NEC-Richtlinie prinzipiell mit bestehenden technischen Verfahren erreichbar sind. Für die Jahre nach 2020 sind jedoch zusätzliche Maßnahmen notwendig. Die Szenarien zeigen verschiedene Maßnahmenkombinationen auf, um die Ziele zu erreichen, ohne auf kostspielige Technologien wie den umfassenden Ausbau der Abluftreinigung oder drastische Reduktionen des Viehbestands zurückgreifen zu müssen. Die Minderungskosten werden anhand verschiedener Studien (Döhler et al. 2011, Reis et al. 2015, Döhler et al. 2019a) analysiert, wobei auch Einsparungen und die Erhöhung des Düngerwerts durch Emissionsminderung berücksichtigt werden.
1. Ergebnisse der Ammoniakemissionsminderung
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Ammoniakminderungsziele der NEC-Richtlinie grundsätzlich mit derzeit verfügbaren technischen Verfahren erreichbar sind. Das Thünen-Baseline-Szenario, welches die Emissionen unter Annahme der aktuellen politischen Entwicklung projiziert, zeigt, dass die Maßnahmen dieses Szenarios ausreichen, um das Ammoniak-Minderungziel für 2020 zu erreichen. Für die Jahre 2025 und 2030 sind jedoch zusätzliche Maßnahmen notwendig. Die Studie präsentiert fünf verschiedene NEC-Compliance-Szenarien (NECC1 bis NECC4 und NECC4+TA Luft 50), die alternative Maßnahmenkombinationen aufzeigen, mit denen die Minderungsziele für 2020, 2025 und 2030 erreicht werden können. Diese Szenarien zeigen, dass die Ziele auch ohne kostenintensive Maßnahmen wie den Ausbau der Abluftreinigung oder weitreichende Einschnitte in den landwirtschaftlichen Sektor (z.B. Viehbestandsreduktion) erreicht werden können. Die Szenarien bauen auf den mit der Düngeverordnung (DüV) 2017 eingeführten Maßnahmen auf und integrieren in unterschiedlichem Umfang Maßnahmen wie die Ansäuerung von Wirtschaftsdüngern und die zeitnahe Ausbringung mit kurzen Einarbeitungszeiten. Einzelne Szenarien beinhalten Maßnahmen zur Wirtschaftsdüngerlagerung und, durch die Umsetzung des TA Luft-Entwurfs, Maßnahmen im Stallbereich und in der Fütterung. Die Studie quantifiziert die Minderungswirkung der Maßnahmen und Szenarien, ohne explizit Unsicherheiten (Spannbreiten oder Konfidenzintervalle) zu ermitteln. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Unsicherheiten je nach Maßnahme und Eingangsdaten erheblich sein können, insbesondere bei Projektionen für die Zukunft, die auf Daten aus dem Jahr 2016 basieren.
2. Kosten der Ammoniakminderung
Zur Abschätzung der Kosten der Ammoniakminderung werden verschiedene Studien herangezogen: Döhler et al. (2011, UBA-Texte Reihe 79/2011), Reis et al. (2015) und Zwischenergebnisse des UBA-Vorhabens StraNuP (FKZ 3717 53 258 0, Döhler et al. 2019a). Die Methodik zur Ermittlung der Ammoniakminderungskosten wurde im Rahmen des UBA-Vorhabens 2011 aktualisiert. Die Minderungskosten werden als Verhältnis der Mehrkosten für die Minderungsmaßnahme zur Minderemission im Vergleich zu einem Referenzsystem berechnet. Dabei werden Einsparungen und die Erhöhung des Düngerwerts durch die Emissionsminderung berücksichtigt. Die Arbeit von Reis et al. (2015) ist umfassender, deckt jedoch nicht alle Tierkategorien ab und weist methodische Inkonsistenzen auf. Beispielsweise wird in der Studie von Döhler et al. (2011) für ein Schweinemastverfahren gezeigt, dass moderate Emissionsminderungen (38-41%) durch Maßnahmen wie Lagerabdeckung mit Stroh und emissionsarme Ausbringung geringe Minderungskosten (0,64-0,88 €/kg NH3-N) nach sich ziehen. Sehr hohe Emissionsminderungen (84%) durch eine Kombination aus Abluftreinigung, Lagerabdeckung und sofortiger Einarbeitung verursachen hingegen höhere Kosten. Die Reduktion von N-Überschüssen durch reduzierte Mineraldüngerzufuhr (Maßnahme MD2a) wird ebenfalls betrachtet. Der durchschnittliche Flächenbilanzüberschuss in Deutschland (77 kg N/ha LF) bietet Spielraum für Reduktion. Die Maßnahme MD2a sieht eine Verminderung der Mineraldüngung um 20 kg N/ha LF vor, was im Szenario NECC4 zu einer vergleichsweise geringen Ammoniakemissionsminderung führt.
V.Fazit und Ausblick
Der Bericht bestätigt die prinzipielle Umsetzbarkeit der Ammoniakminderungsziele der NEC-Richtlinie. Eine Fortschreibung der aktuellen Politik reicht jedoch nicht aus; zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich. Die Ziele für 2025 und 2030 können mit verschiedenen Maßnahmenkombinationen (Szenarien NECC1-NECC4 und NECC4+TA Luft 50) erreicht werden, ohne auf extrem aufwendige oder wirtschaftlich gravierende Maßnahmen zurückgreifen zu müssen. Die Berücksichtigung von Unsicherheiten in den Eingangsdaten und die Auswirkungen der Düngeverordnung (2017) auf die zukünftige Entwicklung der Ausbringverfahren werden als wichtige Punkte für zukünftige Untersuchungen hervorgehoben.
1. Zusammenfassende Ergebnisse zur Ammoniakminderung
Die Studie zeigt, dass die Ammoniakminderungsziele der NEC-Richtlinie prinzipiell mit den aktuell verfügbaren technischen Verfahren erreichbar sind. Die Fortschreibung der gegenwärtigen Politik reicht jedoch nicht aus, um die Minderungsziele für die Jahre nach 2020 zu erreichen; zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich. Die Ergebnisse belegen, dass die Ziele für 2025 und 2030 ohne kostenintensive Maßnahmen wie den weiteren Ausbau der Abluftreinigung und ohne weitreichende Einschnitte in den landwirtschaftlichen Sektor, z.B. einen erheblichen Abbau des Viehbestands, erreicht werden können. Die Szenarien NECC1 bis NECC4 und NECC4+TA Luft 50 zeigen verschiedene alternative Maßnahmenkombinationen auf, mit denen die Ammoniak-Minderungssziele für 2020, 2025 und 2030 vollständig oder weitestgehend realisiert werden können. Diese Szenarien bauen auf den mit der Düngeverordnung (DüV) 2017 eingeführten Maßnahmen auf und setzen in unterschiedlichem Maße auf die Ansäuerung von Wirtschaftsdüngern zur Ausbringung. Der Anteil zeitnah ausgebrachter Wirtschaftsdünger (Einarbeitungszeit unter einer Stunde) wird in den Szenarien deutlich erhöht. Einige Szenarien beinhalten zudem Maßnahmen zur Wirtschaftsdüngerlagerung und, durch die Berücksichtigung des TA Luft-Entwurfs, Maßnahmen im Stall und in der Fütterung. Die Quantifizierung der Minderungswirkung erfolgte ohne explizite Angabe von Unsicherheiten (Spannbreiten oder Konfidenzintervalle). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Unsicherheiten, je nach Maßnahme und Eingangsdaten, erheblich sein können.
2. Ausblick und Forschungsbedarf
Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen über die Fortschreibung der gegenwärtigen Politik hinaus, um die Ammoniakminderungsziele der NEC-Richtlinie für die Jahre nach 2020 zu erreichen. Die dargestellten Szenarien demonstrieren, dass eine Zielerreichung ohne kostenintensive oder sektoral gravierende Maßnahmen möglich ist. Es wird jedoch betont, dass die in der Studie ermittelten Ergebnisse keine Unsicherheiten (Spannbreiten oder Konfidenzintervalle) enthalten. Diese können jedoch je nach Maßnahme und den zugrundeliegenden Eingangsdaten erheblich sein. Die Unsicherheit betrifft besonders die Eingangsdaten für die Projektionen 2020, 2025 und 2030, die aus den Daten von 2016 abgeleitet wurden, ohne eine Anpassung an die Situation in den Zieljahren vorzunehmen. Es ist zu erwarten, dass sich die Situation bis 2030 deutlich von der in 2016 unterscheidet, insbesondere hinsichtlich der Bestimmungen zu den Ausbringverfahren, die sich durch die Novellierung der Düngeverordnung 2017 geändert haben. Die zukünftige Entwicklung der Häufigkeitsverteilungen in den Verfahren der Stallhaltung, Wirtschaftsdüngerlagerung und -ausbringung lässt sich daher nicht zuverlässig prognostizieren. Weitere Forschung ist daher notwendig, um die Unsicherheiten in den Eingangsdaten zu reduzieren und die Auswirkungen der Düngeverordnung 2017 auf die zukünftige Entwicklung der Ausbringverfahren genauer zu erfassen.
