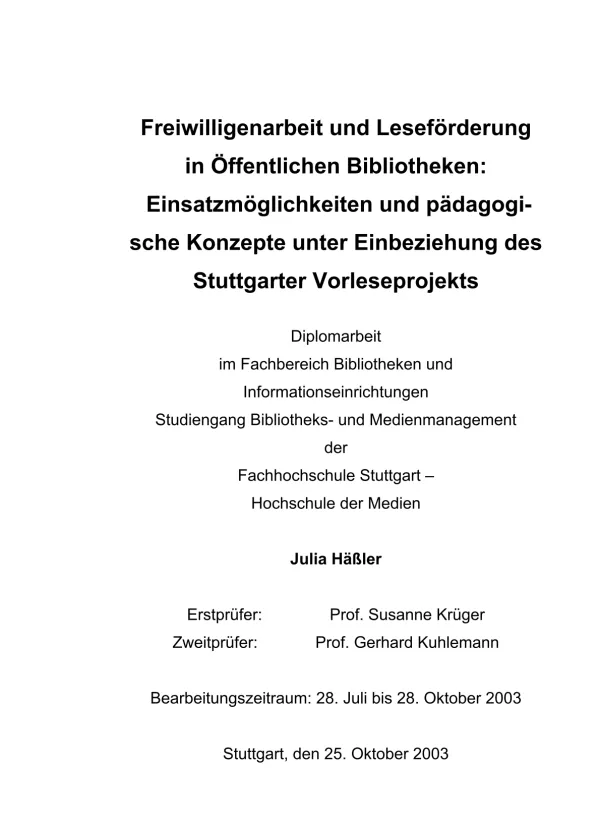
Leseförderung: Freiwillige in Bibliotheken
Dokumentinformationen
| Autor | Julia Häßler |
| instructor/editor | Prof. Susanne Krüger |
| school/university | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| subject/major | Bibliotheks- und Medienmanagement |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| city_where_the_document_was_published | Stuttgart |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.10 MB |
Zusammenfassung
I.Das neue Ehrenamt und Freiwilligenarbeit in Deutschland
Der Text untersucht die Entwicklung des Ehrenamts in Deutschland, wobei die Unterscheidung zwischen dem "alten Ehrenamt" mit traditionellen Strukturen und dem "neuen Ehrenamt" mit stärkerer Fokussierung auf Eigeninteressen und Selbstverwirklichung im Vordergrund steht. Der Begriff Freiwilligenarbeit wird als weitgehend deckungsgleich mit dem "neuen Ehrenamt" angesehen und mit dem angloamerikanischen "volunteering" verglichen. Weitere verwandte Begriffe wie Bürgerarbeit und Selbsthilfe werden ebenfalls diskutiert, wobei die Grenzen zwischen diesen Begriffen fließend sind. Der Deutscher Bibliotheksverband (DBV) setzt sich in seinem Positionspapier mit dem Einsatz von Freiwilligen in Bibliotheken auseinander, wobei die Haftungsfrage und der arbeitsrechtliche Status von Freiwilligen wichtige Aspekte darstellen. Die Gemeindefinanzierung und die damit verbundenen Sparmaßnahmen stellen eine große Herausforderung für das Engagement dar, da die Gefahr der Instrumentalisierung von bürgerschaftlichem Engagement besteht.
1. Entwicklung des Ehrenamts Alt und Neu
Der Text unterscheidet zwischen dem traditionellen "alten Ehrenamt", charakterisiert durch formale Strukturen und Orientierung an öffentlichen Ämtern, und dem sich entwickelnden "neuen Ehrenamt". Dieses zeichnet sich durch eine stärkere Fokussierung auf persönliche Interessen, Bedürfnisse und Selbstverwirklichung aus. Bernd Wagner und Thomas Strittmatter werden zitiert, um diese Entwicklung zu beschreiben. Strittmatter betont die weniger festgelegten Strukturen des neuen Ehrenamts, in dem Freiwillige selbständig über Art und Dauer ihres Engagements entscheiden. Die Kritik von Christina Stecker an der impliziten Annahme, nur das "neue Ehrenamt" sei wirklich freiwillig, wird ebenfalls erwähnt. Die Abgrenzung zu Erwerbsarbeit wird als problematisch dargestellt.
2. Verwandte Begriffe und ihre Unschärfe
Neben Ehrenamt und neuerem Ehrenamt werden verwandte Begriffe wie "Freiwilligenarbeit", "Eigenarbeit", "Selbsthilfe" und "Bürgerarbeit" diskutiert. Der Text betont die fließenden Übergänge und die teilweise überlappenden Bedeutungen dieser Begriffe. Ein Versuch der Einordnung erfolgt mit den Schwerpunkten: traditionell-formale Strukturen beim Ehrenamt, das Zusammenspiel von altruistischen und egoistischen Motiven bei der Freiwilligenarbeit und gesellschaftliche Verantwortung beim bürgerschaftlichen Engagement. Diese Einordnung soll aber die fließenden Übergänge nicht verbergen.
3. Der DBV und Freiwilligenarbeit in Bibliotheken
Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) verwendet in seinem Positionspapier "Freiwillige – (k)eine Chance für Bibliotheken?" die Begriffe Freiwillige und Freiwilligenarbeit. Der DBV orientiert sich dabei an dem angloamerikanischen Modell des "volunteering", das im Gegensatz zum deutschen Ehrenamt weniger arbeitsrechtliche Schwierigkeiten und keine Ansprüche auf Auslagenersatz aufwirft. Der DBV definiert Freiwilligenarbeit als freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement ohne Entgelt. Das Positionspapier des DBV schlägt jedoch auch anspruchsvollere Einsatzbereiche in Bibliotheken vor, die spezialisierte Kenntnisse erfordern, während andere Bereiche allgemeine kommunikative oder soziale Kompetenzen benötigen. Die Gefahr der Instrumentalisierung und des damit verbundenen Wettbewerbs mit hauptamtlichen Kräften wird angesprochen.
4. Finanzielle Herausforderungen und Kritik am DBV
Der Text thematisiert die finanzielle Situation der Kommunen in Baden-Württemberg, mit einem prognostizierten Defizit von zwei Milliarden Euro. Als Einsparmöglichkeit wird die Streichung freiwilliger Leistungen wie Bibliotheksangebote diskutiert. Der DBV wird für seine Positionierung kritisiert, insbesondere von Günter Pflaum, der das Positionspapier als berufs- und bibliothekspolitisches Eigentor bezeichnet. Pflaums Kritikpunkte umfassen die fehlende Abgrenzung von Einsatzbereichen der Freiwilligen, die Größenordnung der Einrichtungen und die Abgrenzung zu den Aufgaben von Fachkräften. Der Vorschlag des DBV, Trägervereine für Stadtteilbibliotheken zu schaffen, wird als Entzug der öffentlichen Verantwortung gesehen. Die Haftungsfrage und der Versicherungsschutz von Freiwilligen werden als weitere problematische Punkte genannt, besonders bei "verantwortlichen Betätigungen".
II.Leseförderung und die Rolle Öffentlicher Bibliotheken
Ein zentraler Punkt des Textes ist die Bedeutung von Leseförderung in öffentlichen Bibliotheken. Die Bibliotheken werden als wichtige dritte Säule neben Familie und Schule für die Entwicklung von Lesekompetenz gesehen, insbesondere im Kontext der PISA-Studie. Der Text beleuchtet den Zusammenhang zwischen Freizeitlesen und Leseleistungen und weist auf die Notwendigkeit hin, Kinder frühzeitig für das Lesen zu begeistern. Die PISA 2000 Studie zeigt einen hohen Anteil von Schülern, die nicht aus Freude lesen. Bibliotheken werden als entscheidender Ort gesehen, um die Kluft zwischen lesegeübten und lesefernen Kindern zu verringern. Die Entwicklung der Lesekultur wird historisch betrachtet, von der frühen Vorlesekultur bis zum heutigen multimedialen Umfeld. Die Rolle des Vorlesens und die Bedeutung von Vorlesepaten werden hervorgehoben.
1. Leseförderung als gesellschaftliche Notwendigkeit
Der Text betont die Bedeutung von Leseförderung als Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zur persönlichen Entwicklung. Das Lesen wird als Schlüsseltechnik zum Informationszugang dargestellt, dessen Fehlen zu beruflichen, sozialen und kulturellen Nachteilen führt. Die Lesekompetenz wird als essentiell für den Schulerfolg und die spätere soziale Position betrachtet, wodurch eine Chancenungleichheit entsteht, die in einer demokratischen Gesellschaft vermieden werden sollte. Öffentliche Bibliotheken werden als Orte gesehen, an denen diese Kluft verringert werden kann, da sie den Zugang zu Informationen und Wissen für alle ermöglichen. Die Freiheit der Information und Lebensorientierung wird als Anspruch der Bibliotheken genannt, welcher nur durch Leseförderung erfüllt werden kann.
2. Lesekompetenz und die PISA Studie
Die Studie PISA 2000 wird herangezogen, um die Bedeutung von Lesekompetenz zu unterstreichen. Die Studie vergleicht die Leseleistungen von 15-Jährigen in verschiedenen Ländern und definiert Lesekompetenz als aktive Auseinandersetzung mit Texten, unter Einbezug von Vorwissen. Die Ergebnisse zeigen einen engen Zusammenhang zwischen Freizeitlesen und Leseleistungen in Deutschland. Etwa 42% der deutschen Schüler lesen niemals zum Vergnügen, was als ein wichtiger Faktor für die vergleichsweise schlechten Leseleistungen gesehen wird. Die negative Einstellung zum Lesen und die fehlende Freude am Lesen werden als zentrale Probleme identifiziert. Die Bibliotheken werden in der anschließenden Diskussion auffällig wenig berücksichtigt, obwohl sie eine wichtige Rolle in der Leseförderung spielen könnten.
3. Die Rolle der Bibliotheken in der Lesesozialisation
Der Text positioniert Bibliotheken als dritte Bildungsinstitution neben Familie und Schule und betont ihr Potential für Lesesozialisation. Die "bibliothekarische Lesesozialisation" soll die familiäre und schulische Leseförderung ergänzen und bereichern, kann diese aber nicht ersetzen. Die Entwicklung des Lesens wird historisch betrachtet, vom lauten Vorlesen in der Vergangenheit bis zum stummen Lesen der Gegenwart. Das Vorlesen wird als lange Tradition beschrieben, die sowohl Sinnstiftung als auch soziale Interaktion beinhaltete. Die Entwicklung des Buchdrucks und die zunehmende Alphabetisierung führten zu einem Wandel im Leseverhalten. Der Text argumentiert, dass Bibliotheken eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Lesefreude und Lesekompetenz spielen, vor allem durch gezielte Leseförderung, und dass die Vermittlung von Medienkompetenz in der heutigen multimedialen Gesellschaft eine wichtige Aufgabe für Bibliotheken ist. Die Frage nach dem Einsatz von eventuell "minderwertigen" Lesestoffen zur Förderung des Lesens wird angedeutet.
III.Das Stuttgarter Vorleseprojekt Ein Beispiel für erfolgreiche Leseförderung
Der Text beschreibt das Stuttgarter Vorleseprojekt als Beispiel für eine erfolgreiche Initiative zur Leseförderung. Das Projekt kooperiert mit Schulen, Kindergärten (z.B. Vogelsangschule, Stöckachkindergarten), der Stadtbücherei Stuttgart, dem Literaturhaus Stuttgart und rekrutiert freiwillige Vorlesepaten. Es werden verschiedene Maßnahmen wie Lesepartys, Vorleseangebote, die Erstellung von Leselisten und die Vermittlung von Medienkompetenz eingesetzt. Die Auswertung des Projektes zeigt positive Ergebnisse, hebt aber auch Herausforderungen hervor, wie die Einbindung leseferner Familien und die Notwendigkeit weiterer Schulungen für Vorlesepaten. Die Zahl der beteiligten Kinder (ca. 140 in der Pilotphase) und die Anzahl der Freiwilligen (ca. 70 Bewerber, 54 ausgebildete Paten) sind wichtige Kennzahlen. Die Stiftung Lesen unterstützt das Projekt.
1. Projektbeschreibung und Ziele
Das Stuttgarter Vorleseprojekt, gestartet im Jahr 2002, zielt auf die Leseförderung von Kindern ab. Es kooperiert mit verschiedenen Institutionen, darunter die Stadtbücherei Stuttgart mit ihren 16 Kinderbüchereien und zwei mobilen Bücherbussen, sowie dem Literaturhaus Stuttgart. Das Projekt adressiert gezielt Kinder, die über das Elternhaus keinen Zugang zu Bibliotheken finden, wobei mehr als 70% der Aktionen an pädagogische Einrichtungen gerichtet sind. Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten wird als wichtig angesehen, um auch Kinder aus lesefernen Familien zu erreichen. Eine weitere wichtige Komponente ist die Rekrutierung und Schulung von freiwilligen Vorlesepaten, die in Stadtteilbibliotheken und Kindertagesstätten eingesetzt werden. Das Projekt will den Grundstein für eine Stuttgarter Vorlesekultur legen und bestehende Angebote vernetzen. Die Pilotphase konzentrierte sich auf die Vogelsangschule (ca. 80 Kinder) und den Stöckachkindergarten (ca. 60 Kinder) in Stuttgart.
2. Durchführung und Maßnahmen
Das Projekt setzt verschiedene Maßnahmen zur Leseförderung um. Es wurden Elternabende besucht, um das Projekt vorzustellen und Eltern für die Teilnahme an Aktionen zu gewinnen. Die positiven Rückmeldungen der Eltern zeigen eine hohe Sensibilität für das Thema Vorlesen. Konkrete Maßnahmen umfassen Lesepartys, die Bereitstellung von Vorleselieten zur Orientierung im Kinderbuchmarkt und die Entwicklung von ergänzenden Materialien wie Schmökerpäckchen und Bücherkisten. Vorleseangebote und Bilderbuchshows in Kindergärten werden beschrieben, die Vorschulkinder spielerisch an Bücher und Texte heranführen. Eine besondere Veranstaltung war eine Leseparty mit Lesezelten und einer Autorenlesung, die mit einem Buchgeschenk und dem "Bücherwurm" (ein Sammelalbum für gelesene Bücher) abgerundet wurde. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen wird hervorgehoben.
3. Auswertung und Ergebnisse
Die Auswertung des Projekts erfolgte durch Fragebögen bei den Familien (ca. 50% Rücklaufquote) und Interviews mit Pädagoginnen. Die Ergebnisse zeigen eine positive Resonanz auf die Angebote, besonders die Lesepartys. Zeitmangel und Terminschwierigkeiten wurden als Hauptgründe für die Nichtteilnahme genannt. Die Eltern schätzen besonders die Informationen über Bücher und Lesen, neue Eindrücke und phantasievolle Anregungen. Die Kinder zeigen große Begeisterung für die Lesepartys, den "Bücherwurm" und das Buchgeschenk. Die Lehrerinnen bestätigen, dass mehr Kinder als erwartet angesprochen wurden, die Einbindung leseferner Familien jedoch schwierig ist. Der persönliche Kontakt und die individuelle Betreuung, insbesondere für sprachunsichere Kinder, werden als wichtige Punkte für zukünftige Verbesserungen genannt. Die Notwendigkeit von Schulungen für die Vorlesepaten wird betont, um einen qualifizierten und engagierten Einsatz zu gewährleisten. Ca. 70 Personen meldeten sich nach einem Zeitungsaufruf, 54 absolvierten die Schulung.
4. Zusammenarbeit und zukünftige Entwicklung
Das Projekt betont die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen (Stadtbücherei, Literaturhaus, Schulen, Kindergärten) und die Einbindung von Freiwilligen (Vorlesepaten). Die Schulungen für die Vorlesepaten umfassen Themen wie Vorlesetechnik, Körperhaltung, Konfliktlösung, pädagogisches Grundwissen und Neuigkeiten auf dem Buchmarkt. Die Notwendigkeit weiterer Schulungen wird betont, ebenso wie die Bedeutung der Organisation und die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten. Der Aufbau von Beziehungen zwischen Patinnen, Institutionen und Kindern wird als wertvoll angesehen. Die Kontinuität des Engagements und der Austausch zwischen den Beteiligten werden als wichtig erachtet. Der Text deutet auf die begrenzten Ressourcen (Personal und Mittel) hin und skizziert Möglichkeiten zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Projekts, wie z.B. den Ausbau der Zusammenarbeit mit Unternehmen.
IV.Weitere Initiativen zur Leseförderung in Deutschland und Schlussfolgerungen
Der Text erwähnt weitere Initiativen zur Leseförderung in Deutschland, z.B. Deutschland liest vor (gefördert durch die Körber-Stiftung und angelehnt an das Berliner Modell von Lesewelt), und betont die Notwendigkeit von Vernetzung und nachhaltiger Förderung. Der Text schließt mit der Feststellung, dass das Thema Freiwilligenarbeit und Leseförderung komplex und vielschichtig ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Haftung von Freiwilligen weiter geklärt werden müssen und die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Freiwilligen optimiert werden muss. Die Notwendigkeit von weiteren Schulungen für Freiwillige wird erneut betont.
1. Weitere Leseförderinitiativen in Deutschland
Der Text nennt weitere Initiativen zur Leseförderung in Deutschland, um das Stuttgarter Vorleseprojekt einzuordnen und zu erweitern. Ein Beispiel ist das Projekt des Zentrums für Familien und Leseförderung (Zfl), welches Leseförderung in Familien anbietet, besonders für leseferne Familien in sozial schwachen Schichten und unter Migranten. Das Zfl nutzt dabei die Erkenntnisse der PISA-Studie, die die Bedeutung des elterlichen Leseverhaltens hervorhebt. Eine weitere genannte Initiative ist "Deutschland liest vor", eine Kampagne, die vom Berliner Verein Lesewelt inspiriert ist und von der Körber-Stiftung unterstützt wird. Carmen Stürzel, die 1999 mit ihrem Konzept "Read together" den Transatlantischen Ideenwettbewerb gewann, spielt eine zentrale Rolle bei Lesewelt und "Deutschland liest vor". Die Kampagne wird von Doris Schröder-Köpf unterstützt und arbeitet mit Kooperationspartnern wie dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels zusammen. Die Stiftung Lesen wird als weitere Organisation genannt, die frühkindliche Leseförderung mit Vorlesepaten fördert und auf die Etablierung von Vorlesenetzwerken abzielt; die Deutsche Bahn AG und Mitsubishi Motors Deutschland unterstützen dieses Projekt.
2. Vergleich und Potenziale des Stuttgarter Vorleseprojekts
Der Text vergleicht implizit das Stuttgarter Vorleseprojekt mit anderen Initiativen. Es wird angemerkt, dass das Stuttgarter Projekt im Vergleich zu einigen anderen Initiativen, z.B. dem Zfl, einen kleineren Umfang hat und den Fokus auf die frühe Leseförderung und Angebote im direkten Umfeld der Familien legt – ein Aspekt, der laut Autorin in Deutschland bisher einzigartig ist. Potentiale für zukünftige Entwicklungen werden aufgezeigt, unter anderem die intensivere Kooperation mit Unternehmen zur Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Autorin betont den hohen Wert der intensiven Betreuung der Beteiligten im Stuttgarter Projekt.
3. Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Schlussbemerkung fasst die Komplexität von Freiwilligenarbeit und Leseförderung zusammen. Es werden die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der verschiedenen Begriffsformen des bürgerschaftlichen Engagements, die Unklarheiten zum rechtlichen Status der Engagierten und die kontroversen Aspekte ihres Einsatzes hervorgehoben. Für Bibliotheken wird es als wichtig erachtet, diese Aspekte zu berücksichtigen, um eine konstruktive Diskussion über die Vor- und Nachteile von Freiwilligenarbeit in Bibliotheken zu fördern. Der Text verdeutlicht die Notwendigkeit einer klaren Definition von Verantwortlichkeiten und der Sicherung des Versicherungsschutzes für Freiwillige, insbesondere in Situationen mit Aufsichtspflicht. Die Notwendigkeit weiterer Schulungen und der kontinuierlichen Reflexion der Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen Mitarbeitern und Freiwilligen wird als zentraler Aspekt für zukünftige Leseförderprojekte betont.
