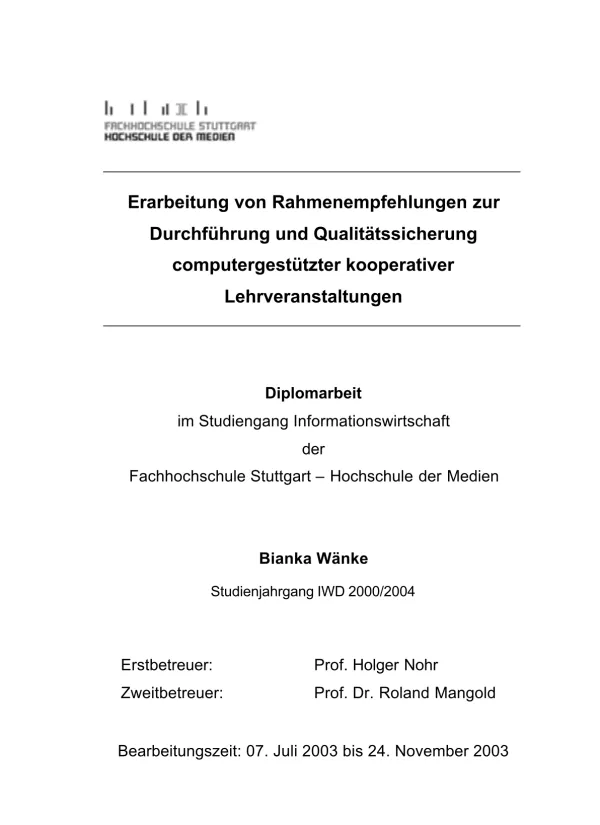
CSCL-Lehrveranstaltungen: Rahmenempfehlungen
Dokumentinformationen
| Autor | Bianka Wänke |
| instructor | Prof. Holger Nohr |
| Schule | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| Fachrichtung | Informationswirtschaft |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Veröffentlichungsjahr | 2004 |
| Ort | Stuttgart |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 643.53 KB |
Zusammenfassung
I.Computergestütztes Kooperatives Lernen CSCL in der Hochschulbildung
Dieser Text untersucht die Anwendung von computergestütztem kooperativem Lernen (CSCL) in der Hochschulbildung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung von online Lehr-/Lernkonzepten, die traditionelle Präsenzveranstaltungen mit virtuellen, selbstgesteuerten und kooperativen Lernphasen verbinden. Es werden verschiedene Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, sozial-kognitive Lerntheorie) betrachtet und ihre Relevanz für die Gestaltung effektiver CSCL-Veranstaltungen diskutiert. Besondere Herausforderungen sind die fehlende soziale Präsenz und die Koordination virtueller Gruppenaktivitäten.
1. Wandel der Arbeitswelt und Bedeutung von CSCL
Der Text beginnt mit der Feststellung, dass die Bedeutung räumlicher Präsenz bei der Zusammenarbeit abnimmt und virtuelle Arbeitskontexte immer wichtiger werden. Dies spiegelt sich auch im Bildungssektor wider, wo computergestützte Medien neue Lehrformen ermöglichen. Insbesondere an Hochschulen wird auf den Einsatz solcher Medien gesetzt, um neue Lehrmedien zu schaffen. Ein zentrales Konzept ist dabei das gruppenbasierte Lernen, welches flexible Zeiteinteilung und Ortswahl erlaubt. Studierende können in virtuellen Teams Aufgaben lösen und Wissen generieren. Im Gegensatz zu rein virtuellen Universitäten wird dieses Konzept durch Präsenzveranstaltungen und die Unterstützung eines Tutors ergänzt, der die virtuellen Gruppenaktivitäten begleitet und mit klassischen Vorlesungen kombiniert. Dieser Ansatz vereint die Vorteile des traditionellen Lernens mit den Möglichkeiten des computergestützten kooperativen Lernens (CSCL).
2. Herausforderungen und Chancen des CSCL
Die Entwicklung von computergestützten kooperativen Lehrveranstaltungen befindet sich noch im Forschungsstadium, wobei die praktische Umsetzung Herausforderungen mit sich bringt. Nicht alle Medien eignen sich für jede Lehrveranstaltung, und die traditionelle Lehrdidaktik lässt sich nicht einfach übertragen. Ein zentrales Problem stellt die fehlende soziale Präsenz im Online-Lernen dar, die zu einem Mangel an impliziten Hinweisreizen führt. Dies erschwert die Schaffung eines gemeinsamen Wissenshintergrunds und die Koordination der Lerngruppen durch den Tutor. Die Bewertung der Lernqualität ist ebenfalls schwierig, da viele Faktoren die Evaluation beeinflussen. Gleichzeitig werden neue Medien als 'hybride Medien' beschrieben, die auf Mikroprozessortechnik basieren und Interaktivität, Individualität, Asynchronität und Multifunktionalität aufweisen. Beispiele hierfür sind Internet, Multimedia-Computer, CDs und DVDs. Der steigende Bedarf an Bildung und Qualität sowie die wachsende Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologie in der Hochschulbildung treiben die Entwicklung von CSCL voran, ebenso wie der Bedarf an berufsbegleitenden Studienangeboten und Master-Studiengängen, die durch den Einsatz von Technologie erleichtert werden.
3. Lerntheoretische Grundlagen von CSCL
Der Text beleuchtet die relevanten Lerntheorien für CSCL. Der Behaviorismus, insbesondere die Theorien von Thorndike (instrumentelles Konditionieren, Versuch-Irrtum-Lernen) und Skinner (operantes Konditionieren), werden diskutiert. Die Bedeutung von Belohnungen im Gegensatz zu Bestrafungen wird hervorgehoben. Der Kognitivismus, mit den Arbeiten von Köhler (Einsichtlernen bei Menschenaffen) und Bruner (Theorie der Kategorisierung), zeigt die Bedeutung aktiver Wissensgenerierung und Informationsverarbeitung durch den Lernenden. Die sozial-kognitive Lerntheorie Banduras betont die Rolle der Beobachtung und Imitation von Modellen im Lernprozess. Diese Lerntheorien bilden die Grundlage für die Gestaltung von CSCL-Veranstaltungen, die den Lernenden aktiv an der Wissensgenerierung beteiligen und Problemlösungs- und Entscheidungskompetenzen fördern sollen. Die Integration kognitivistischer Gesichtspunkte in die Struktur von Lehrveranstaltungen wird empfohlen.
4. Kommunikation und Kooperation in virtuellen Lernumgebungen
Der Text beschreibt die veränderte Rolle der Kommunikation in computervermittelten Lehrveranstaltungen. Im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen fehlen in der virtuellen Gruppenarbeit oft nonverbale Hinweisreize, was zu einer 'Kanalreduktion' und dem 'Herausfiltern sozialer Hinweisreize' führt (Döring, 2000). Kommunikationswerkzeuge wie Diskussionsforen und E-Mail sind daher essentiell. Sie ermöglichen nicht nur Frage-Antwort-Prozesse, sondern auch Diskussionen und die Speicherung von Kommentaren, was eine permanente Wissensbasis schafft (Wessner/Pfister 2001). Kooperationswerkzeuge unterstützen die Aufgabenteilung und -koordination innerhalb der Lerngruppen. Diese können Gruppenarbeitsräume auf einer Lernplattform einrichten und Informationen über die Teilnehmer bereitstellen. Auch während Präsenzveranstaltungen können solche Tools eingesetzt werden, z.B. mit Sitzungsunterstützungssystemen.
II.Didaktische Gestaltung und Einsatz Neuer Medien im CSCL
Die didaktische Gestaltung von CSCL-Veranstaltungen erfordert eine sorgfältige Auswahl und Aufbereitung von Lerninhalten für sowohl Präsenz- als auch virtuelle Einheiten. Der Text betont die Bedeutung von authentischen und anwendungsbezogenen Lernmaterialien, die durch den Einsatz Neuer Medien (Internet, Multimedia, Simulationen) unterstützt werden können. Instruktionale Gestaltung und die Bereitstellung von Kooperationswerkzeugen sind entscheidend für den Lernerfolg. Die Medienkompetenz von Lehrenden und Lernenden spielt eine zentrale Rolle.
1. Die Bedeutung der Neuen Medien im CSCL
Ein wichtiger Aspekt der didaktischen Gestaltung von CSCL-Veranstaltungen ist die Einbindung neuer Medien. Klimsa (1993) definiert diese als hybride Medien, die auf Mikroprozessor-, Speicher- und/oder Übertragungstechnik basieren und Interaktivität, Individualität, Asynchronität und Multifunktionalität aufweisen. Sie ermöglichen eine individuelle und zeitunabhängige Interaktion zwischen Nutzer und System und präsentieren Informationen aus verschiedenen Perspektiven. Beispiele sind das Internet, Multimedia-Computer, CD-ROMs und DVDs. Die Integration von Computertechnologie und die zunehmende Anzahl neuer Medienstudiengänge zeigen das hohe Potenzial dieser Technologie in der Hochschulbildung. Berufsbegleitende Studienangebote gewinnen an Attraktivität und werden durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik leichter realisierbar, was Hochschulen die Möglichkeit bietet, ihr Bildungsangebot um berufliche Weiterbildung zu erweitern. Master-Studiengänge unterstützen den wachsenden Bedarf an Weiterbildung und lebenslangem Lernen.
2. Didaktische Gestaltungsfaktoren für effektives CSCL
Die didaktische Gestaltung im CSCL umfasst die Auswahl und Aufbereitung von Inhalten für Präsenz- und virtuelle Einheiten. Eine Herausforderung besteht darin, das Wissen so aufzubereiten, dass es in beiden Kontexten effektiv vermittelt werden kann (Keller, 2002). Reinmann-Rothmeier (2003) schlägt eine Aufteilung vor: 'Authentische und anwendungsbezogene Gestaltung' mit Fokus auf die Lösung realer Probleme und die Integration von Simulationen zur Veranschaulichung; 'Instruktionale Gestaltung' mit Anleitung und Unterstützung der Lernenden, insbesondere in der Anfangsphase, um sie bei selbstständigen und gemeinschaftlichen Aufgaben, unterschiedlichen Perspektiven und mediengestützten Anwendungen zu unterstützen. Ein enzyklopädisch orientierter Aufbau mit vollständigen Strukturen über die gesamte thematische Breite und innerhalb spezifischer Themenbereiche (Sprenger, 2001) wird empfohlen, wobei die Detailtiefe von den Zielen der Lehrveranstaltung abhängt. Die Ergänzung der traditionellen Lehre durch neue Medien fördert selbstgesteuertes und kooperatives Lernen (Dittler, 2002). Wissen wird als Produktionsfaktor betrachtet, der ständiger Aktualisierung bedarf aufgrund schneller technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, daher ist lebenslanges Lernen unerlässlich (Kretschmer, 2002).
III.Die Rolle des Tutors und die Bedeutung von Kommunikation
Im CSCL-Kontext verändert sich die Rolle des Tutors vom Wissensvermittler zum Moderator, Berater und Betreuer. Effektive Online-Kommunikation ist unerlässlich. Der Text betont die Wichtigkeit von Kommunikationswerkzeugen (Diskussionsforen, E-Mail) und die Notwendigkeit klarer Gruppenregeln zur Förderung der Zusammenarbeit. Der Tutor muss die Kommunikation steuern, unterstützen und Feedback geben. Eine ausführliche Einführung in das System und die verwendeten Medien ist wichtig.
1. Die veränderte Rolle des Tutors im CSCL
In computergestützten, kooperativen Lehrveranstaltungen (CSCL) wandelt sich die Rolle des Tutors grundlegend. Er fungiert nicht mehr primär als Wissensvermittler, sondern vielmehr als Begleiter und Betreuer der Lernprozesse (Diachanz/Ernst, 2002). Dichanz und Ernst beschreiben den Tutor als "Berater, der seine Hilfe anbietet, aber den Lernvorgang weitaus weniger lenkt als in herkömmlichen Lernumgebungen". Seine Aufgaben umfassen die Betreuung von Gruppen in Diskussionen, Chats oder Foren, wobei er die Nutzung dieser Kommunikationsmittel, besonders zu Beginn, aktiv fördern muss (Gallenstein, 2001). Der Tutor beobachtet den Kommunikationsablauf und unterstützt die Teilnehmer mit Ratschlägen und Hilfestellungen. Eine ausführliche Einführung in das Kurssystem mit seinen Medien und Inhalten ist unerlässlich, um Probleme bei der Bedienung der Technik zu vermeiden und Berührungsängste zu minimieren (Hasebrook/Otte, 2002; Sprenger, 2001). Der Tutor sollte die Lernenden umfassend über Umfang, Struktur, Gestaltung und Funktion der Medien informieren, damit diese individuell entscheiden können, welche Lerninhalte und -elemente für sie optimal sind (Gallenstein, 2001).
2. Anforderungen an den Tutor im CSCL
Die veränderte Rolle des Tutors im CSCL erfordert ein erweitertes Anforderungsprofil. Der Lehrende muss sich mit der Verschiebung seiner Aufgaben auseinandersetzen: Seine Rolle als Wissensvermittler tritt in den Hintergrund, während Fähigkeiten als Moderator, Berater und Betreuer wichtiger werden (Wissenschaftsrat, 1998). Medienkompetenz wird zu einem zentralen Bestandteil des Anforderungsprofils. Unzureichende Medienkenntnisse des Tutors können den Erfolg der gesamten Lehrveranstaltung gefährden. Neben der fachlichen Expertise muss der Tutor den Umgang mit den eingesetzten Medien beherrschen, individuelle Fragen der Lernenden beantworten (z.B. per E-Mail) und Kenntnisse in computergestützten Kommunikationsprozessen, Moderationstechniken und Konfliktbewältigung besitzen. Eine frühzeitige Qualifikation des Tutors ist daher unerlässlich.
3. Die Bedeutung von Kommunikation und Gruppenregeln
Effektive Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg von CSCL-Veranstaltungen. In virtuellen Gruppen fehlt oft die nonverbale Kommunikation, was zu Informationsverlusten führt. Döring (2000) beschreibt dies als "Kanalreduktion" und "Herausfiltern sozialer Hinweisreize". Der Einsatz von Kommunikationswerkzeugen ist daher essentiell; diese müssen neben Frage-Antwort-Prozessen auch Diskussionen und die Darstellung von Kommentaren ermöglichen. Die Speicherung der Austauschprozesse schafft eine permanente Wissensbasis (Wessner/Pfister, 2001). Neben den Kommunikationswerkzeugen sind klare Gruppenregeln wichtig. Sie bieten einen Bezugsrahmen für die Teilnehmer, beschreiben soziale Umgangsformen und fördern den Zusammenhalt (Pankoke-Babatz/Hoschka/Prinz, 2001). In virtuellen Gruppen, wo nonverbale Hinweisreize und unmittelbares Feedback fehlen, sind verbindliche Regeln unabdingbar (Reinmann-Rothmeier/Mandl, 2001). Die Regeln sollten Transparenz, Sicherheit und Unterstützung bieten und die Motivation, Kompromissbereitschaft und Disziplin fördern.
IV.Qualitätsmanagement und Evaluation im CSCL
Die Qualitätssicherung in CSCL-Veranstaltungen ist ein wichtiger Aspekt. Der Text diskutiert verschiedene Evaluationsmethoden zur Bewertung des Lernerfolgs, der Akzeptanz des Konzepts und der Effektivität der eingesetzten Medien. Die Definition von messbaren Qualitätskriterien ist herausfordernd, da sie stark von den individuellen Zielen der Veranstaltung abhängen. Eine systematische Evaluation in allen Phasen (vor, während und nach der Veranstaltung) wird empfohlen.
1. Der Qualitätsbegriff in der Hochschulbildung
Der Text beleuchtet den vielschichtigen Qualitätsbegriff in der Hochschulbildung. Anhand der DIN Norm (DIN EN ISO 8402) wird Qualität als "Beschaffenheit" definiert, die von den Bedürfnissen und dem Zweck des Objekts abhängt (Kotler/Bliemel, 2001). Diese Bedürfnisse sind dynamisch und individuell. Die zunehmende Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor und der Wettbewerb mit ausländischen Hochschulen verstärken das Qualitätsinteresse. Das ehemals blinde Vertrauen in die akademische Bildung ist geschwunden, und Hochschulen müssen ihre Leistungsfähigkeit nachweisen. Die schnelle Veralterung von IuK-Medien in Kurskonzepten erfordert eine individuelle Qualitätssicherung, die jedoch mit höheren Kosten und Aufwand verbunden ist. Die Definition allgemeingültiger, messbarer Qualitätskriterien ist aufgrund der individuellen Ausrichtung von Kurskonzepten schwierig (Münzer, 2003).
2. Evaluation als Methode der Qualitätssicherung
Ein ausführliches Evaluationsverfahren kann den Nutzen und Sinn eines Bildungsmediums nachweisen und dient der Kontrolle und Entscheidungsfindung. Eine Evaluation in allen Phasen (Planung, Durchführung, Abschluss) ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen im Lehrkonzept oder Lernprozess und die Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen. Evaluationen liefern Erkenntnisse über die Wirkung des Konzepts (z.B. Lernerfolg, Akzeptanz) und ermöglichen Vergleiche mit anderen Lehrformen (Janetzko, 2002). Die Evaluation bietet den Vorteil, dass vielfältige Daten für verschiedene Zwecke analysiert und eine Transparenz der Lehre erreicht werden kann. Sie ist ein Instrument zur Bewertung und Sicherung von Qualität und lässt sich flexibel an verschiedene Lernkonzepte anpassen. Allerdings sind die Bewertungskriterien oft ungenau definiert, was zu subjektiven Beurteilungen führen kann. Reinmann-Rothmeier empfiehlt daher, vor der Evaluation spezifische Kriterien zu definieren und den Kriterienkatalog durch individuelle Kriterien zu erweitern (Reinmann-Rothmeier/Mandl, 2001).
3. Evaluationsphasen und methoden
Der Text empfiehlt eine Evaluation während der Durchführung, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Eine summative Evaluation analysiert die Wirkung des Lernkonzepts (Akzeptanz, Lernerfolg, Wissenstransfer), Auswertung von Diskussionen und Feedbacks liefern weitere Daten. Eine Dokumentenanalyse der Aufgabenlösungen zeigt, ob die vorgesehenen Lernaktivitäten erfüllt wurden. Für eine nachhaltige Qualitätssicherung sollte der Tutor den Ablauf der Veranstaltung in einem Lehrbericht dokumentieren, der ausgewertete Daten, Teilnehmermeinungen, eine allgemeine Bewertung und Vorschläge zur Verbesserung enthält. Diese Erkenntnisse erleichtern den Aufbau von Folgeveranstaltungen. Vor der eigentlichen Durchführung sollte eine Evaluation stattfinden, um den Qualifizierungsbedarf, die Auswahl der Ziele und Inhalte sowie die Eignung der Medien zu überprüfen. Tests ermöglichen die Überprüfung der technischen Funktionalität. Ein Testszenario mit einer Studentengruppe, Tutor und den an der Konzeption Beteiligten kann die technische Umsetzung unter realen Bedingungen simulieren.
V.Fallbeispiel Einführung in das Wissensmanagement an der HdM Stuttgart
Als Fallbeispiel wird ein Kurs "Einführung in das Wissensmanagement" für den Masterstudiengang Informationswirtschaft (IWM) an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart vorgestellt. Die Teilnehmerzahl sollte auf ca. 15 Personen begrenzt sein. Der Kurs kombiniert virtuelle und Präsenzphasen und nutzt die Flexibilität des CSCL-Ansatzes, um den Bedürfnissen berufstätiger Studierender gerecht zu werden. Die Ziele des Kurses sind die Vermittlung eines Verständnisses für Wissensmanagement, die Förderung der Zusammenarbeit und die Anwendung des Gelernten in der Praxis. Die FIBAA-Akkreditierung der HdM beeinflusst die didaktische Gestaltung des Kurses.
1. Konzeption des Kurses Einführung in das Wissensmanagement
Das Fallbeispiel beschreibt die Konzeption eines Kurses "Einführung in das Wissensmanagement" für den Masterstudiengang Informationswirtschaft (IWM) an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart. Der Kurs richtet sich an Absolventen verwandter Studiengänge, die ihre Kenntnisse vertiefen und aktualisieren möchten. Viele Teilnehmer sind berufstätig und benötigen daher ein flexibles Lernmodell. Computergestützte kooperative Lehr-/Lernkonzepte (CSCL) eignen sich besonders gut, da die Gruppen klein (10-15 Personen) und überschaubar bleiben. Die zeitliche und örtliche Flexibilität von CSCL passt zu den Bedürfnissen berufstätiger Studierender. Die Praxiserfahrung der Teilnehmer unterstützt den Lernprozess durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen, da Wissensmanagement Parallelen zu CSCL aufweist. Viele Teilnehmer sind bereits mit selbstständigem Lernen und Gruppenarbeit vertraut, was den Einstieg in CSCL erleichtert. Die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmer machen CSCL zu einer geeigneten Methode, da jeder den Lernstoff individuell vertiefen kann.
2. Didaktische Gestaltung und technische Voraussetzungen
Die didaktischen Ziele des Kurses umfassen das Verständnis von Wissensmanagement in Unternehmen, dessen Bedeutung und Gestaltung. Die Teilnehmer sollen die verschiedenen Facetten des Themas gemeinsam erarbeiten. Aufgrund der unterschiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmer werden einfache Zielsetzungen zu Beginn empfohlen, um Erfolge zu erzielen und die Motivation zu steigern. Die Lehrinhalte sollten einen vorgegebenen Lernpfad bieten und praxisorientierte Strukturen enthalten (z.B. Modelle zur Bedeutung von Wissen für den Unternehmenserfolg). Feedbackprozesse durch Diskussionen und den Austausch persönlicher Erfahrungen werden empfohlen. Die technische Ausstattung der HdM mit internetfähigen Computern und leistungsstarken PCs, die Simulationen und Videos abspielen können, wird als ausreichend betrachtet. Eine stabile Internetverbindung und Antivirensoftware gewährleisten einen sicheren Datenverkehr.
3. Anforderungen an Tutor und Teilnehmer Kursablauf
Der Text analysiert die Anforderungen an den Tutor und die Teilnehmer. Der Tutor benötigt neben fachlicher Expertise im Wissensmanagement den Umgang mit den eingesetzten Medien, Unterstützungsfunktionen (z.B. E-Mail-Beratung), Kenntnisse in computergestützter Kommunikation, Moderationstechniken und Konfliktbewältigung. Der Kurs beginnt mit einer Präsenzveranstaltung ("Kick-Off"), die Informationen zu Ablauf, Terminen, Zeitaufwand und Technik liefert, Anforderungen an die Teilnehmer erläutert, Gruppenregeln bespricht und einen Überblick über die Thematik gibt. Die Teilnehmerzahl wird auf ca. 15 Personen begrenzt, um einen hohen Betreuungsaufwand zu bewältigen. Es werden Präsenzveranstaltungen (Plenum und Erfahrungs-Workshop) in der Mitte und am Ende des Kurses vorgeschlagen, um Zwischenergebnisse zu präsentieren, Feedback auszutauschen und Probleme zu diskutieren. Die zweite Präsenzveranstaltung ist workshop-orientiert, mit Präsentationen der Gruppen, Diskussionen und Feedback vom Tutor.
4. Evaluation und Erfolgsmessung des Kurses
Die Evaluation des Kurses dient der Qualitätssicherung und soll den Qualifizierungsbedarf, die Auswahl von Zielen und Inhalten sowie die Eignung der Medien überprüfen. Empirische Untersuchungen analysieren, ob die Medien und Lernmaterialien die Erreichung der Lernziele unterstützen, und Tests überprüfen die technische Funktionalität. Ein Testszenario mit Studenten, Tutor und Konzeptionsteam simuliert die technische Umsetzung unter realen Bedingungen. Nach der Evaluation und Verbesserung kann der Kurs in den Stundenplan integriert werden. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, ob der Kurs dem Qualifizierungsbedarf entspricht und die Ziele und Inhalte gut ausgewählt wurden. Die Hochschule der Medien plant eine Evaluation ihrer Studienangebote durch die FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), welche einen Anteil von maximal 30% klassischer Vorlesungen vorschreibt. CSCL-Konzepte spielen daher eine wichtige Rolle in der Erfüllung dieser Akkreditierungsregelung.
