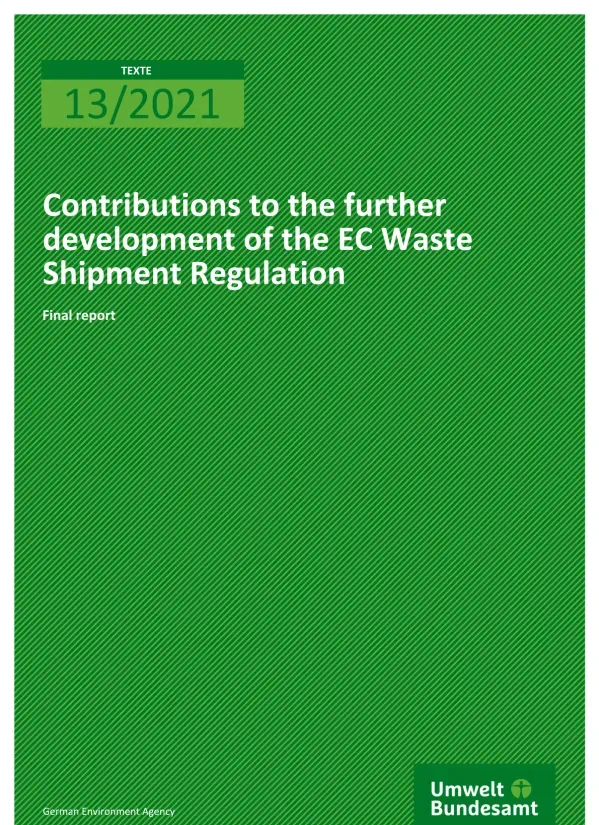
Abfalltransportverordnung: Verbesserungsvorschläge
Dokumentinformationen
| Autor | Ferdinand Zotz |
| instructor/editor | Kerstin Peter |
| Schule | Ramboll Deutschland GmbH |
| Fachrichtung | Umweltwissenschaften/Environmental Science (implied) |
| Unternehmen | Ramboll Deutschland GmbH |
| Ort | Dessau-Roßlau |
| Dokumenttyp | Final Report |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 1.25 MB |
Zusammenfassung
I.Durchsetzung der Abfallverbringungsrichtlinie AVRL und illegale Abfalltransporte
Die Studie analysiert die Durchsetzung der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL) in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf illegale Abfalltransporte. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kooperation zwischen den Behörden der Bundesländer, den Zollbehörden und anderen Aufsichtsbehörden wie dem Bundesamt für Güterverkehr und der Polizei. Seit 2017 sind die Bundesländer gemäß Artikel 50(2a) AVRL verpflichtet, umfassende Überprüfungspläne mit detaillierten Dokumentationsanforderungen zu erstellen und mindestens alle drei Jahre zu überprüfen. Die Studie untersucht die hemmenden Faktoren bei der Durchsetzung der AVRL und die Wirksamkeit der Kontrollen. Die Zahlen zum grenzüberschreitenden Abfalltransport aus 2017 (Quelle: Umweltbundesamt) unterstreichen die Bedeutung des Themas. Besondere Beachtung finden die Meldeverfahren und die Unterscheidung zwischen Abfall und Nicht-Abfall im Kontext der EU-Verordnung 660/2014.
1. Effektive Durchsetzung der Abfallverbringungsrichtlinie AVRL
Die effektive Durchsetzung der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL) in Deutschland erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden auf Bundes- und Landesebene. Neben der Kooperation zwischen den Bundesländern ist die Zusammenarbeit mit den Zollbehörden und anderen Aufsichtsbehörden wie dem Bundesamt für Güterverkehr oder der Polizei unerlässlich. Seit 2017 besteht gemäß Artikel 50(2a) AVRL die Verpflichtung für die Bundesländer, detaillierte und umfangreiche Inspektionspläne mit strengen Dokumentationsanforderungen zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren. Diese Pläne dienen der Überwachung des grenzüberschreitenden Abfallverkehrs und der Bekämpfung illegaler Abfalltransporte. Die AVRL ist Teil des europäischen und nationalen Rahmens der Kreislaufwirtschaft, mit dem Ziel, die Verwendung von Abfällen als Sekundärrohstoffe zu erhöhen. Die Bedeutung des durch die AVRL abgedeckten Transports wird durch die vom Umweltbundesamt veröffentlichten Zahlen zum grenzüberschreitenden Abfalltransport im Jahr 2017 deutlich. Die Studie analysiert die Anwendung und Umsetzung der AVRL im Zusammenhang mit illegalen Transporten, die Zusammenarbeit der Behörden bezüglich Meldeverfahren und Inspektionen sowie bestehende Durchsetzungsbarrieren.
2. Inspektionen und Kontrollen gemäß AVRL
Artikel 50(2) AVRL sieht Inspektionen von Anlagen und Unternehmen sowie Stichprobenkontrollen von Abfalltransporten und der damit verbundenen Verwertung oder Beseitigung vor. Diese Kontrollen sollen sowohl an den Standorten der betreffenden Anlagen als auch während des Transports erfolgen. Die EU-Verordnung 660/2014 verschärft die Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung illegaler Abfalltransporte, insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Abfall und Nicht-Abfall. Gemäß Artikel 50(2a) AVRL mussten die Mitgliedsstaaten bis zum 1. Januar 2017 mindestens einen Inspektionsplan mit umfangreichen Dokumentationsanforderungen einrichten. Diese Pläne müssen mindestens alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Die Studie untersucht die praktische Umsetzung dieser Vorgaben und die Herausforderungen bei der Durchführung von Inspektionen. Die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Behörden auf Bundes- und Landesebene sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie dem Bundesamt für Güterverkehr, den Zollbehörden und der Polizei spielen eine wichtige Rolle bei der effektiven Durchsetzung.
3. Internationale Rechtsgrundlagen Basler Übereinkommen und OECD Entscheidung
Das Basler Übereinkommen (BC) von 1989 ist das erste internationale Abkommen zur Regulierung des grenzüberschreitenden Transports gefährlicher Abfälle. Kernpunkte sind die Abfallvermeidung, die Abfallbehandlung am Entstehungsort und die Minimierung der Risiken bei grenzüberschreitenden Transporten. Das BC gilt für gefährliche Abfälle gemäß Artikel 1(1) und „andere Abfälle“ (Artikel 1(2)), einschließlich Hausmüll und Rückständen aus der Müllverbrennung. Der Transport ist nur zulässig, wenn alle beteiligten Staaten im Voraus informiert wurden und zugestimmt haben. Die AVRL setzt das Basler Übereinkommen und die OECD-Entscheidung C(2001) 107/FINAL in EU-Recht um. Für Green-listed Abfälle gemäß den Anhängen III, IIIA und IIIB der AVRL gelten gemäß Artikel 18 ab einer Menge von über 20 kg (Artikel 3(2) AVRL) allgemeine Informationspflichten. Es ist ein Dokument gemäß Anhang VII beizufügen und vor dem Transport ein Vertrag über die Verwertung des Abfalls abzuschließen. Artikel 19 (Verbot des Mischens von Abfällen) und Artikel 49 (Umweltschutz) der AVRL finden auf meldepflichtige Abfälle keine Anwendung. Die Studie beleuchtet die Schnittstellen zwischen den internationalen Übereinkünften und den nationalen Umsetzungserfordernissen.
II.Inspektionen und Durchsetzungsbarrieren
Gemäß Artikel 50(2) AVRL müssen Inspektionen von Anlagen und Unternehmen sowie Stichprobenkontrollen von Abfalltransporten durchgeführt werden. Die EU-Verordnung 660/2014 verschärft die Kontrollen zur Vermeidung illegaler Abfallverbringungen. Die Studie beleuchtet die praktischen Herausforderungen bei der Durchführung von Inspektionen und identifiziert bestehende Barrieren bei der Durchsetzung der AVRL. Die Rolle der verschiedenen Behörden und die Zusammenarbeit zwischen ihnen stehen im Fokus. Die Untersuchung betrachtet insbesondere die Inspektionspläne der Bundesländer und deren Umsetzung.
1. Anforderungen an Inspektionen gemäß Artikel 50 2 AVRL
Artikel 50(2) der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL) schreibt Inspektionen von Anlagen und Unternehmen sowie Stichprobenkontrollen bei Abfalltransporten und deren Verwertung oder Beseitigung vor. Die Inspektionen sollen sowohl an den Standorten der Anlagen als auch während des Transports durchgeführt werden. Ziel ist die Überwachung der Einhaltung der AVRL-Vorschriften und die Prävention illegaler Abfalltransporte. Die EU-Verordnung 660/2014 hat Artikel 50 der AVRL um Elemente erweitert, die strengere Kontrollen in den Mitgliedsstaaten fordern, um illegale Transporte zu verhindern, insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Abfall und Nicht-Abfall. Die praktische Umsetzung dieser Anforderungen stellt eine Herausforderung dar, da sie sowohl die räumliche Kontrolle an den Anlagen als auch die mobile Kontrolle während des Transports erfordert. Die Koordinierung zwischen verschiedenen Behörden ist für eine effektive Durchführung der Inspektionen entscheidend.
2. Inspektionspläne und deren Umsetzung Artikel 50 2a AVRL
Artikel 50(2a) der AVRL verpflichtet die Mitgliedsstaaten seit dem 1. Januar 2017, Inspektionspläne mit detaillierten Inhalten und Dokumentationsanforderungen zu erstellen. Diese Pläne müssen mindestens alle drei Jahre überprüft und aktualisiert werden. Die Studie analysiert die Ausgestaltung und Umsetzung dieser Inspektionspläne in den deutschen Bundesländern. Dabei wird festgestellt, dass die Ziele der Inspektionen in den Plänen der Bundesländer nur geringfügig voneinander abweichen und in erster Linie darauf abzielen, illegale Abfalltransporte und andere Verstöße gegen die Abfalltransportbestimmungen aufzudecken und zu verhindern. In einigen Plänen wird explizit das Basler Übereinkommen erwähnt, beispielsweise mit dem Ziel, die Ausfuhr gefährlicher Abfälle in Entwicklungsländer zu reduzieren (z.B. Bayern). Die Analyse der Inspektionspläne umfasst auch Berichte über Schulungsmaßnahmen, wobei eine Überlappung in den Berichten der Bundesländer festgestellt wird. Nationale Behörden wie das Bundesamt für Güterverkehr und der Zoll bieten bundesweite Schulungen an. Die Landespolizeien führen ebenfalls interne Schulungen und Workshops zum Thema Abfalltransport durch.
3. Herausforderungen und Barrieren bei der Durchsetzung
Die effektive Durchsetzung der AVRL in Deutschland ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Neben der bereits erwähnten Notwendigkeit der internen und externen Behördenkooperation bestehen Schwierigkeiten bei der konkreten Umsetzung der Inspektionen. Die Studie untersucht die Barrieren bei der Durchsetzung der AVRL und die damit verbundenen Probleme. Dabei zeigt sich, dass die Verantwortung für illegale Transporte nicht immer klar zugeordnet werden kann, was die Durchsetzung erschwert. Die Rücknahmepflicht bei illegalen Transporten (Artikel 24 AVRL) stellt eine weitere Herausforderung dar, insbesondere im Kontext der unterschiedlichen Regelungen im internationalen Recht. Die Studie beleuchtet die unterschiedliche Handhabung der Kontaminationsgrenzwerte für Abfälle, was zu Rechtsunsicherheit führt. Es werden Lösungsansätze diskutiert, z.B. die Verbesserung der Definition von Verantwortlichkeiten, die Optimierung der Kommunikation zwischen Behörden und die Harmonisierung von Grenzwerten auf europäischer Ebene. Die Notwendigkeit von pragmatischen Lösungen unter Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeit wird ebenfalls angesprochen.
III.Internationale Rechtslage Basler Übereinkommen und OECD Entscheidung
Die Studie betrachtet die internationale Rechtslage, insbesondere das Basler Übereinkommen (BC) von 1989 und die OECD-Entscheidung, die den grenzüberschreitenden Transport gefährlicher Abfälle regeln. Der Fokus liegt auf der Harmonisierung mit der AVRL und den daraus resultierenden Anforderungen an die Meldeverfahren und die Kontrolle von Abfalltransporten. Die Definition von gefährlichen Abfällen und "anderen Abfällen" im Kontext des BC wird erläutert, ebenso wie die Anforderungen an die Zustimmung der beteiligten Staaten zu Import, Export und Transit. Die Bedeutung von Green-listed Abfällen und den damit verbundenen Meldepflichten wird hervorgehoben.
1. Das Basler Übereinkommen BC und seine Relevanz
Das Basler Übereinkommen (BC) von 1989 regelt den grenzüberschreitenden Transport und die Beseitigung gefährlicher Abfälle und war das erste internationale Abkommen, das globale Abfalltransporte regelte. Kernpunkte des BC sind die Abfallreduzierung (Artikel 4(2)(a)), die Abfallbehandlung möglichst am Entstehungsort (Artikel 4(2)(b)), die Minimierung der Risiken bei grenzüberschreitenden Transporten gefährlicher Abfälle (Artikel 4(2)(c)) und die allgemeine Kontrolle und Überwachung grenzüberschreitender Transporte. Das Übereinkommen gilt für gefährliche Abfälle gemäß Artikel 1(1) und „andere Abfälle“ (Artikel 1(2)), einschließlich Hausmüll und Rückständen aus der Müllverbrennung. Der Transport gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle ist nur zulässig, wenn alle beteiligten Staaten im Voraus informiert wurden und der Ein-, Aus- und gegebenenfalls Durchfuhr zugestimmt haben. Das BC bildet eine wichtige internationale Rechtsgrundlage für den grenzüberschreitenden Abfalltransport und beeinflusst die Gestaltung der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL) der Europäischen Union. Die Rücknahmepflicht bei illegalen Transporten, wie sie in Artikel 9(2) bis (4) des BC geregelt ist, ist von besonderer Bedeutung. Diese Rücknahmepflicht liegt in der Verantwortung des Exportstaates und umfasst die Rücknahme durch den Exporteur, den Erzeuger oder den Exportstaat selbst, falls eine umweltgerechte Verwertung nicht möglich ist.
2. Die OECD Entscheidung und ihre Harmonisierung mit der AVRL
Die OECD-Entscheidung C(2001) 107/FINAL dient der Kontrolle von Abfällen, die zur Verwertung bestimmt sind. Sie regelt den grenzüberschreitenden Transport im Zusammenhang mit der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL). Die AVRL hat das Ziel, das Basler Übereinkommen und die OECD-Entscheidung in das Unionsrecht zu überführen. Die OECD-Entscheidung enthält Bestimmungen über allgemeine Meldungen, die für Fälle gelten, in denen Abfälle mit im Wesentlichen gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften regelmäßig an dieselbe Verwertungsanlage desselben Exporteurs geschickt werden. Diese können für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr ausgestellt werden. Der Widerruf einer solchen Genehmigung unterliegt den spezifischen Informationsanforderungen der zuständigen Behörden. Die Bestimmungen der OECD-Entscheidung zu allgemeinen Meldungen (z.B. Kapitel II, Abschnitt D(2), Fälle 1(m), (n) und 2(g)) korrespondieren mit den Regelungen des Artikels 14 der AVRL. Die OECD-Entscheidung legt auch Verfahren für die Rückgabe von Abfällen fest, beispielsweise wenn ein Transport nicht wie geplant abgeschlossen werden kann (z.B. bei illegalen Transporten). Hierbei wird die Suche nach einer gemeinsamen Lösung für eine umweltgerechte Verwertung priorisiert. Die verschiedenen Verfahren im Kontext von Rücknahme und umweltgerechter Verwertung von Abfällen werden verglichen. Die Studie untersucht die Vereinbarkeit und die Herausforderungen der Harmonisierung zwischen den internationalen Regelungen des BC und der OECD-Entscheidung und den Bestimmungen der AVRL.
3. Green listed Abfälle und der Artikel 18 Prozess
Green-listed Abfälle (Anhänge III, IIIA und IIIB der AVRL) unterliegen ab einer Menge von über 20 kg (Artikel 3(2) AVRL) allgemeinen Informationspflichten gemäß Artikel 18 AVRL. Das Meldeverfahren erfordert ein Begleitdokument (Anhang VII) und einen vorab abgeschlossenen Vertrag über die Verwertung. Eine Kopie des Anhang VII-Dokuments muss drei Jahre aufbewahrt werden. Artikel 19 (Verbot der Vermischung von Abfällen) und Artikel 49 (Umweltschutz) der AVRL finden auf meldepflichtige Abfälle keine Anwendung. Die Studie analysiert den Artikel 18-Prozess im Kontext des Basler Übereinkommens und der OECD-Entscheidung. Es wird festgestellt, dass die spezifischen Bestimmungen der AVRL zu dem in Artikel 18 der AVRL behandelten Szenario nicht im internationalen Rechtsrahmen festgelegt sind. Die grenzüberschreitenden Transporte von Green-listed Abfällen unterliegen zwar den üblichen Kontrollen bei Handelstransaktionen (OECD-Entscheidung, Kapitel II, Abschnitte B und C), diese sind aber nicht spezifiziert. Die Studie diskutiert die Auswirkungen unterschiedlicher Auslegungen und die Notwendigkeit von Klarheit und Harmonisierung im Umgang mit Green-listed Abfällen, insbesondere bezüglich der zulässigen Kontaminationsanteile.
IV.Probleme und Lösungsansätze aus der Stakeholder Konsultation
Die Studie präsentiert Ergebnisse einer Stakeholder-Konsultation, an der unter anderem Behörden, Verbände und Unternehmen teilnahmen (47 Antworten, davon 20 von Behörden). Diskutiert wurden unter anderem die 20 kg- und 25 kg-Grenzen für die Meldepflicht gemäß Artikel 3(2) und 3(4) AVRL, sowie die Definition von "illegalem Abfalltransport" und die damit verbundene Rücknahmepflicht (Artikel 24 AVRL). Die Herausforderungen bei der Bestimmung der Verantwortlichen für illegale Transporte und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Behörden wurden ebenfalls behandelt. Es wurden Vorschläge zur Klärung der Verantwortlichkeiten, zur Verbesserung der Meldeverfahren (z.B. durch elektronischen Datenaustausch) und zur Harmonisierung der Grenzwerte für Kontaminationen in Abfällen gemacht. Die Rückmeldungen zeigten teilweise divergierende Interessen zwischen Behörden und Wirtschaftsakteuren, beispielsweise bezüglich der Offenlegung von Daten über die Abfallerzeuger in Dritt-Transaktionen.
1. Ergebnisse der Stakeholder Konsultation Teilnehmer und Methodik
Die Studie basiert auf einer Stakeholder-Konsultation mit 105 Einladungen zu einem Online-Fragebogen, von denen 47 ausgefüllt zurückkamen (Antwortquote 45%). Nach Ausschluss unvollständiger Fragebögen wurden 38 ausgewertet. Die größte Antwortgruppe bildeten die zuständigen Behörden mit 20 Fragebögen (53%), gefolgt von Verbänden (9 Fragebögen, 24%), Ministerien der Bundesländer (4 Fragebögen, 11%) und Unternehmen (5 Fragebögen, 14%), darunter ein staatlich beauftragtes Unternehmen. Das Verhältnis von Behörden zu privaten Akteuren lag bei 63:11. Die Konsultation zielte darauf ab, die Zufriedenheit der Akteure mit den bestehenden Regelungen zu ermitteln und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Diskutiert wurden Aspekte illegaler Transporte, Effizienz der Durchsetzung und die Einbettung der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL) in die Kreislaufwirtschaft. Die Studie berücksichtigt die ersten Phasen der Evaluierung von EU-Rechtsvorschriften im Rahmen der EU-Initiative für bessere Rechtsetzung, konzentriert sich aber auf die Herausforderungen der Durchsetzung und Anwendung der AVRL in Deutschland.
2. Diskussionspunkte Meldepflicht und Rücknahmeverpflichtung
Ein zentraler Diskussionspunkt betraf die Meldepflicht für Abfalltransporte. Die Befragten konzentrierten sich dabei weniger auf die 20 kg-Grenze (Artikel 3(2) AVRL), sondern stärker auf die 25 kg-Grenze für Laboranalysen (Artikel 3(4) AVRL). Die Meinungen zur Angemessenheit der 25 kg-Grenze waren geteilt: Während die Industrie eine Anhebung befürwortete, lehnten die Behörden dies mehrheitlich ab, um eine Umgehung der Meldepflicht zu vermeiden. Ein Konsens bestand jedoch darin, dass 25 kg für Laboranalysen ausreichend sind. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Verbindung zwischen der Definition von "illegalem Transport" und der Rücknahmepflicht gemäß Artikel 24 AVRL. Die Experten betonten, dass die Rücknahmepflicht nach AVRL für illegale Transporte unter beiden Verfahren gilt, im Gegensatz zum Völkerrecht, wo dies nur für amber-listed Abfälle zutrifft. Die strengere Reihenfolge in Artikel 24 im Vergleich zur OECD-Entscheidung wurde ebenfalls diskutiert. Die Rücknahme von Abfällen aufgrund formaler Fehler, obwohl der Transport an sich legal wäre, wurde als Problem hinsichtlich der Umweltbelastung identifiziert.
3. Weitere Problembereiche und Lösungsvorschläge
Zusätzliche Herausforderungen ergaben sich aus der Kommunikation mit den Behörden und der Schwierigkeit, den richtigen Ansprechpartner zu identifizieren. Die Befugnis, Beteiligte am Transport (Spediteure, Frachtführer etc.) zur Rücknahme und Abfallentsorgung zu verpflichten (Artikel 25 AVRL), wurde als dringend notwendig erachtet, besonders wenn kein eindeutiger Abfallerzeuger feststellbar ist. Die Definitionen in Artikel 2(15) AVRL erwiesen sich in der Praxis als nicht immer anwendbar auf illegale Transporte. Als Lösungsansatz wird die Erweiterung der Definition des Verantwortlichen, analog zum deutschen Abfallverbringungsgesetz, vorgeschlagen. Auch die gemeinsame Verantwortung von Absender und Empfänger bei Illegalität wurde diskutiert. Die Frage nach der Offenlegung des Abfallerzeugers in Dritt-Transaktionen wurde kontrovers diskutiert; während die Industrie den Schutz sensibler Geschäftsinformationen betonte, sahen die Behörden die Offenlegung als notwendig für Transparenz und Kontrolle. Einigkeit bestand in der Notwendigkeit eines elektronischen Datenaustauschsystems, wobei ein einfaches, aber zuverlässiges und einheitliches System bevorzugt wurde. Die Inkonsistenzen bei den Grenzwerten für Kontaminationen in Abfällen wurden als Problem identifiziert, wobei eine Harmonisierung auf europäischer Ebene empfohlen wurde.
V.Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Studie liefert Empfehlungen zur Verbesserung der Durchsetzung der AVRL, fokussiert auf die Klärung von Definitionen, die Optimierung der Meldeverfahren und die Harmonisierung der Kontrollen. Konkrete Vorschläge betreffen die Präzisierung der Rücknahmepflicht, die Verbesserung der internen und internationalen Zusammenarbeit der Behörden, die Einführung eines elektronischen Systems für den Datenaustausch und die Festlegung einheitlicher Grenzwerte für Kontaminationen in Abfällen. Die Notwendigkeit für eine verbesserte Rechtsklarheit und eine effektivere Durchsetzung der AVRL zur Vermeidung illegaler Abfalltransporte wird betont.
1. Zusammenfassung der wichtigsten Herausforderungen
Die Studie identifiziert zentrale Herausforderungen bei der Durchsetzung der Abfallverbringungsrichtlinie (AVRL). Die Verknüpfung zwischen der Definition von "illegalem Transport" und der Rücknahmepflicht (Artikel 24 AVRL) stellt ein zentrales Problem dar. Die Rücknahmepflicht gilt nach AVRL für illegale Transporte unter beiden Verfahren, im Gegensatz zum Völkerrecht, das dies nur für amber-listed Abfälle vorsieht. Die in Artikel 24 festgelegte Reihenfolge erscheint strenger als in der OECD-Entscheidung, wo alternative, umweltverträgliche Lösungen priorisiert werden. Weitere Probleme betreffen die unterschiedliche Handhabung von Kontaminanten in Abfällen, was zu Rechtsunsicherheit führt, und die Schwierigkeit, den Verantwortlichen bei illegalen Transporten zu identifizieren. Die Offenlegung der Identität des Abfallerzeugers in Dritt-Transaktionen wird kontrovers diskutiert, wobei ein Interessenskonflikt zwischen Transparenz und dem Schutz sensibler Geschäftsinformationen besteht. Die Studie zeigt, dass viele Herausforderungen eher exekutiver als rechtlicher Natur sind und eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden auf verschiedenen Ebenen erfordert.
2. Konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der AVRL Durchsetzung
Die Experten empfehlen verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der AVRL-Durchsetzung. Die Definition von "unter der Gerichtsbarkeit" sollte präzisiert und erweitert werden, um die Verantwortlichkeiten klarer zu regeln. Es wird vorgeschlagen, die Definition des Verantwortlichen zu erweitern, um auch denjenigen einzubeziehen, der den Transport organisiert, analog zu Artikel 8(2) des deutschen Abfallverbringungsgesetzes. Um die Transparenz zu erhöhen, wird vorgeschlagen, dass alle Dokumente im Zusammenhang mit gemeldeten Transporten mindestens drei Jahre aufbewahrt werden. Die Einführung eines elektronischen Systems für den Datenaustausch wird als notwendig erachtet, wobei ein einfaches, aber zuverlässiges und einheitliches System bevorzugt wird. Die Harmonisierung der Grenzwerte für Kontaminanten in Abfällen auf europäischer Ebene soll die Rechtsicherheit erhöhen. Ein zentraler Punkt ist auch die Klärung der 20 kg bzw. 25 kg-Grenze der Meldepflicht, wobei die Experten die Beibehaltung der aktuellen Regelung empfehlen. Die Vereinfachung von Formularen, wie dem Formular nach Anhang VII, wird ebenfalls vorgeschlagen. Der Aufbau eines zentralen Koordinationsgremiums in Deutschland könnte die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen zuständigen Behörden verbessern.
3. Ausblick und Notwendigkeit weiterer Maßnahmen
Die Schlussfolgerungen der Studie betonen die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Behörden und einer Klärung der bestehenden Unklarheiten in der AVRL. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Effizienz der Durchsetzung zu steigern und die Rechtsunsicherheit zu verringern. Ein elektronisches System für den Datenaustausch soll die Kommunikation und die Überwachung von Abfalltransporten vereinfachen. Die Harmonisierung der Grenzwerte für Kontaminationen in Abfällen auf europäischer Ebene ist entscheidend für die Rechtsklarheit. Die Präzisierung der Verantwortlichkeiten und die Erweiterung der Rücknahmepflichten sollen die Durchsetzung effektiver gestalten. Die Studie betont, dass die Umsetzung der Empfehlungen eine umfassende und koordinierte Anstrengung von Behörden und Wirtschaftsakteuren erfordert. Eine vollständige Folgenabschätzung sollte auf EU-Ebene durchgeführt werden, um die Effektivität, Effizienz und Relevanz der vorgeschlagenen Änderungen zu bewerten.
