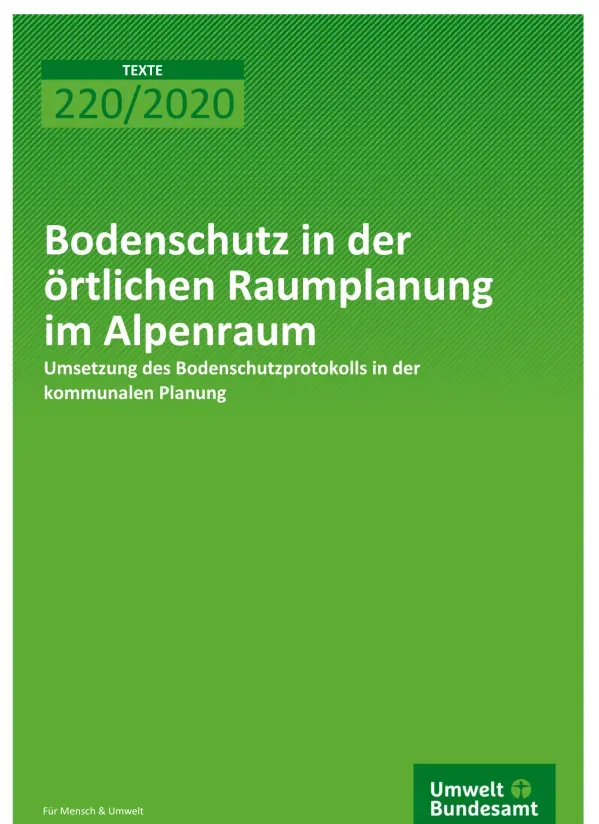
Bodenschutz im Alpenraum: Umsetzung des BodP
Dokumentinformationen
| Autor | Dr. Gertraud Sutor |
| instructor | Dr. Frank Glante |
| Schule | Keine Universität explizit genannt |
| Fachrichtung | Landschaftsökologie, Raumplanung, Ingenieurwissenschaften (vermutlich) |
| Unternehmen | Umweltbundesamt |
| Ort | Dessau-Roßlau |
| Dokumenttyp | Studie, Bericht |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 2.66 MB |
Zusammenfassung
I.Das Projekt Bodenschutz in der kommunalen Raumplanung im Alpenraum
Das Projekt, gefördert vom Bundesumweltministerium (BMU) und durchgeführt von LAND-PLAN in Kooperation mit REGIOPLAN INGENIEURE und LÄNGST & VOERKELIUS, konzentrierte sich auf die Verbesserung des Bodenschutzes in Gemeinden des Alpenraums. Der Fokus lag auf der praktischen Umsetzung des Bodenschutzprotokolls (BodP) der Alpenkonvention durch einfach anwendbare Methoden zur Bodenfunktionsbewertung. Zielgruppen waren Vertreter der kommunalen Verwaltung und Planer. Das Projekt lief von Juni 2018 bis Oktober 2020 und umfasste Wissenstransfer und Capacity Building in den Pilotregionen Oberösterreich, Tirol und Sonthofen (Bayern).
1. Projektkontext und Ziele
Das Projekt, initiiert vom Bundesumweltministerium (BMU) im Rahmen des Alpenraumprogramms INTERREG, baut auf dem Vorgängerprojekt Links4Soils auf. Während Links4Soils einen alpenweiten Ansatz verfolgte, konzentriert sich dieses Projekt auf ausgewählte Pilotregionen: Oberösterreich, Tirol und die Stadt Sonthofen in Bayern. Das Hauptziel ist die Entwicklung und Implementierung einfach anwendbarer Methoden für den vorsorgenden Bodenschutz in der kommunalen Raumplanung, im Einklang mit dem Bodenschutzprotokoll (BodP) der Alpenkonvention. Die Verbesserung des Wissenstransfers und Capacity Building in den Gemeinden steht im Vordergrund. LAND-PLAN, Ebersberg, fungierte als Projektauftragnehmer in Zusammenarbeit mit REGIOPLAN INGENIEURE (Salzburg) und LÄNGST & VOERKELIUS (Landshut). Das Projekt lief von Juni 2018 bis Oktober 2020. Ein zentrales Element war die Bewertung der Bodenfunktionen und deren Integration in kommunale Planungsprozesse, um das Schutzgut Boden nachhaltig zu sichern und die ökologischen Bodenfunktionen zu erhalten, wie in Artikel 1 (2) BodP gefordert. Die Ergebnisse sollten so aufbereitet werden, dass sie in die Arbeit der Zielgruppe (kommunale Verwaltung, politische Gremien und deren Planer) einfließen können. Der Beitrag von LAND-PLAN umfasste die fachliche Aufwertung von Fallstudien durch die Bewertung von Bodenfunktionen und den modellhaften Wissenstransfer und Capacity Building in den Gemeinden durch Bereitstellung von Grundlagenwissen und Aufbau von Entscheidungskompetenz.
2. Projektansatz und Kooperationspartner
Das Projekt basiert auf einer transnationalen Kooperation und einem Dreiklang aus Projektauftragnehmer (LAND-PLAN), einem Vertreter der kommunalen Raumplanung und der Einbindung von Architekten oder Planern vor Ort. Diese Konstellation soll den Wissenstransfer und Capacity Building nachhaltig in den Planungsraum integrieren, auch nach Projektabschluss. Die Zusammenarbeit mit REGIOPLAN INGENIEURE (Salzburg) und LÄNGST & VOERKELIUS (Landshut) basiert auf langjähriger Erfahrung im Themenbereich Bodenfunktionsbewertung und örtliche Raumplanung. Das BMU beauftragte das Projekt mit der Entwicklung einfach anwendbarer Methoden, um den vorsorgenden Bodenschutz in den Kommunen bei Planungsentscheidungen zu verankern. Die Auswahl der Pilotregionen – Oberösterreich, Tirol und Sonthofen – basiert auf unterschiedlichen Ausgangslagen im Bereich des Bodenschutzes und des Wissenstransfers. Oberösterreich weist bereits einen fortgeschrittenen Prozess im Capacity Building und Knowledge Transfer auf. In Tirol existierte eine landesweite Bodenfunktionsbewertung, jedoch fehlte es an Information und Schulung der Gemeindevertreter. Sonthofen, als Alpenstadt des Jahres 2005, stand vor Herausforderungen durch Flächenverbrauch bei begrenztem Siedlungsausbaupotential. Die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren war essentiell für den Erfolg des Projekts. Die Stadt Sonthofen wurde beispielsweise bei der Einführung des Konzeptes der Bodenfunktionsbewertung durch eine Auftaktbesprechung mit dem Stadtbaumeister und weiteren Vertretern unterstützt. Das Projekt knüpft an die Erfahrungen aus früheren Pilotprojekten an und vertieft diese inhaltlich.
3. Herausforderungen im Alpenraum und angestrebte Lösungen
Der Alpenraum ist durch zunehmende Nutzungsansprüche und den Klimawandel stark belastet. Der Flächenverbrauch durch Wohnraum, Gewerbebauten und Infrastruktur stellt eine große Herausforderung dar. Im Projekt wurde festgestellt, dass Entscheidungsträger in der Verwaltung und den politischen Gremien der Gemeinden durchaus Interesse am aktiven Bodenschutz in der kommunalen Planung bekunden. Die Zielgruppe (Entscheidungsträger, Planer) empfindet das Thema jedoch als komplex und teilweise hemmend. Daher fokussierte sich das Projekt auf die Entwicklung von leicht verständlichen Methoden und die schrittweise Heranführung an die Thematik. Die Bereitstellung einer niederschwelligen Bodenfunktionsbewertung für die Kommune – inklusive kartografischer Darstellung, eines zusammenfassenden Wertes und einer Anleitung zur Integration in die Planung – sollte das Verständnis erleichtern. Eine zeitweise Betreuung durch ein Fachbüro, z.B. in Form angepasster Workshops, wurde als unabdingbar erachtet. Es sollten geeignete präventive und kontrollierende Maßnahmen sowie deren rechtssichere Verankerung in Flächennutzungsplänen bereitgestellt werden. Best-Practice-Beispiele sollten den Networking und den Erfahrungsaustausch fördern. Die Entwicklung eines erfolgreichen Modells, wie es in Oberösterreich (jährlicher Workshop) existiert, wurde als erstrebenswert angesehen.
II.Pilotregionen und Ergebnisse der Bodenfunktionsbewertung
In Oberösterreich wurden jährlich Workshops zur Bodenfunktionsbewertung durchgeführt, die auf konkrete Anwendungsbeispiele ausgerichtet waren. In Tirol wurde eine landesweite Bodenfunktionsbewertung erstellt, deren Ergebnisse jedoch noch nicht öffentlich zugänglich waren. In Sonthofen (Bayern, Alpenstadt des Jahres 2005) wurden drei aufeinanderfolgende Workshops durchgeführt, die auf die spezifischen Herausforderungen der Stadt in Bezug auf Flächenverbrauch und Innenentwicklung eingingen. Die Bodenfunktionsbewertung wurde als essentiell für Abwägungsprozesse in der kommunalen Planung identifiziert, wobei ein zusammenfassender Wert und Leitlinien für dessen Integration in die Planung entwickelt wurden. Die Workshops sollten ein adäquates Grundlagenwissen zum vorsorgenden Bodenschutz vermitteln.
1. Oberösterreich Jährliche Workshops und Capacity Building
Oberösterreich zeichnet sich durch einen bereits weit fortgeschrittenen Prozess im Capacity Building und Knowledge Transfer im Bereich Bodenschutz aus. Seit 2015 findet jährlich ein landesweiter Workshop zur Bodenfunktionsbewertung statt, der sich an Vertreter der Gemeinden (Bürgermeister, Amtsleiter, Bauamtsleiter, Gemeinderäte) und interessierte Einzelpersonen richtet. Der Workshop 2018 umfasste ein zusätzliches Modul zur Diskussion von Themen wie Bodenverbrauch und vorsorgender Bodenschutz aus der Sicht der Gemeinden. Die Erweiterung des Workshops um konkrete Anwendungsbeispiele („Best-Practice-Beispiele“), wie z.B. das Örtliche Entwicklungskonzept Puchenau, das Interkommunale Wohngebiet Enns-Asten und die Aufschließung des Gewerbegebiets Haag am Hausruck, wurde von den Teilnehmern positiv bewertet. Zusätzlich wurde der Wunsch nach konkreten Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen und deren rechtlicher Verankerung geäußert. Die hohe Nachfrage (ausgebucht) und das positive Feedback unterstreichen den Erfolg des Workshop-Konzepts, obwohl die Dauer als zu lang empfunden wurde. Die Bodenfunktionsbewertung wurde als essentiell für die Planung identifiziert. Die positive Resonanz und die kontinuierliche hohe Teilnehmerzahl zeigen die Wirksamkeit des Ansatzes im Wissenstransfer und Capacity Building.
2. Tirol Landesweite Bodenfunktionsbewertung und Zugänglichkeit von Informationen
Tirol hat ab 2016 eine landesweite Bewertung der Bodenfunktionen durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch zunächst nur behördenintern zugänglich waren. Eine Information und Schulung der Gemeindevertreter und Planer fehlte zum Projektstart. Eine im Nachgang erstellte Lesehilfe („Die Bodenfunktionen im tirisMaps2.0 – Umsetzung des Bodeninformationssystems für Tirol“) war bis zur Endredaktion fertiggestellt, jedoch noch nicht öffentlich verfügbar. Die fehlende Zugänglichkeit der Ergebnisse und der Lesehilfe stellt eine Herausforderung dar. Die Verfügbarkeit dieser Informationen wäre für eine erfolgreiche Verbreitung des Wissens und für die Anwendung der Bodenfunktionsbewertung in der kommunalen Planung essentiell. Eine Wiederholung des Workshops, beispielsweise im Bezirk Kitzbühel, wurde als sinnvoll erachtet, sobald die Lesehilfe frei zugänglich ist. Ein zusammengestellter Katalog von Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wurde den Teilnehmern vorgestellt, konnte aber im Rahmen des Workshops nicht im Detail diskutiert werden.
3. Sonthofen Workshops zur Bodenfunktionsanalyse und Innenentwicklung
Die Stadt Sonthofen (Bayern), Alpenstadt des Jahres 2005, wurde mit drei aufeinander aufbauenden Workshops betreut. Die Stadt steht vor der Herausforderung, eine große Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen bei gleichzeitig fehlenden Möglichkeiten zur Erweiterung des Siedlungskörpers zu bewältigen. Die Bodenfunktionsbewertung soll hier Abwägungsprozesse bei Entscheidungen zur Innenentwicklung (Nachverdichtung oder Sanierungsvorhaben) unterstützen. Das für Oberösterreich entwickelte Workshopmodell (Grundlagenerhebung – Konfliktanalyse – Lösungsansätze) wurde übernommen und an die spezifischen Bedürfnisse Sonthofens angepasst. Der für Tirol erstellte Katalog von Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wurde direkt auf ein konkretes Anwendungsbeispiel (einen aktuell in Sonthofen überplanten B-Plan) angewendet. Ein Workshop behandelte explizit die Bodenfunktionsanalyse am Beispiel des B-Plans Jörghof, unter Beteiligung von Vertretern der Stadtverwaltung und des Stadtrats. Die Diskussion zeigte die Notwendigkeit, Eingriffe in den Boden so gering wie möglich zu halten und die Bodenfunktionen zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Bodenfunktionsbewertung wurde als hilfreich für Abwägungsprozesse in der kommunalen Planung eingestuft.
III.Methoden und Maßnahmen zum Bodenschutz
Das Projekt entwickelte einfach anwendbare Methoden, um den vorsorgenden Bodenschutz in kommunalen Planungsprozessen zu verankern. Dies beinhaltete die Bodenfunktionsbewertung (inkl. kartografischer Darstellung) mit einem zusammenfassenden Wert und Leitlinien zur Integration in die Planung. Zusätzlich wurden konkrete Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet und in Workshops mit den Gemeinden diskutiert. Best-Practice-Beispiele aus Oberösterreich, wie z.B. die Gemeinde Enns/Asten, zeigten erfolgreiche Strategien zur Minimierung von Bodenverlusten auf. Die Workshops wurden positiv bewertet; es wurde jedoch der Wunsch nach konkreten Maßnahmen und deren rechtlicher Verankerung geäußert.
1. Bodenfunktionsbewertung als zentrale Methode
Das Projekt entwickelte und erprobte Methoden zur Bodenfunktionsbewertung als Kerninstrument für den vorsorgenden Bodenschutz. Die Bewertung sollte nicht nur von Bodenspezialisten, sondern auch von Vertretern der kommunalen Verwaltung und Planung verständlich und anwendbar sein. Daher wurden die Ergebnisse in leicht verständlicher Form, inklusive kartografischer Darstellung und eines zusammenfassenden Wertes, bereitgestellt. Eine Anleitung zur Integration dieses Wertes in die Planungsprozesse wurde ebenfalls entwickelt. Diese vereinfachte Darstellung der komplexen Thematik sollte die Akzeptanz und Umsetzung des Bodenschutzes in der kommunalen Planung fördern. Die gewählte Methode der „Böden mit besonderer Bedeutung (BmbB) für den Naturhaushalt“ berücksichtigt die Historie des Projekts und die planerische Fragestellung in den Kommunen. Andere Methoden zur Generierung eines zusammenfassenden Wertes sind nach entsprechender Prüfung ebenfalls möglich. Die ÖNORM L 1076 Bodenfunktionsbewertung diente als Grundlage, wobei mindestens fünf Bodenfunktionen (Lebensraum, Standort, Produktion, Regulierung, Puffer) qualitativ bewertet wurden. Der Funktionserfüllungsgrad (FEG) beschreibt die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Bodenfunktion.
2. Konkrete Minderungs und Vermeidungsmaßnahmen
Neben der Bodenfunktionsbewertung wurden konkrete Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet und in den Workshops diskutiert. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, den Verlust an Bodenfunktionen zu minimieren und den vorsorgenden Bodenschutz in der Planung zu verankern. Die Maßnahmenkataloge wurden auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pilotregionen abgestimmt. Das Beispiel der Gemeinde Enns/Asten verdeutlicht, wie der Verlust von Böden mit hoher Produktionsfunktion durch die Verpflichtung des Bauherrn zur Weiterverwendung des A-Horizonts auf geeigneten Flächen minimiert werden kann. Auch in Sonthofen wurden konkrete Maßnahmen für ein überplantes Gebiet erarbeitet. Die Teilnehmer der Workshops wünschten sich explizit die Zusammenstellung konkreter Maßnahmen und deren rechtssichere Verankerung, um diese in den Planungsprozess zu integrieren. Die Diskussion anhand konkreter Beispiele wurde als besonders hilfreich empfunden. Im Fall der Gemeinde Volders (Bezirk Innsbruck) wurde eine zweistündige Einzelberatung durchgeführt. Für größere Bauprojekte wurde eine „Umweltbaubegleitung für Bodenschutz“ empfohlen.
3. Handlungs und Arbeitshilfen sowie Wissenstransfer
Um die Umsetzung des Bodenschutzes in der kommunalen Planung zu erleichtern, wurden Handlungsanleitungen und Arbeitshilfen bereitgestellt. Diese sollten den Gemeinden helfen, die Ergebnisse der Bodenfunktionsbewertung in ihre Planungsprozesse zu integrieren. Im Fall von fehlenden oder nicht zugänglichen regionalen Unterlagen können behelfsmäßig Publikationen aus angrenzenden Gebieten herangezogen werden. Die spezifische Anpassung der Handlungsanleitung an den konkreten Raum und die Bedürfnisse der Entscheidungsträger ist dabei unerlässlich. Der Wissenstransfer an Endnutzer und Dienstleister wurde durch verschiedene Workshopformate gewährleistet. In Oberösterreich, Tirol und Sonthofen wurden Workshops mit unterschiedlichen Formaten konzipiert und durchgeführt, die sich an den jeweiligen Diskussionsstand anpassten. Die Workshops in Sonthofen profitierten von den Erfahrungen in Oberösterreich und Tirol. Der positive Feedback zu den Workshops unterstreicht die Bedeutung eines funktionsbezogenen Bodenschutzes und die Notwendigkeit seiner Berücksichtigung in der örtlichen Raumplanung. Die Übertragbarkeit des Workshopdesigns und der vermittelten Inhalte auf andere Regionen wurde hervorgehoben, vorausgesetzt, es liegen entsprechende Bodenfunktionsbewertungen und unterstützende Unterlagen vor.
IV.Zusammenfassende Schlussfolgerungen und Ausblick
Das Projekt demonstrierte den Bedarf an und die Machbarkeit von effektiven Maßnahmen zum Bodenschutz in der kommunalen Raumplanung im Alpenraum. Die entwickelten Methoden und das Wissenstransfer-Konzept erwiesen sich als erfolgreich und können auf andere Regionen übertragen werden. Die Verfügbarkeit einer Bodenfunktionsbewertung, unterstützender Unterlagen und eine aktive Beteiligung der Gemeinden sind entscheidend für den Erfolg. Die Berücksichtigung der Ergebnisse der Bodenfunktionsbewertung in Abwägungsprozessen, unterstützt durch eine adäquate Rechtsgrundlage, ist essenziell für einen effektiven vorsorgenden Bodenschutz.
1. Erfolgsbewertung und Übertragbarkeit des Projekts
Das Projekt zeigte die Machbarkeit und den Bedarf an effektiven Maßnahmen zum Bodenschutz in der kommunalen Raumplanung im Alpenraum. Die entwickelten Methoden und das Wissenstransfer-Konzept erwiesen sich als erfolgreich und können auf andere Regionen übertragen werden. Die positive Bewertung der Workshops und das positive Feedback der Teilnehmer unterstreichen die Akzeptanz der Thematik und die Wirksamkeit der gewählten Ansätze. Voraussetzung für eine erfolgreiche Übertragung auf andere Regionen ist das Vorhandensein einer Bodenfunktionsbewertung für die jeweilige Region sowie ergänzende und unterstützende Unterlagen. Die in Tirol entwickelte Lesehilfe zeigt ein gutes Beispiel für unterstützende Materialien, die die Anwendung der Ergebnisse erleichtern. Eine flächendeckende und kostenlose Bereitstellung der Bodenfunktionsbewertung über eine WebGIS-Anwendung wurde als idealer Weg zur Verbreitung der Informationen genannt. Die Integration der Ergebnisse in die Planungsprozesse der Gemeinden bedarf jedoch adäquater rechtlicher Vorgaben, da der anerkannte Belang des Bodenschutzes in Abwägungsprozessen ansonsten nicht ausreichend gewichtet wird. Das Projekt empfiehlt die Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse, die Verwendung der bereitgestellten Informationen und den Aufbau von ähnlichen Workshops in anderen Regionen.
2. Rollen der Stakeholder und notwendige Rahmenbedingungen
Der Erfolg des Projekts hing von der aktiven Beteiligung verschiedener Stakeholder ab. Die Behörden müssen die Daten für die Bodenfunktionsbewertung bereitstellen und die Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen (idealerweise über eine WebGIS-Anwendung). Sie sollten die Bodenfunktionsbewertung konsequent einfordern und fachkundige Begleitung bei Erdbewegungen gewährleisten (BBB gemäß DIN 19731). Die Gemeinden benötigen Handlungsanleitungen, wie sie die Ergebnisse in die Planung integrieren können, und sollten die bereitgestellten Informationen und Workshopdesigns nutzen. Die Bereitschaft der öffentlichen Hand, die notwendigen Daten bereitzustellen und die Ergebnisse zugänglich zu machen, ist entscheidend für den Erfolg. Eine spezifische Handlungsanleitung, angepasst an die Bedürfnisse der Entscheidungsträger, ist ebenso unerlässlich. Auch die Einbindung von Architekten und Planern vor Ort ist wichtig, um den Wissenstransfer nachhaltig zu sichern. Die Gemeinden im Alpenraum und darüber hinaus sind eingeladen, die erworbenen Erkenntnisse in ihren Berufs- und Planungsalltag zu integrieren. Die Zusammenarbeit von Behörden, Planungsbüros und den Gemeinden war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des Projekts.
