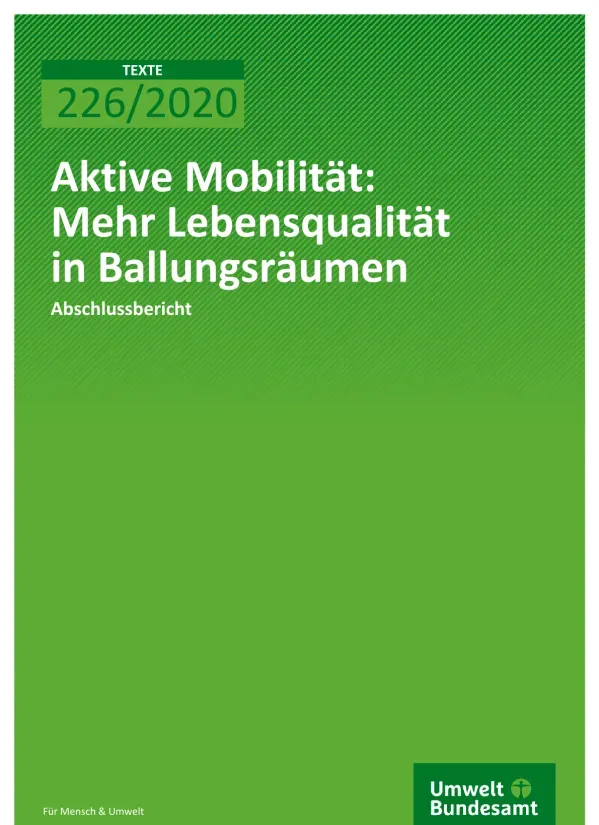
Aktive Mobilität: Lebensqualität in Städten
Dokumentinformationen
| Autor | Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike |
| instructor/editor | Petra Röthke-Habeck, Fachgebiet I 2.6 Nachhaltige Mobilität in Stadt und Land |
| Schule | Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik |
| Fachrichtung | Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik |
| Unternehmen | Umweltbundesamt |
| Ort | Dessau-Roßlau |
| Dokumenttyp | Abschlussbericht |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 4.08 MB |
Zusammenfassung
I.Aktive Mobilität Einflussfaktoren und Handlungsempfehlungen
Diese Studie untersucht die aktive Mobilität, insbesondere Fußverkehr und Radfahren, in zwölf deutschen Großstädten. Eine groß angelegte Online-Befragung (2017) und qualitative Interviews analysierten Motivationsfaktoren und Hindernisse. Wichtige Ergebnisse zeigen den hemmenden Einfluss von Pkw-Besitz und -Verfügbarkeit auf die Verkehrsmittelwahl. Höhere Kfz-Dichte im Haushalt korreliert mit weniger Wegen zu Fuß und mit dem Rad (Buehler 2012; Damant-Sirois und El-Geneidy 2015; Dill und Carr 2003; Downward und Rasciute 2015; van Goeverden und Boer 2013; Guliani et al. 2015). Elternverhalten spielt eine entscheidende Rolle in der Verhaltensprägung – häufiger Radgebrauch der Eltern fördert dies auch bei Kindern (Ghekiere et al. 2016). Die Studie identifiziert Handlungsoptionen für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zur Förderung der aktiven Mobilität und Gesundheitsförderung.
1. Definition und Gesundheitsaspekte aktiver Mobilität
Die Studie definiert aktive Mobilität als Fortbewegung mit eigener Muskelkraft, wobei Fußgehen und Radfahren im Fokus stehen. Regelmäßige körperliche Aktivität, wie sie durch aktive Mobilität erreicht wird, reduziert das Risiko für nicht-übertragbare Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes signifikant. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hebt in ihren Veröffentlichungen (WHO 2019, WHO 2014) die präventive Wirkung eines aktiven Lebensstils auch im Hinblick auf Demenzerkrankungen hervor und empfiehlt mindestens 150 Minuten moderater körperlicher Aktivität pro Woche. Diese Aktivität kann sowohl während der Arbeit, in der Freizeit als auch auf dem Weg zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolviert werden. Die Studie dient als Grundlage zur Entwicklung eines projekt-spezifischen Rahmenmodells und eines detaillierten Fragebogens zur umfassenden Untersuchung der Determinanten aktiver Mobilität. Eine groß angelegte Online-Befragung in zwölf deutschen Großstädten unterschiedlicher Größe und Topographie im Jahr 2017 sowie qualitative Interviews sollten repräsentative Aussagen über die Motivationsfaktoren und Hindernisse für aktive Mobilität ermöglichen. Die Auswertung der Daten sollte dann zu Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Kommunen führen.
2. Einflussfaktoren auf die Verkehrsmittelwahl
Ein wichtiger Aspekt der Studie ist die Analyse des Einflusses verschiedener Faktoren auf die Wahl des Verkehrsmittels. Es besteht ein eindeutiger Konsens in der Literatur, dass sowohl der Führerscheinbesitz als auch die generelle Fahrzeugverfügbarkeit die aktive Mobilität hemmen und zu einem kfz-orientierten Mobilitätsverhalten führen. Eine steigende Anzahl von Kraftfahrzeugen im Haushalt korreliert mit einer verringerten Nutzung von Fußwegen und dem Fahrrad (Buehler 2012; Damant-Sirois und El-Geneidy 2015; Dill und Carr 2003; Downward und Rasciute 2015). Dieses auto-orientierte Mobilitätsverhalten wird bereits bei Kindern beobachtet, wobei der Modal Split des Kfz-Verkehrs bei den Eltern einen starken Einfluss auf die Wahl des Schulwegs hat (van Goeverden und Boer 2013; Guliani et al. 2015). Daher ist die Vorbildfunktion der Eltern entscheidend für die Aneignung und Festigung aktiver Mobilitätsmuster im Alltag. Häufiges Radfahren der Eltern fördert das Radfahren der Kinder (Ghekiere et al. 2016). Ein frühzeitiger Bezug der Kinder zum Straßenraum, beispielsweise durch selbstständiges zur Schule gehen oder freies Spielen, wirkt sich ebenfalls positiv auf die aktive Mobilität aus (Deka 2013; Carver et al. 2014; Ghekiere et al. 2016). Auch weitere Familienmitglieder können positive Einflüsse auf das Mobilitätsverhalten ausüben.
3. Methodik und Datenerhebung
Die Studie basiert auf einer umfangreichen Datenerhebung, die im Jahr 2017 in zwölf großen deutschen Städten durchgeführt wurde. Die Datenerhebung bestand aus einer groß angelegten Online-Befragung, die es ermöglichte, repräsentative Aussagen zu den Motivationsfaktoren und Hindernissen für aktive Mobilität in diesen Städten zu treffen. Zusätzlich wurden qualitative persönliche Interviews mit einigen Teilnehmern der Online-Befragung geführt. Die Auswertung der Datensätze ergab zahlreiche Motivations- und Hindernisfaktoren, die mittels eines zweistufigen statistischen Verfahrens auf die relevantesten im Hinblick auf Gehen und Radfahren eingegrenzt wurden. Auf dieser Grundlage konnten mögliche Handlungsoptionen für die Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden ermittelt werden. Die Verwendung von Calendly für die Terminvereinbarung der Interviews wird als effizientes Werkzeug zur Verbesserung der zeitlichen Planung hervorgehoben. Eine spezifische Datenschutzerklärung wurde in Zusammenarbeit mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt und sicherte die Anonymität der Befragten. Die Interviews dauerten ca. 45 Minuten bis maximal 1 Stunde und fanden größtenteils in den Wohnungen der Befragten statt; alternative Orte wurden bei Bedarf angeboten.
II.Haushalts und Personenmerkmale
Die Befragung zeigte eine Überrepräsentation von 45- bis 64-Jährigen und eine Unterrepräsentation von über 65-Jährigen. In einigen Modellstädten (Aachen, Köln) nahmen Männer häufiger teil als Frauen. Die Stichprobe wies einen „Bildungs-Bias“ auf, mit einem überproportional hohen Anteil an Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Die Wohndauer in der aktuellen Wohnung war in den meisten Haushalten (58-66%) fünf Jahre oder länger. Köln (63%) und Kiel (62%) wiesen die höchsten Anteile auf.
1. Stichprobenstruktur und Altersverteilung
Die Analyse der Stichprobenstruktur auf Personen- und Haushaltsebene (Tabellen T1 und T2) zeigt eine leichte Überrepräsentation von Personen im Alter zwischen 45 und 64 Jahren und eine entsprechende Unterrepräsentation von Personen ab 65 Jahren in allen Stadtgruppen und den vier ExWoSt-Modellstädten. Auf Stadtgruppenebene ist eine höhere Teilnahmebereitschaft von Männern im Vergleich zu Frauen erkennbar, wobei diese Tendenz in Aachen und Köln stärker ausgeprägt ist. In Kiel und Leipzig zeigen sich hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der gewichteten und ungewichteten Stichprobe. Die Gewichtung der Stichprobe hat kaum Einfluss auf die Verteilung der Haushaltsgrößen. Der größte Anteil an Ein- und Zweipersonenhaushalten (28% bzw. 53%) ist in Leipzig zu finden, während Aachen und Köln den größten Anteil an Haushalten mit vier und mehr Personen aufweisen (jeweils 15%).
2. Bildungsniveau und Wohndauer
Eine ungewichtete Auswertung der Daten offenbart einen „Bildungs-Bias“ in der Stichprobe: Der Anteil von Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss (53-62%) ist im Vergleich zur Grundgesamtheit zu hoch. In Kiel und Leipzig liegt dieser Anteil mit 49% etwas niedriger. Dieser Bias ist typisch für Befragungen, da die Teilnahmebereitschaft mit steigendem Bildungsniveau zunimmt. Die Tabellen T10 und T11 zeigen jedoch keine systematischen Unterschiede in der Bildungsverteilung zwischen den verschiedenen Stadtgruppen. Die Auswertung der Wohndauer zeigt, dass bis zu zwei Drittel der befragten Haushalte (58-66%) bereits seit fünf Jahren oder länger in ihrer aktuellen Wohnung leben und somit als im Quartier verwurzelt betrachtet werden können. Köln (63%) und Kiel (62%) haben die höchsten Anteile, gefolgt von Leipzig (57%) und Aachen (55%).
III.Alltagsmobilität und Verkehrsmittelwahl
In kleineren Städten wird häufiger täglich Fahrrad gefahren als in großen. Hügelige Topografie reduziert die Radnutzung. Köln, Kiel und Leipzig zeigen höhere Anteile täglicher Radfahrer als Aachen. Der Anteil der Personen, die täglich zu Fuß gehen, ist in den Modellstädten ähnlich (56-59%). Die Verkehrsmittelwahl wird von verschiedenen Kriterien beeinflusst (Tabelle T24), wobei Aachen eine hohe Bedeutung auf vorhersehbare Reisezeiten legt und Leipzig eine höhere Kostensensibilität zeigt. Der Pkw-Besitz ist für Lebensmitteleinkäufe in flachen Gebieten bis 500.000 Einwohnern weit verbreitet (72%).
1. Tägliche Nutzung von Fahrrad und zu Fuß Gehen
Die Befragung zeigt, dass der Anteil der Personen, die täglich oder fast täglich das Fahrrad nutzen, in kleineren Städten tendenziell höher ist als in großen Städten (Tabelle T20, Anteile zwischen 46% und 12%). In hügeligen Städten wird seltener Fahrrad gefahren. Unter den Modellstädten liegen Köln, Kiel und Leipzig (jeweils etwa 30% tägliche Radfahrer) vor Aachen (22%). Elektrofahrräder werden in hügeligen Städten etwas häufiger genutzt als in flachen Städten. Insgesamt nutzt etwa jede zehnte Person gelegentlich ein Elektrofahrrad. Bei der täglichen oder fast täglichen Nutzung von Fußwegen gibt es zwischen den ExWoSt-Modellstädten kaum Unterschiede (Anteile zwischen 56% und 59%). Der Anteil der Personen, die (fast) täglich ein Auto nutzen, variiert zwischen 24% (Leipzig) und 34% (Kiel). In Stadtgruppen mit über 500.000 Einwohnern und hügeligem Gelände (z.B. Stuttgart und Essen) ist dieser Anteil mit 42% deutlich höher. Das Erreichen des Arbeitsplatzes mit dem Pkw ist in Köln besonders zeitaufwendig (50% benötigen mehr als 20 Minuten).
2. Kriterien der Verkehrsmittelwahl und Pkw Verfügbarkeit
Tabelle T24 wertet 13 Kriterien bezüglich ihrer Bedeutung bei der Verkehrsmittelwahl aus. Systematische Unterschiede zwischen den Stadtgruppen sind nicht erkennbar. Die Befragten in Aachen legen besonderen Wert auf eine vorhersehbare Reisezeit (75% vs. 66% in Kiel und Leipzig, 70% in Köln). In Leipzig ist die Kostensensibilität höher (59% vs. 53% in Aachen, 50% in Kiel, 48% in Köln). In Köln spielt der Internet- und Mobilfunkempfang eine größere Rolle als in anderen Städten. Die Studie untersucht auch die Pkw-Verfügbarkeit für größere Lebensmitteleinkäufe (Tabelle T26). In flachen Stadtgruppen bis 500.000 Einwohnern verfügen 72% uneingeschränkt über einen Pkw, in hügeligen Gruppen 63%. In Großstädten über 500.000 Einwohnern ist die Tendenz umgekehrt (62% vs. 68%). Der Anteil der Personen, die nach Absprache einen Pkw nutzen können, liegt bei 14-15% über alle Stadtgruppen. In Kiel und Köln können zwei Drittel uneingeschränkt über einen Pkw für Lebensmitteleinkäufe verfügen, in Aachen und Leipzig etwas weniger (59% bzw. 57%).
IV.Aktive Mobilität und Gesundheit
Fünf Befragte waren dauerhaft in ihrer Mobilität eingeschränkt. Die Studie zeigt, dass Gesundheit eine Rolle bei der Verkehrsmittelwahl spielt. Radfahren wird teilweise als präventive Maßnahme gesehen, erfordert aber gegebenenfalls geeignete Radmodelle für Menschen mit Einschränkungen. ÖPNV wird aufgrund von hohen Kosten, Überfüllung und mangelnder Taktung kritisch gesehen.
1. Mobilitätseinschränkungen und deren Auswirkungen
Die Befragung erfasste die gesundheitliche Mobilitätseinschränkung der Teilnehmer und deren Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl. Insgesamt fünf Befragte gaben dauerhafte Mobilitätseinschränkungen an. Dabei war bei einigen das Gehen, bei anderen das Radfahren leichter. Eine Befragte konnte aufgrund einer Verletzung nicht mehr Rad fahren, bevorzugte aber das Gehen, das jedoch durch unebene Wege und Kopfsteinpflaster erschwert wurde. Eine weitere Befragte nutzte das Rad für kurze Strecken aufgrund von Problemen beim Gehen über zehn Minuten und hatte sich ein therapeutisches Rad angeschafft. Eine weitere Befragte betonte die Wichtigkeit von Radfahren als Präventivmaßnahme und plädierte für mehr Aufklärung über verschiedene Radmodelle, insbesondere für Menschen mit Einschränkungen. Die Aussage: „Radfahren ist oft entlastend für den Körper, man muss eben das richtige Modell finden. Und gerade Menschen mit Einschränkungen können durch die schonende Bewegung des Radfahrens ihren Körper wieder in Bewegung bringen“, unterstreicht diesen Punkt.
2. Wahrnehmung und Bewertung des ÖPNV
Die Befragten äußerten sich auch kritisch zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Häufige Kritikpunkte waren hohe Kosten und „unangenehme“ Bedingungen. Unter „unangenehm“ wurden Überfüllung im Feierabendverkehr, Alkoholkonsum von Mitfahrenden, Müll und Verschmutzung genannt. Die unregelmäßige Taktung, insbesondere nachts, und ein ungenügend ausgebautes Streckennetz wurden ebenfalls als negativ bewertet. Die Komplexität des Ticketing-Systems stieß ebenfalls auf Kritik. Im Gegensatz dazu wurde die Möglichkeit, im Bus die Fahrzeit zum Lesen oder Entspannen zu nutzen, positiv hervorgehoben: „Im Bus kann ich die Fahrzeit nutzen. Ich lese etwas oder träume einfach vor mich hin. Im Auto könnte ich das nicht.“ Dieser positive Aspekt steht jedoch im Kontrast zu den genannten negativen Erfahrungen.
V.Zufußgehen und Radfahren Qualitative Ergebnisse
Die Interviews belegen, dass Zufußgehen als einfache, flexible und genussvolle Fortbewegungsart wahrgenommen wird, jedoch durch enge Gehwege und stark befahrenen Straßen beeinträchtigt wird. Radfahren wird oft aufgrund der Schnelligkeit bevorzugt, besonders für den Weg zur Arbeit. Gefahren durch Autofahrer (Parkverhalten, Rechtsabbieger, SUVs), Diebstahl und mangelnde Abstellmöglichkeiten werden als kritische Punkte genannt. Die Studie deckt auf, dass Radfahrer sich Autofahrern gegenüber oft unterlegen fühlen.
1. Zufußgehen Wahrnehmung und Herausforderungen
Die qualitative Analyse des Fußverkehrs zeigt, dass dieser häufig als einfache, flexible und genussvolle Fortbewegungsart angesehen wird, da keine zusätzlichen Hilfsmittel benötigt werden und das Tempo selbst bestimmt werden kann. Der Fußweg ermöglicht es, das Umfeld zu erkunden und soziale Interaktionen während der Bewegung zu pflegen. Allerdings werden auch negative Aspekte genannt. Enge Gehwege und stark befahrene Straßen führen dazu, dass Zufußgehen als unangenehm und unsicher empfunden wird. Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere mit Radfahrern, die die Verkehrsregeln missachten, werden als großes Problem wahrgenommen und führen zu Verunsicherung und einem Gefühl der Gefährdung. Die Aussage: „Ich habe ja kein Auto. Und der nächste Laden ist nur 5 Minuten entfernt, da nehme ich doch kein Fahrrad, sondern laufe“, illustriert die Nutzung des Fußwegs für kurze Distanzen, jedoch wird auch der Fußweg zur nächsten Haltestelle als selbstverständlich betrachtet.
2. Radfahren Nutzung Vorteile und Probleme
Vierzehn Befragte gaben an, nie Rad zu fahren, aufgrund von Unsicherheit, fehlendem Fahrrad oder Zeitmangel. Häufige Radnutzer nutzen das Fahrrad vor allem in der Freizeit, aber auch für Einkäufe (36% der Befragten). Das Rad bietet Vorteile beim Transport von Gütern und ermöglicht schnelles Erreichen mehrerer Orte. Zehn Befragte nutzen das Rad als Zubringer zum Auto oder zur ÖPNV-Haltestelle. Die Schnelligkeit wird als Hauptvorteil im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln, besonders auf dem Weg zur Arbeit, genannt. Die Aussage: „Wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit fahre, dann würde ich mit der Bahn dort nur sehr kompliziert hinkommen. Mit dem Fahrrad brauche ich auf der Strecke nur die Hälfte der Zeit“, veranschaulicht dies. Probleme liegen in der Gefährdung durch Autofahrer (Rechtsabbieger, parkende Autos, SUVs), dem häufigen Abstellen von Autos auf Radwegen, sowie im Diebstahl von Fahrrädern und dem Mangel an sicheren Abstellmöglichkeiten. Die Aussage: „Das Sicherheitsrisiko gehört beim Fahrradfahren einfach dazu“, verdeutlicht die wahrgenommene Unsicherheit im Straßenverkehr.
VI.Wohnumfeld und Bewertung der Maßnahmen
Die Aufenthaltsqualität der Wohnumgebung wird überwiegend positiv bewertet, jedoch gibt es Kritikpunkte, wie Lärm (Leipzig), mangelnde Sicherheit (Köln) und schlechte Straßenzustände (Leipzig). Die ExWoSt-Maßnahmen (z.B. Radwege, Tempo-30-Zonen) werden positiv aufgenommen, jedoch wird langsame Umsetzung und Bedarf an besserer Pflege bestehender Infrastruktur bemängelt. In Leipzig werden hohe ÖPNV-Preise und Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmern besonders hervorgehoben. Der Ausbau von Fahrradbügeln und die Radvorrangroute werden positiv bewertet.
1. Aufenthaltsqualität der Wohnumgebung
Die Befragten wurden nach der Aufenthaltsqualität ihrer Wohnumgebung und ihres gewohnten Umfelds befragt. Überwiegend wurde die Aufenthaltsqualität positiv bewertet. Nur drei Befragte äußerten kritischere Anmerkungen. Ein Befragter in Leipzig-Thekla beschrieb die Lage an einer stark befahrenen Durchgangsstraße mit schlechtem Straßenzustand und hohem Schwerlastverkehr als negativ, hob aber die Nähe zu einem Wald als Ausgleich hervor. Ein weiterer Befragter aus Leipzig, wohnhaft am Augustplatz, beklagte Lärm- und Erschütterungsprobleme durch die Tram, bewertete die Aufenthaltsqualität seiner Umgebung ansonsten aber positiv. Eine Befragte aus Köln-Porz zeigte sich grundsätzlich zufrieden, bemerkte aber Sicherheitsprobleme aufgrund schnellen Verkehrs und fehlender Gehwege. Die Studie zeigt, dass es schwierig ist, die grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld objektiv zu erfassen.
2. Wahrnehmung und Bewertung der ExWoSt Maßnahmen
Die ExWoSt-Maßnahmen wurden im Großen und Ganzen positiv bewertet. Die Befragten wurden im Interview über die Maßnahmen informiert und diese mit ihnen diskutiert. Einige Befragte, vor allem Autobesitzer, betonten den Bedarf an Lösungen für Autofahrer, die Transporte oder Familienfahrten benötigen. Ein schneller Wechsel weg vom privaten Pkw wird von den meisten Befragten nicht erwartet. Im Bereich Fahrradverkehr wird der Ausbau neuer Schutzstreifen und Radwege begrüßt, jedoch wird auch die Notwendigkeit einer besseren Pflege der bestehenden Wege und Radwege betont. Die Radvorrangroute wird positiv bewertet, jedoch wird auch die Unsicherheit beim Radfahren im Aachener Zentrum angesprochen. Die langsame Umsetzung von Planungsprozessen im Radverkehr wird kritisch gesehen. Die Stadtradel-Kampagne war sieben Befragten bekannt, drei davon nahmen teil und bewerteten sie positiv. Der Ausbau von Fahrradbügeln zur Diebstahlprävention wird als wichtig erachtet. In Leipzig wurden neben den hohen ÖPNV-Preisen und aggressiven Konflikten zwischen Verkehrsteilnehmern die Tempo-30-Zonen und die Stärkung des Radverkehrs positiv hervorgehoben.
3. Spezifische Beispiele aus den Modellstädten
Die Studie beinhaltet detaillierte Rückmeldungen aus den Modellstädten Aachen, Köln und Leipzig. In Aachen wurde der Quartiersfonds positiv bewertet, es bestehen jedoch weiterhin Probleme in einigen Quartieren (Hansemannplatz, Kaiserplatz, Rothe Erde, Stadtpark, Westbahnhof). Der Volksentscheid zur Straßenbahn von 2013, der den Bau der Campusbahn ablehnte, wird als verpasste Chance auf Reduktion des Pkw-Verkehrs gesehen. In Köln wurde die Einrichtung von Außengastronomie auf KFZ-Stellplätzen, trotz enger Gehwege, positiv aufgenommen. Der Ausbau von Fahrradabstellanlagen wird befürwortet, gleichzeitig wird aber auch die Notwendigkeit deren besserer Pflege angesprochen. Der „Tag des guten Lebens“ wird positiv bewertet, und 13 von 21 Befragten schlugen vor, mehr Straßen in der Kölner Innenstadt autofrei zu gestalten. In Leipzig wurde die schlechte Koordination zwischen verschiedenen Behörden bei Straßenreparaturen kritisiert, sowie der Mangel an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Die Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger, besonders Schüler, durch neue Verkehrsinseln und Ampeln wurde positiv bewertet.
VII.Statistische Auswertung
Die Studie verwendet Faktorenanalyse zur Identifizierung relevanter Faktoren für Zufußgehen und Radfahren. Logistische Regressionsmodelle erklären einen Teil der Varianz der abhängigen Variablen (ca. 20% für Zufußgehen). Soziodemografische Merkmale wie Alter, Geschlecht und Pkw-Besitz werden ebenfalls berücksichtigt.
1. Methoden der statistischen Auswertung
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mithilfe verschiedener Methoden. Um relevante Faktoren für Fußgänger und Radfahrer zu identifizieren, wurde eine Faktorenanalyse durchgeführt. Hierbei wurden Variablen in ihrer Interpretationsrichtung umkodiert, um durchgängig positive Zahlen in den Ladungen zu erhalten. Die Antwortoptionen im Fragebogen waren logisch geordnet, für die Faktorenanalyse wurden jedoch durchgehend aufsteigende Variablenkodierungen verwendet. Das Modell für die Faktorenanalyse weist ein Pseudo-R-Quadrat von 0,195 (Nagelkerke) auf, was im sozialwissenschaftlichen Kontext als akzeptabel gilt und bedeutet, dass etwa 20% der Varianz der abhängigen Variablen durch die Prädiktoren erklärt werden können. Mit 68% korrekter Klassifikationen liegt das Modell deutlich über dem Zufallsergebnis. Die Hauptkomponentenanalyse wurde verwendet, um Faktorwerte zu ermitteln (Brosius 2018).
2. Faktorenanalyse und logistische Regression
Im ersten Schritt wurden Faktoren und Faktorenkonstellationen für Fußgänger untersucht. Dazu wurde ein Datensatz vorbereitet, der für eine Faktorenanalyse geeignet war. Anschließend wurden die zwölf latenten Faktoren als Erklärungsgrößen für die aktive Mobilität verwendet und um soziodemografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Hochschulreife, Anzahl der Pkw im Haushalt, Anzahl der Kinder) ergänzt. Es wurde ein Haupteffektmodell berechnet, Interaktionsterme wurden nicht gebildet. Diese Merkmale dienten zusammen mit den zwölf Faktoren zur Klassifikation von Personen, die 3-4 mal pro Woche oder mehr Rad fahren (40,2%) gegenüber Personen, die weniger als 3-4 mal pro Woche Rad fahren (59,8%). Die abweichende Abgrenzung der Häufigkeitsgruppen im Vergleich zu den Fußgängern resultiert aus der inhaltlichen Trennschärfe und dem Wunsch nach möglichst gleich großen Klassen. Das logistische Regressionsmodell (Tabelle 54) zeigt die Regressionskoeffizienten (Beta) für alle Merkmale inklusive der zugehörigen Standardfehler. Die Methoden der Faktorenanalyse und logistischen Regression wurden verwendet, um die komplexen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen zu untersuchen und zu modellieren (Brosius 2018; Backhaus et al. 2008; Ahrens et al. 2014).
