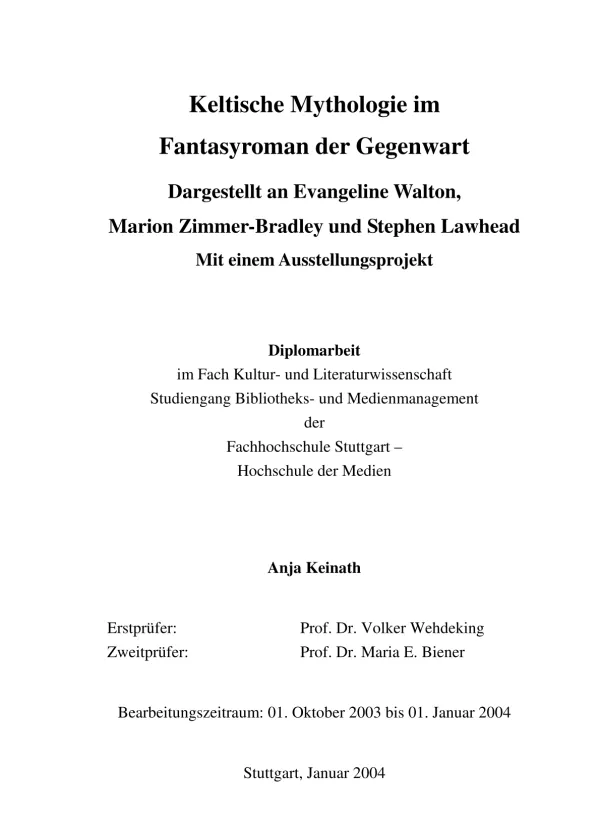
Keltische Mythen im Fantasyroman
Dokumentinformationen
| Autor | Anja Keinath |
| Schule | Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien |
| Fachrichtung | Kultur- und Literaturwissenschaft, Studiengang Bibliotheks- und Medienmanagement |
| Dokumenttyp | Diplomarbeit |
| Sprache | German |
| Format | |
| Größe | 5.40 MB |
Zusammenfassung
I.Die keltische Gedankenwelt und ihre Auswirkung auf die Fantasy Literatur
Dieser Text analysiert den Einfluss der keltischen Mythologie auf die moderne Fantasy-Literatur. Er konzentriert sich auf die Anderswelt (Otherworld), die Rolle von Göttern und Druiden in der keltischen Götterwelt, und die Bedeutung von Ritualen wie Samhain, Imbolc, Beltene und Lughnasa. Die Analyse umfasst auch wichtige Figuren wie Merlin, Morgan le Fay, und Taliesin, sowie zentrale Orte wie Avalon. Die Bedeutung des Mabinogion, einer Sammlung walisischer Mythen, wird hervorgehoben, ebenso wie die Rolle von Frauen in der keltischen Gesellschaft und Religion. Wichtige Autoren, deren Werke analysiert werden, sind Evangeline Walton (Mabinogion-Tetralogie), Stephen Lawhead (Pendragon Cycle), und Marion Zimmer Bradley (Die Nebel von Avalon). Der Text untersucht, wie keltische Motive, Symbole und Überzeugungen in modernen Fantasyromanen adaptiert und verändert wurden, um die Intentionen der jeweiligen Autoren widerzuspiegeln. Besonders werden die verschiedenen Interpretationen von Figuren wie Morgan le Fay, die mal als gute Zauberin, mal als böse Hexe dargestellt wird, untersucht. Der Text vergleicht auch die verschiedenen Darstellungen von Merlin und zeigt, wie keltische Mythen Grundängste und -bedürfnisse der Menschen ansprechen und ein Gefühl von Echtheit vermitteln.
1. Yeats Faszination für den old way of looking at the world
Der Text beginnt mit William Butler Yeats, der, trotz des Versuchs, seine irischen Wurzeln zu vergessen, von der Magie fantastischer Erzählungen fasziniert war. Literarische Stoffe erhielten für ihn umso mehr Einbildungskraft, je mehr sie sich an diesem „alten Blick auf die Welt“ orientierten. Yeats beschrieb diese Sichtweise als den Glauben an die Göttlichkeit der Natur, die Fähigkeit von Bäumen, menschliche oder groteske Formen anzunehmen und zwischen Schatten zu tanzen, und die Göttlichkeit und Veränderlichkeit fast aller Dinge unter Sonne und Mond. Diese verträumte Weltanschauung schrieb er insbesondere den alten irischen und walisischen Völkern zu. Das Bedürfnis nach Fantastischem blieb auch bei den keltischen Völkern bestehen, verlagerte sich aber vom Alltagsleben in die fiktive Literatur, vor allem in die Genres Fantasy und Fantastisches, wo der „old way of looking at the world“ weiterlebt. Die Rückführung auf keltische Ursprünge verleiht Handlungen und Symbolen einen Sinn, der zuvor möglicherweise fehlte.
2. Die keltische Gedankenwelt Mythologie Kelten und keltische Mythologie
Der zweite Abschnitt legt ein Grundverständnis der keltischen Gedankenwelt dar. Es wird erklärt, was unter Mythologie, Kelten und keltischer Mythologie zu verstehen ist. Die damalige Götterwelt und die Rolle der Druiden werden erläutert. Es werden die wichtigsten Grundthemen, die in Fantasyromanen wiederzufinden sind, vorgestellt. Der Text verwendet bewusst Präsensformen, um die Vorstellungskraft des Lesers zu schärfen und das Denken keltischer Männer und Frauen nachzuempfinden. Bilder sollen ein Gefühl für den Glauben und die Welt der keltischen Völker vermitteln. Die Materiallage, besonders auf Deutsch, wird als dürftig beschrieben, wobei Prof. Dr. Charles William Sullivan III (East Carolina College) und Prof. Dr. Geoffrey Ashe (seine Arbeit „Kelten, Druiden und König Arthur“) als wichtige Quellen genannt werden.
3. Der Ursprung von Mythen und Religionen
Der Text beleuchtet den menschlichen Drang zur Mythenbildung, der aus dem Selbstbewusstsein und dem daraus resultierenden Bedürfnis nach Erklärungen für Leben, Tod und das Unbegreifliche entsteht. Der Bezug zu Descartes' „Cogito, ergo sum“ wird hergestellt. Joseph Campbells Arbeiten zu den Funktionen von Mythologie werden erwähnt, sowie Goethes „die Welt im Innersten zusammenhält“. Die Schaffung von Göttergeschichten als mögliche Erklärungen für das Unverständliche, die Suche nach einem Anfang und die Ordnung der Welt in Gut und Böse, um soziales Zusammenleben zu ermöglichen, werden als zentrale Aspekte hervorgehoben. Die menschliche Natur der Götter wird betont, da sie uns Menschen in ihrem Handeln und ihren Fehlern widerspiegeln.
4. Die Kelten Sprachraum und Kultur nicht politische Einheit
Die Bezeichnung der Kelten durch Griechen und Römer (Keltoi/Celtae, Galatoi/Galli) um 500 v. Chr. wird erwähnt. Es wird betont, dass es kein großes keltisches Volk im heutigen Sinne gab, sondern verschiedene Gemeinschaften, deren Gemeinsamkeiten indogermanische Ursprünge und der Gebrauch keltischer Sprachen waren. Der Begriff „keltische Nation“ ist allenfalls als „Sprachnation“ zu verstehen. Die q-keltischen (goidelischen) Sprachen (Irisch, Schottisch-Gälisch, Manx) und die p-keltischen (britischen) Sprachen (Cornisch, Kymrisch, Bretonisch) werden unterschieden. Wenn von „den Kelten“ gesprochen wird, ist ein einheitlicher Sprach- und Kulturraum gemeint, nicht eine politische Einheit oder ein Reich. Ab 600 v. Chr. spricht man von keltischen Kulturen.
5. Wandel der keltischen Götterwelt und die Anderswelt
Der Abschnitt beschreibt den Wandel der keltischen Götterwelt im Laufe der Zeit. Die Darstellungen von Göttern und Druiden sind zwar vorhanden, Beschreibungen von Riten fehlen jedoch. Götter wurden in ihrer Erscheinung und Funktion verändert, einige zu menschlichen Helden „degradiert“. Die Tuatha de Danann, die letzte Göttergeneration vor den Menschen, wurden zu zarten Elfchen mit Flügeln verkleinert. Cernunnos, ein gehörnter Gott, wurde zur Figur des Teufels umgedeutet. Morrígan wurde zur Hexe Morgan, und Brigit zur Heiligen Brigitte. Es gab keine zentrale Götterwelt wie den Olymp, sondern eine Anderswelt (Otherworld, Annwn), die sich mit der irdischen Welt überlagerte. Die Übergänge zwischen den Welten waren fließend, Götter und andere Wesen (Leipreachán, Banshees, Puca) waren stets präsent.
6. Keltische Feste und ihre Bedeutung für die heutige Zeit
Die keltischen Jahreszeitenfeste Samhain, Imbolc, Beltene und Lughnasa werden beschrieben, und wie sie in abgewandelter Form in den christlichen Kalender Eingang fanden. Samhain, die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, wird als wichtigstes Hainfest hervorgehoben, an dem die Grenzen zur Anderswelt verschwammen. Menschen verschwanden in dieser Nacht oft und tauchten Jahre später wieder auf. Das Fest wurde von irischen, schottischen und walisischen Emigranten in die Welt getragen und wird heute als Halloween gefeiert. Das Wiedererstehen des Lebens aus dem Tod wurde symbolisch durch das Löschen und erneute Entzünden aller Feuer auf Tara, dem religiösen Zentrum Irlands, dargestellt.
7. Die Anderswelt Konzept und Zugang
Die verschiedenen Bezeichnungen für die keltische Anderswelt (Otherworld, Tir na n’Og, Tir na m’Beo, Annwn, Avalon etc.) werden aufgeführt. Es wird betont, dass diese Welt nicht an einem bestimmten Ort existierte, sondern überall um uns herum war. Sie wird als Gegenpol zur rationalen Wirklichkeit beschrieben, wobei die keltische Vorstellung von Realität sich vom New-Age-Denken unterscheidet. Die drei miteinander verwobenen Entitäten Körper, Verstand und Geist wurden als eins betrachtet, eine Trennung in physisch, mental und spirituell existierte nicht. Die Anderswelt hat ihre eigenen Regeln, die Zeit vergeht dort langsamer. Zugänge zur Anderswelt sind Nebelschwaden, Wasser, Hügel und Quellen. Zeichen für den Kontakt zur Anderswelt sind strahlend weiße Tiere mit blutroten Augen, wunderschöne Frauen mit Vögeln und sphärische Musik.
8. Heilige Bäume Gewässer und Quellen
Der Abschnitt beschreibt die Bedeutung von Bäumen und Gewässern in der keltischen Kultur. Bäume verkörperten Lebenskraft und Weisheit, ihr Rauschen wurde als Flüstern der Götter interpretiert. Zeremonien fanden in heiligen Hainen, besonders aus Eichen, statt. Gewässer, besonders Quellen, standen für das Unstete und Andersweltliche. Haselsträucher an heiligen Quellen versprachen Weisheit. Die Legende des Flusses Boyne wird als Beispiel genannt, sowie der Brauch, Schmuck oder Waffen als Opfergaben in Gewässer zu werfen (z.B. Excalibur).
9. Epische Reisen und Questen in keltischen Legenden
Epische Reisen und Questen als weit verbreitetes Motiv werden beschrieben. Während Kämpfe eher den Göttern vorbehalten waren, unternahmen Menschen abenteuerliche Reisen. Beispiele sind die Reisen von Bran, Brendan und Maeldun. Die Mabinogion-Erzählung „Culhwch und Olwen“ wird als Beispiel für eine Quest mit romantischem Aspekt genannt. Symbolisch stellen diese Reisen eine Suche nach etwas Wichtigem dar, oft mit Bezug zur Anderswelt.
10. Taliesin Weise Seher und Magier
Taliesin, ein walisischer Barde, Seher und Magier, wird als wichtiger keltischer Weiser und Vorläufer Merlins vorgestellt. Er lebte im 6. Jahrhundert n. Chr. in Nordengland und soll kymrischer Abstammung gewesen sein. Seine Gedichte im „Llyfr Taliesin“ werden erwähnt, wobei nur zwölf Gedichte ihm eindeutig zugeschrieben werden. In walisischen Legenden erscheint Taliesin als Reinkarnation von Gwyon Bach, dessen Geschichte mit dem Kessel der Muttergöttin Ceridwen erzählt wird. Taliesins Seelenwanderung durch belebte und unbelebte Gegenstände ist ein wichtiges Motiv.
11. Hexe Zauberin Die Entwicklung der Figur Morgan le Fay
Die Entwicklung der Figur Morgan le Fay von einer Heilerin zu einer bösen Hexe in der keltisch-christlichen Arthur-Legende wird nachvollzogen. Ursprünglich gab es in der keltischen Mythologie keine bösen Zauberinnen. In Geoffrey of Monmouths „Vita Merlini“ erscheint Morgan zunächst als Heilerin. Später, etwa im „Prosa-Lancelot“, wird sie von Mönchen zur Hexe stilisiert. Morgan le Fay ist eine komplexe Figur mit positiven und negativen Aspekten, in der ihre keltischen Ursprünge erkennbar sind. Ihre verschiedenen Namen (Morgan Le Fay, Morgaine, Viviane etc.) unterstreichen ihre Vielschichtigkeit.
12. Die Mabinogion und ihre Bedeutung für die Fantasy Literatur
Die Mabinogion, eine Sammlung walisischer Legenden, wird im Detail beschrieben. Die vier Zweige des Mabinogion (um Pwyll, Branwen, Manawyddan und Math) wurden vermutlich von einem Mönch druidischer Herkunft gesammelt und niedergeschrieben. Lady Charlotte Guest übersetzte sie 1849 ins Englische. Evangeline Walton nutzte diese Übersetzung als Grundlage für ihre erfolgreiche Fantasy-Tetralogie, die eine Renaissance keltischer Themen auslöste. Die Tetralogie zeigt den Übergang von einer altkeltischen zu einer römisch-christlichen Gesellschaft. Die Autorin fügte lediglich verbindende Elemente hinzu um die Geschichte für ein modernes Publikum verständlicher zu machen.
II.Die Kelten Kultur Glaube und Gesellschaft
Der Abschnitt beschreibt die keltischen Völker der Britischen Inseln, nicht als einheitliches Volk, sondern als verschiedene Gemeinschaften mit indogermanischen Ursprüngen und keltischen Sprachen (Q-keltische Sprachen wie Irisch, Schottisch-Gälisch und Manx; P-keltische Sprachen wie Kymrisch, Bretonisch und Cornish). Er erläutert den Glauben an eine Anderswelt, die sich mit der irdischen Welt vermischt. Wichtige Wesen der Anderswelt werden genannt, z.B. Leprechauns und Banshees. Die Rolle der Druiden als religiöse Führer und Hüter des Wissens wird beleuchtet, ebenso die Bedeutung heiliger Orte wie Hainen und Quellen. Die keltischen Feste (Samhain, Imbolc, Beltene, Lughnasa) und ihre Übertragung in den christlichen Kalender werden beschrieben. Der Text hebt die Dürftigkeit der Materiallage zu diesem Thema in deutscher Sprache hervor und nennt wichtige Forscher wie Prof. Dr. Charles William Sullivan III und Prof. Dr. Geoffrey Ashe als Quellen.
1. Die Kelten Keine einheitliche Nation sondern Sprach und Kulturraum
Der Text beginnt mit der Klarstellung, dass die Kelten keine einheitliche Nation oder Rasse bildeten, sondern verschiedene Gemeinschaften und Gruppen, die durch indogermanische Ursprünge und den Gebrauch keltischer Sprachen verbunden waren. Die Griechen und Römer bezeichneten sie um 500 v. Chr. als Keltoi/Celtae oder Galatoi/Galli, wobei die Bezeichnung „Keltische Nation“ eher als „Sprachnation“ zu verstehen ist. Es werden die q-keltischen oder goidelischen Sprachen (Irisch, Schottisch-Gälisch und Manx) und die p-keltischen oder britannischen Sprachen (Cornisch, Kymrisch und Bretonisch) unterschieden. Die Bezeichnung „die Kelten“ bezieht sich im Allgemeinen auf einen einheitlichen Sprach- und Kulturraum, nicht auf eine politische Einheit oder ein Reich. Der Text betont die Diversität der keltischen Kulturen und ihre sprachliche Grundlage.
2. Die keltische Götterwelt und die Rolle der Druiden
Der Abschnitt beleuchtet die keltische Götterwelt und die Bedeutung der Druiden. Es gab keine zentrale Götterwelt wie den Olymp der Griechen, sondern eine Vielzahl an Gottheiten, deren Darstellungen und Funktionen sich im Laufe der Zeit veränderten. Viele Gottheiten wurden zu menschlichen Helden „degradiert“. Beispiele für diese Veränderungen sind die Tuatha de Danann (zu zarten Elfchen verkürzt), Cernunnos (zum Teufel umgedeutet), Morrígan (zur Hexe Morgan), und Brigit (zur Heiligen Brigitte). Die Druiden spielten eine wichtige Rolle in der keltischen Gesellschaft, als Hüter des Wissens und religiöse Führer. Der Text erwähnt allerdings, dass schriftliche Quellen über Rituale und Kulthandlungen der keltischen Religion rar sind. Die bestehende Quellenlage, besonders in deutscher Sprache, wird als dürftig bezeichnet. Wichtige Forschungsbeiträge von Prof. Dr. Charles William Sullivan III und Prof. Dr. Geoffrey Ashe werden erwähnt.
3. Die Anderswelt Eine parallele flüchtige Realität
Ein zentraler Aspekt der keltischen Kultur war der Glaube an eine Anderswelt (Otherworld, Anderswelt, Annwn), eine Art Parallelwelt zur irdischen Realität. Diese beiden Welten überlagerten sich, die Übergänge waren fließend. Götter und verschiedene mythische Wesen bevölkerten diese Anderswelt, welche als „the home of our emotive primordial links with our origins, the home of the unknown or the unanswered“ beschrieben wird. Die Anderswelt war nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sondern allgegenwärtig. Es gab verschiedene Bezeichnungen für die Anderswelt (Tir na n’Og, Tir na m’Beo, Apfelinsel, Avalon usw.), die je nach Legende variierten. Der Text betont den Unterschied zwischen der keltischen und der modernen (New-Age) Sicht auf die Beziehung zwischen realer und spiritueller Welt. Kelten sahen Körper, Verstand und Geist als untrennbar miteinander verbunden an, eine Trennung wie in „physisch – mental – spirituell“ gab es nicht.
4. Keltische Feste Samhain Imbolc Beltene Lughnasa
Der Abschnitt beschreibt die vier wichtigsten keltischen Jahreszeitenfeste: Samhain, Imbolc, Beltene und Lughnasa. Diese Feste wurden in abgewandelter Form in den christlichen Kalender integriert. Samhain (31. Oktober/1. November) markiert den Beginn des keltischen Jahres und war eine Zeit, in der die Grenzen zur Anderswelt verschwammen, Geister und Götter das Diesseits besuchten. An Samhain versammelten sich irische Könige auf Tara, um das Wiedererstehen des Lebens aus dem Tod symbolisch durch das Löschen und erneute Entzünden aller Feuer zu feiern. Die Bedeutung von Samhain für die heutige Zeit als Halloween wird hervorgehoben. Die anderen Feste (Imbolc, Beltene, Lughnasa) werden kurz mit ihren charakteristischen Merkmalen beschrieben, wobei Lughnasa als eine Art keltische Olympiade mit rituellen Zeremonien und Wettkämpfen vorgestellt wird.
5. Naturverehrung Die Bedeutung von Bäumen und Gewässern
Die Verehrung der Natur, insbesondere von Bäumen und Gewässern, wird als wichtiger Aspekt der keltischen Kultur beschrieben. Bäume verkörperten immense Lebenskraft, ihr Rauschen wurde als Flüstern der Götter interpretiert, und sie galten als Symbole der Weisheit. Zeremonien fanden in heiligen Hainen, vor allem aus Eichen, statt. Gewässer, insbesondere Quellen, waren ebenfalls heilig und repräsentierten das Unstete, Trügerische, Andersweltliche. Haselsträucher an heiligen Quellen versprachen Weisheit, wie die Legende des Flusses Boyne in Irland zeigt. Opfergaben an die Gottheiten der Gewässer waren Schmuck oder Waffen, ein Brauch, der in der Artussage fortbesteht.
III.Evangeline Waltons Mabinogion Tetralogie Eine moderne Interpretation keltischer Mythen
Dieser Abschnitt behandelt Evangeline Waltons vierbändige Adaption der walisischen Mabinogion. Die Tetralogie stellt den Übergang von einer altkeltischen zu einer römisch-christlich geprägten Gesellschaft dar, ohne die ursprünglichen Geschichten zu verändern. Der Fokus liegt auf der Integration der alten Mythen in eine moderne Erzählung, die sowohl für männliche als auch weibliche Leser aller Altersgruppen verständlich ist. Die Autorin erhält Lob für die Wiederbelebung des Interesses an keltischer Kultur durch ihre Arbeit.
1. Evangeline Waltons Ansatz Eine behutsame Erweiterung der Mabinogion
Evangeline Walton erweiterte die etwa 20-seitige Originalfassung der walisischen Mabinogion zu einer über 750-seitigen Fantasy-Tetralogie. Ihr Ziel war es, die alten Geschichten so zu erzählen, dass sie auch im modernen Kontext verständlich bleiben. Walton veränderte die ursprünglichen Erzählungen nicht, sondern fügte lediglich verbindende Elemente hinzu, um ein logisches Gesamtbild zu schaffen und die Lücken im Originaltext zu schließen. Das zentrale Thema ihrer Tetralogie ist der Übergang von einer altkeltischen zu einer römisch-christlich beeinflussten Gesellschaft. Im Gegensatz zu anderen Autoren, die die Mabinogion stark umgestalteten, blieb Walton den ursprünglichen Geschichten treu. Die Tetralogie richtet sich an ein breites Publikum, sowohl Männer als auch Frauen, und verschiedene Altersgruppen (außer Kinder).
2. Die Handlungsstränge der Mabinogion Tetralogie Verknüpfung verschiedener Mythen
Der Text skizziert die Handlung verschiedener Bände der Tetralogie. Im dritten Band, „Rhiannons Lied“, wird der Fluch gegen Pryderis Vater thematisiert, der zu dessen Verschwinden in der Nacht vor Beltene führt und Rhiannons Verstoßung zur Folge hat. Jahre später wird Pryderi, fälschlicherweise als Königssohn identifiziert, an den Hof zurückgebracht. Die wahre Vaterschaft Pryderis, sowie die Auswirkungen des Fluchs, werden in der Erzählung beleuchtet. Ein weiterer Handlungsstrang beinhaltet Math, dessen Fußhalterin vergewaltigt wird, was zur Heirat des Königs und der Suche nach einer neuen Fußhalterin führt. Gwydions Schwester Arianrhod, die bei dem Test der Jungfräulichkeit zwei Söhne zur Welt bringt, spielt eine zentrale Rolle. Arianrhods Weigerung, ihrem Kind einen Namen und Waffen zu geben, führt zu einer Reihe von Ereignissen und Verwandlungen, die schließlich zum Tod Llew Llaw Gyffes führen. Gwydion erschafft schließlich Blodeuwedd, eine Frau aus Blumen und Blüten, welche Llew betrügt und seinen Tod verursacht. Der Kreislauf von Leben, Tod und Verwandlung in der keltischen Mythologie wird durch diese Handlungsstränge verdeutlicht.
3. Einzelmotive in Waltons Tetralogie Verwandlungen und Symbolik
Neben dem Konflikt zwischen Matriarchat und Patriarchat thematisiert die Tetralogie weitere keltische Elemente, insbesondere Verwandlungen. Maths Neffen müssen für einen Krieg als Hirsch, Eber und Wolf leben und Nachkommen zeugen - eine Initiation in die Fruchtbarkeit des Landes. Gwydion und Llew verwandeln sich dreimal, um Arianrhod zu täuschen. Gwydion und Math erschaffen Blodeuwedd aus Blumen, was die fließenden Grenzen zwischen irdischer und andersweltlicher Realität zeigt. Der Rabe, den Branwen sendet, kann als Gedanken- oder Gestaltenaustausch interpretiert werden. Diese Motive verdeutlichen die zentrale Rolle der Verwandlung in keltischen Mythen und die Nähe zwischen der irdischen und der Anderswelt. Die Autorin verbindet diese Motive meisterhaft und schafft eine kohärente Geschichte.
4. Rezeption von Waltons Tetralogie und Vergleich mit anderen Autoren
Evangeline Walton wird gelobt für ihren behutsamen Umgang mit dem Originalmaterial der Mabinogion. Sie schuf eine über 750-seitige Tetralogie ohne die ursprünglichen Erzählungen zu verändern, sondern nur durch verbindende Elemente zu einer kohärenten Geschichte zusammenzufügen. Die Tetralogie wurde ein großer Erfolg, was zu einem erneuten Interesse an keltischen Themen führte. Der Text vergleicht Waltons Vorgehen mit dem von Stephen Lawhead und Marion Zimmer Bradley, deren Adaptionen von keltischen Mythen und der Artussage zwar erfolgreich, aber deutlich anders in ihrer Herangehensweise sind. Während Walton eine neutrale Sichtweise einnimmt, integrieren Lawhead und Bradley ihre eigenen Interpretationen und Botschaften stärker in ihre Werke. Die Rezeption von Waltons Werk unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung von keltischen Mythen in einen modernen Fantasy-Kontext.
IV.Stephen Lawheads Pendragon Zyklus Atlantis Kymren und der Aufstieg Merlins
Hier wird Stephen Lawheads Pendragon Cycle analysiert. Der Zyklus verbindet keltische Mythen mit der Artus Sage, wobei Atlantis als Ursprung der keltischen Kultur dargestellt wird. Wichtige Figuren sind Charis (Atlantisprinzessin), Taliesin (ein wichtiger Druide und Vorläufer Merlins), und Morgian (eine komplexe Figur, die als Hexe interpretiert werden kann). Der Text betont Lawheads christliche Perspektive und die Integration christlichen Glaubens in die keltische Mythologie. Die Geschichte um den Untergang von Atlantis und den Beginn der Artus Sage wird beleuchtet. Der Abschnitt hebt auch den epischen Stil und die sprachliche Gestaltung des Romans hervor, sowie die Darstellung der Beziehung zwischen Kymren und Atlantern.
1. Der Untergang von Atlantis und die Flucht nach Cornwall
Lawheads Pendragon-Zyklus beginnt parallel mit den Lebensgeschichten von Charis, Tochter des atlantischen Königs Avallach, und Taliesin, einem wundersamen Jungen, der an Beltene gefunden wird. Charis erlebt eine glückliche Kindheit in Atlantis, doch der Mord am Hochkönig führt zu Konflikten und dem brutalen Tod ihrer Mutter und Brüder. Verzweifelt flieht Charis in die Stierarena und findet dort Zuflucht, bevor sie zu ihrem Vater zurückkehrt. Avallach trägt eine unheilbare Kriegswunde. Charis spürt als einzige das bevorstehende Erdbeben und den Untergang Atlantis. Sie überzeugt einige Familien, mit ihr zu fliehen, und sie gelangen nach Cornwall. Die Atlanter, mit ihrer außergewöhnlichen Schönheit und Unsterblichkeit, werden als Feenwesen angesehen. Avallachs Palast im Sumpf wird Ynys Witrin, die Glasinsel genannt.
2. Taliesin und Charis Seelenverwandtschaft und verbotene Liebe
In Cornwall bezaubert Taliesins Gesang Charis, beide erkennen eine Seelenverwandtschaft. Taliesin weiß, dass die Schicksale der Atlanter und Kymren miteinander verwoben sind. Die Kymren finden bei Avallach eine neue Heimat, doch er verbietet die Heirat seiner Tochter mit einem Kymren. Charis und Taliesin heiraten heimlich und fliehen. Taliesin trifft Morgian, Avallachs Tochter, und spürt die von ihr ausgehende Gefahr. Am Hof des Demetenkönigs bezaubert Taliesins Gesang die Menschen, der König wird gütiger. Charis gebärt ein totes Kind, dem Taliesin das Leben einhaucht; der Junge wird Merlin genannt. Druiden verkünden, dass ein großes Leben sich für ein noch größeres geopfert habe – Taliesin wird auf der Rückreise von Morgians falscher Botschaft getötet.
3. Merlins Aufstieg und Fall Königmacher und Wahnsinn
Der zweite Teil der Geschichte folgt der Artussage. Vortigern ruft Merlin, der seinen Drachentraum deutet. Merlin vereint die Könige, setzt Aurelius und Uther auf den Thron und kümmert sich um Arthurs Erziehung. Er lebt kurz bei Charis in Ynys Witrin, die wie alle Atlanter kaum altert. Nach Uthers Tod kommt es zu Aufständen und Merlin stößt das Schwert Britanniens in einen Stein, prophezeit, wer es ziehen kann, sei der wahre König. Merlin heiratet Ganieda, eine Überlebende aus Atlantis, und erlangt die Königswürde. Doch bei einem Überfall wird Ganieda getötet, und Merlin flieht wahnsinnig in den Wald. Taliesins Vision kündigt einen Fremden an, der Merlin von seinem Wahnsinn heilen soll; Gut und Böse kämpfen um Merlins Seele, was in einer nicht chronologisch erzählten Geschichte mit Selbstgesprächen, Vorwürfen und Bruchstücken dargestellt wird.
4. Das Ende alter Welten Atlantis und Britannien
Lawhead erzählt den Untergang zweier Welten: Atlantis, dessen Untergang durch Krieg, Erdbeben und drei Vorzeichen (Lia Fail, ein wilder Prophet, ein Sternenschauer) angekündigt wird, und Dyfed, wo der Abzug der römischen Legionen zu Überfällen durch Pikten, Skoten und Sachsen führt. Charis erlebt die Zerstörung Atlantis im Wahrheitskristall Lia Fail. Elphin muss eine Armee aufstellen, um gegen die Angreifer zu kämpfen. Sowohl die Atlanter als auch die Kymren müssen ihre Heimat verlassen. Dieser Untergang wird als ein Abschied von der alten keltischen Religion und dem Beginn einer neuen christlichen Ära dargestellt, ein Prozess, der von den Menschen teilweise positiv aufgenommen wird. Lawhead präsentiert einen Kampf zwischen christlichen Briten und den „heidnischen“ Angreifern als einen Kampf zwischen Gut und Böse. Der christliche Glaube wird als neue Hoffnung und Zukunft dargestellt.
5. Charaktere und ihre Symbole Charis Taliesin Avallach Morgian
Die Atlantisprinzessin Charis, als Hüterin des Lichts und des Lia Fail, wird vorgestellt. Ihre Mutter Danae wird als Dana, Stammmutter der Tuatha de Danann, interpretiert. Die Atlanter werden als Feenwesen gesehen. Avallachs Palast, Ynys Witrin, wird mit Avalon in Glastonbury gleichgesetzt. Taliesin wird bei Lawhead als frommer Christ und Druide dargestellt, der die neue Religion predigt. Morgian wird als böse Hexe charakterisiert, die den Teufel verehrt - im Gegensatz zu der Figur bei Geoffrey of Monmouth, welche positiv dargestellt wird. Avallach, Charis' Vater, wird als Fischerkönig der Gralslegende interpretiert, basierend auf Mythen um Bran den Gesegneten und Afallach, der als Schirmherr der Gralskapelle in Ynys Witrin dargestellt wird. Cernunnos wird als gehörnter Teufel dargestellt. Die Romane sind römisch-maskulin geprägt, mit einer weniger starken weiblichen Präsenz.
6. Stilistische Mittel und die Botschaft des Romans
Der Roman verbindet historische Fakten mit fiktiven Elementen und präsentiert eine moderne Interpretation keltischer Mythen. Die Sprache und der Stil variieren: Epische Szenen in Atlantis verwenden eine altertümliche Sprache, die das hohe Ansehen der Protagonisten unterstreicht, während die Kymren derber und direkter dargestellt werden. Die Geschichte zeigt den Konflikt zwischen keltischer und christlicher Kultur. Lawhead integriert seine eigene christliche Botschaft in die Erzählung. Taliesins Aussage „Der Herr ist mir erschienen, auf daß ich ihn anbete und meinem Volk seinen Namen verkünde“ zeigt diese Integration. Der Roman bietet interessante Interpretationen zum Beginn der Artussage, welche in den folgenden Bänden fortgeführt werden. Die Romane präsentieren auch zwei Liebesgeschichten (Taliesin/Charis, Merlin/Ganieda), welche tragisch enden und Trost im christlichen Glauben finden.
V.Marion Zimmer Bradleys Nebel von Avalon Eine feministische Perspektive auf die Artussage
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Marion Zimmer Bradleys Die Nebel von Avalon. Der Roman erzählt die Artus Sage aus der Perspektive von Frauen, vor allem Morgan le Fay (hier Morgaine genannt). Die Autorin dekonstruiert die traditionelle Darstellung von Morgan le Fay und zeigt ihre Rolle im Priesterinnenkult von Avalon. Avalon wird als Parallelwelt zur irdischen Welt und als Ort des keltischen Priesterinnenkults dargestellt. Der Text hebt den feministischen Ansatz Bradleys hervor und analysiert die verschiedenen weiblichen Figuren (Viviane, Igraine, Morgause, Morgaine) als Verkörperung einer weiblichen Gottheit, die Aspekte von Jungfräulichkeit, Mutterschaft, Weisheit und Tod repräsentieren. Die Symbolik von Cernunnos und die Integration keltischer Rituale in die Erzählung werden analysiert.
1. Mists of Avalon Eine feministische Neuinterpretation der Artussage
Marion Zimmer Bradleys "Die Nebel von Avalon" erzählt die Artussage aus einer ungewöhnlichen Perspektive: aus der Sicht der Frauen, insbesondere der oft als böse dargestellten Hexe Morgan, hier Morgaine genannt. Der Roman beginnt mit Artus' Geburt und endet mit seinem Tod. Sein Schicksal ist eng mit den Priesterinnen und Druiden von Avalon, der Apfelinsel, verbunden. Bradleys Inspiration war Malorys "Le Morte d’Arthur", in dem Morgan und die Dame des Sees weder eindeutig gut noch böse dargestellt werden. Bradley hinterfragt die gängige Darstellung und untersucht, ob die Figuren nicht einfach aufgrund von Unsicherheit über ihre Funktion aus der Geschichte gestrichen worden wären.
2. Avalon Ursprung Beschreibung und der Priesterinnenkult
Avalon, als typische Paradiesinsel im Stil der keltischen Anderswelt beschrieben, hat seinen Ursprung in Atlantis. Zugänglich durch dichten Nebel und einen See, existiert Avalon parallel zur realen Welt, an der Stelle des Klosters Glastonbury. Die Insel wird als Parallelwelt beschrieben, die stets präsent, aber unsichtbar ist. Morgaine findet ein Heiligtum mit Steinkreisen, einem Spiegelteich, Apfelbäumen und Eichen mit goldenen Misteln vor. Bradley beschreibt eine Schwesternschaft von Priesterinnen, die der Göttin huldigen und in Kräuterkunde, Schreiben und Lesen unterwiesen sind. Sie beherrschen die Elemente und können ihren Geist von Zeit und Raum lösen. Die Autorin verbindet historische Fakten mit Fiktion, wobei die Attribute der Druiden auf die Priesterinnen übertragen werden: Eichenhaine, goldene Misteln und weiße Gewänder.
3. Morgaine Nicht nur Böse sondern komplexe Figur im Kontext des Priesterinnenkultes
Der Roman konzentriert sich auf Morgaine, Tochter Avalons, und ihre Rolle im Priesterinnenkult. Die vier Hauptfiguren – Viviane (weise Alte), Igraine (Mutter), Morgause (der Tod), und Morgaine (Jungfrau) – verkörpern eine göttliche Vierzahl. Sie beten den Mond als Göttin an und tragen einen blauen Halbmond. Die Verbindung zur Muttergöttin Ceridwen wird über den „glühenden Kuss Ceridwens“ hergestellt (obwohl Arianrhod eher mit dem Mond verbunden ist). Morgaine manipuliert Ereignisse, um den Untergang der alten Götter zu verhindern, unterstützt durch Viviane und Taliesin (als Merlin). Sie sorgt für Artus' Zeugung und Erziehung. Später arbeitet sie gegen den christlichen Einfluss und versucht den keltischen Glauben zu erhalten. Der Kampf um Avalon und seine heiligen Insignien (Speer, Schwert, Kelch, Schale) wird als zentraler Konflikt dargestellt.
4. Das Ritual von Cernunnos und die weibliche Gottheit
Bradleys Roman integriert den gehörnten Gott Cernunnos positiv in den Kult der Göttin. Ein Ritual, in dem Artus als Königshirsch den mächtigsten Hirsch tötet, um die Muttergöttin zu ehren und neues Leben zu ermöglichen, wird beschrieben. Der Kreislauf von Leben und Tod wird betont: Die Göttin empfängt ihren Gefährten und wird ihn am Ende töten. Die Hirschsymbolik wird mehrfach verwendet, um die alte Religion und die Feenwelt hervorzuheben. Die Priesterinnen tragen Hirschleder, Morgaine bindet ihr Haar damit, und die Schwertscheide Excaliburs ist aus Hirschleder. Die enge Verbindung zwischen Morgaine und der Göttin, als Terra Mater, wird deutlich dargestellt. Die Autorin betont durch die Darstellung der vier Frauen die Bedeutung weiblicher Figuren in der keltischen Gesellschaft.
5. Die Vier Frauen Avalons und ihre Rollen
Morgaine ist nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines Viergestirns mit Viviane, Igraine und Morgause. Der Roman betont die Wichtigkeit von Frauen in der keltischen Gesellschaft des 5. Jahrhunderts und den Glauben an eine weibliche Gottheit als Lebensspenderin. Morgaine verkörpert die Jungfrau, Igraine die Mutter, Viviane die Weise Alte, und Morgause, entgegen der anfänglichen Vorhersage, erscheint nicht als die tödliche Seite der Göttin, sondern als bodenständige und fürsorgliche Mutter und Tante. Die mütterliche und fürsorgliche Natur der vier Frauen wird hervorgehoben, im Gegensatz zur traditionellen Darstellung von Morgaine als böse Hexe. Morgause' lockere Ehe wird erwähnt, im Gegensatz zu den anderen Frauen.
6. Kevin und die Verzerrung der Merlin Figur
Der Roman behandelt die Figur Kevins, der Taliesin und somit Merlin beerbt. Im Gegensatz zu traditionellen Fantasy-Darstellungen, wo Merlin oft als einzige weise Figur auftritt, wird hier Merlin als Titel für den jeweiligen Oberdruiden verwendet. Taliesin wird nach dem mythologischen Vorbild als alter, weiser Druide mit einer glockenhellen Stimme beschrieben. Kevin dagegen ist verkrüppelt und seelisch zerrissen, und wird schließlich getötet, nachdem er Avalon verraten hat. Seine animalische sexuelle Gier wird betont, im Gegensatz zu der positiven Darstellung Taliesins. Kevins Figur stellt eine Adaption des teuflischen Merlins aus mittelalterlichen Schriften dar, der als Sohn eines Dämons dargestellt wurde, und seine Beziehung zu Nimue (Dame des Sees) wird hier als eine Veranschaulichung seiner teuflischen Herkunft dargestellt.
VI.Fazit Keltische Motive in der Fantasy Literatur
Abschließend fasst der Text zusammen, warum keltische Mythen und Motive die Fantasy-Literatur so stark prägen. Er betont die Verwendung von keltischen Elementen (magische Schwerter, Kelche, Anderswelt, Druiden, Hexen, Feen etc.) um ein Gefühl von Echtheit und Authentizität zu erzeugen und die Grundängste und -bedürfnisse der Leser anzusprechen. Der Text erwähnt John Ronald Reuel Tolkien als Wegbereiter der modernen Fantasy und Jean-Louis Fetjaine als Beispiel für eine moderne Adaption der Artus Sage mit keltischen Elementen.
1. Die Faszination für keltische Mythen in der Fantasy Literatur
Der Text schließt mit einer Betrachtung darüber, warum keltische Mythen und Motive die Fantasy-Literatur so stark beeinflussen. Die Verwendung von Elementen aus der keltischen Kultur – magische Schwerter, Kelche, die Anderswelt, Druiden, Hexen, Feenwesen usw. – erzeugt ein Gefühl von Authentizität und spricht gleichzeitig grundlegende Ängste und Bedürfnisse der Menschen an. Ein naturverbundener Glaube und die Vorstellung, von weisen Figuren unterstützt zu werden, sind attraktive Elemente. Insbesondere in unsicheren Zeiten suchen Menschen nach Halt in ihren Ursprüngen und finden diesen in fantastischen Welten, wo Magie, gute Zauberer und das letztendliche Überwinden des Bösen Trost und Hoffnung bieten. Der Text stellt fest, dass viele Fantasy-Elemente, die nicht direkt keltischen Ursprungs sind (z.B. Ringe, Zwerge), dennoch in einem keltisch geprägten Kontext erscheinen.
2. Tolkien und die Entstehung einer neuen Mythologie
John Ronald Reuel Tolkien wird als Wegbereiter für die Verwendung keltischer und germanischer Motive in der Fantasy-Literatur genannt. Er verschmolz in „Der Herr der Ringe“ Elemente beider Mythologien zu seiner eigenen Welt, Mittelerde, und schuf so eine neue, englische Mythologie. Er integrierte dabei frei erfundene Wesen wie Orks und Uruk-Hai harmonisch in seine Welt. Dieser Ansatz inspirierte viele nachfolgende Autoren, die keltische und germanische Elemente, oft kombiniert mit selbst erfundenen Wesen, in ihren Fantasy-Welten verwenden. Ein Beispiel hierfür ist Jean-Louis Fetjaine, der ebenfalls neue Adaptionen der Artussagen schuf.
3. Die anhaltende Bedeutung keltischer Elemente in der Fantasy
Der Text beleuchtet die anhaltende Attraktivität keltischer Mythen für Autoren und Leser. Der Gebrauch von keltischen Motiven, die einst das Leben und die Glaubensvorstellungen keltischer Völker prägten, vermittelt ein Gefühl der Echtheit. Gleichzeitig werden grundlegende menschliche Ängste und Sehnsüchte angesprochen: der Wunsch nach einem naturverbundenen Glauben, die Hoffnung auf Hilfe durch weise Figuren und die Sehnsucht nach einer Welt, in der am Ende das Gute überwiegt. Die Modifikation und Anpassung keltischer Elemente an die Intentionen der Autoren wird erwähnt, wobei die ursprünglichen Bilder dennoch erhalten bleiben. Beispiele für solche Adaptionen werden gegeben (Merlin als böser Zauberer, doppelzüngige Figuren aus den Mabinogion als Berater des Königs usw.). Die Beliebtheit keltischer Mythen wird im Kontext von globaler Unsicherheit und dem Rückbesinnen auf die eigenen Wurzeln gesehen.
